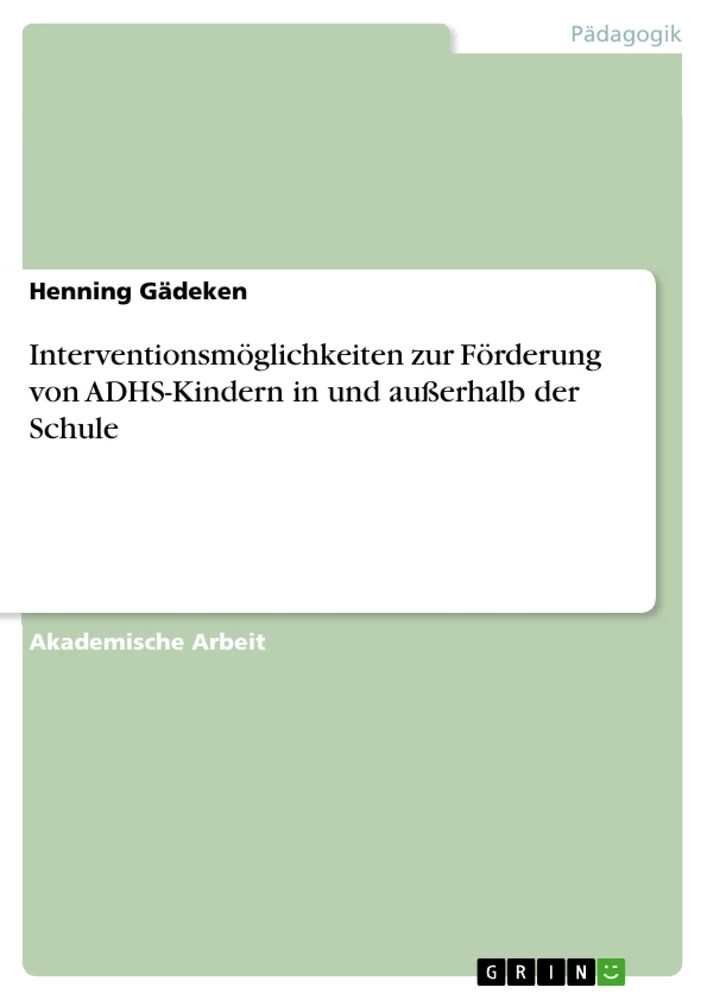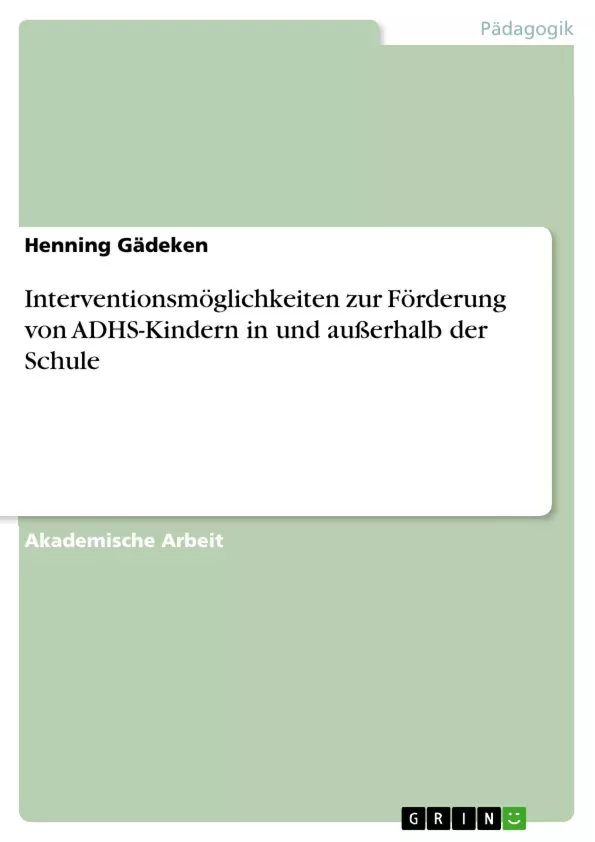Welche Maßnahmen können Eltern und Lehrkräfte ergreifen, um ADHS-Kinder bestmöglich zu unterstützen und zu fördern? Die vorliegende Arbeit behandelt zum einen wirksame Interventionsmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer, um zu einer ganzheitlichen Förderung von aufmerksamkeitsgestörten und hyperaktiven Schülern im Unterricht beizutragen. Zum anderen geht der Autor auf außerschulische Förderkonzepte ein.
Aus dem Inhalt:
- Organisatorische Maßnahmen im Klassenzimmer;
- Klare Strukturen und ritualisierte Abläufe;
- Lernen mit allen Sinnen;
- Strategien zur Selbststeuerung;
- Entschärfung der Hausaufgabensituation;
- Pharmakotherapie und verhaltenstherapeutische Maßnahmen
Inhaltsverzeichnis
- 1. Fördermöglichkeiten für das ADHS-Kind in der Schule
- 1.1 Organisatorische Maßnahmen im Klassenzimmer
- 1.2 Klare Strukturen und ritualisierte Abläufe
- 1.3 Bewegung
- 1.4 Lernen mit allen Sinnen
- 1.5 Strategien zur Selbststeuerung
- 1.5.1 Arbeiten mit Selbstinstruktionen
- 1.5.2 Kognitives Modellieren
- 1.6 Verstärkungsmaßnahmen
- 1.7 Arbeiten mit Förderplänen
- 2. Fördermöglichkeiten für das ADHS-Kind außerhalb der Schule
- 2.1 Entschärfung der Hausaufgabensituation
- 2.2 Pharmakotherapie und verhaltenstherapeutische Maßnahmen
- 2.3 Kooperation mit den Eltern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht wirksame Interventionsmöglichkeiten zur ganzheitlichen Förderung von Schülern mit ADHS, sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Kontext. Der Fokus liegt auf der Unterstützung von Lehrkräften bei der Gestaltung eines förderlichen Lernumfelds.
- Förderung von ADHS-Kindern im Unterricht
- Gestaltung eines strukturierten und klaren Lernumfelds
- Strategien zur Selbststeuerung bei ADHS
- Außerschulische Fördermöglichkeiten für ADHS
- Zusammenarbeit mit Eltern bei der ADHS-Förderung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Fördermöglichkeiten für das ADHS-Kind in der Schule: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Strategien zur Förderung von Kindern mit ADHS im schulischen Kontext. Es betont die Bedeutung eines gut strukturierten Unterrichts mit klaren Regeln und Grenzen, die sowohl dem betroffenen Kind als auch der gesamten Klasse zugutekommen. Konkrete Maßnahmen wie die optimale Platzierung des Kindes im Klassenzimmer, die Beseitigung visueller Ablenkungen, das Aufstellen transparenter Klassenregeln und die Verwendung positiver Verstärkung werden detailliert erläutert. Die Wichtigkeit von visuellem Material, wie Leitkarten oder Checklisten, zur Unterstützung der Arbeitsanweisungen wird hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Schaffung eines Lernumfelds, das die Selbststeuerung des Kindes fördert und Frustrationen vermeidet.
2. Fördermöglichkeiten für das ADHS-Kind außerhalb der Schule: Im zweiten Kapitel werden außerschulische Fördermöglichkeiten für Kinder mit ADHS beleuchtet. Es geht um die Optimierung der Hausaufgabensituation, die Einbeziehung von Pharmakotherapie und verhaltenstherapeutischen Maßnahmen sowie die entscheidende Rolle der Zusammenarbeit mit den Eltern. Das Kapitel verdeutlicht, dass eine erfolgreiche Förderung von ADHS-Kindern ein ganzheitliches Vorgehen erfordert, das sowohl den schulischen als auch den häuslichen Kontext einbezieht und die Kooperation aller Beteiligten voraussetzt.
Schlüsselwörter
ADHS, Aufmerksamkeits-Defizit-/Hyperaktivitäts-Störung, Förderung, Intervention, Schule, Unterricht, Strukturierung, Selbststeuerung, Elternarbeit, Verhaltenstherapie, Pharmakotherapie, Klassenzimmermanagement, Lernumfeld.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Fördermöglichkeiten für Kinder mit ADHS
Was behandelt dieses Dokument?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Fördermöglichkeiten für Kinder mit ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-/Hyperaktivitäts-Störung), sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Bereich. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Fördermöglichkeiten für ADHS-Kinder in der Schule werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt zahlreiche Strategien zur Förderung von Kindern mit ADHS in der Schule. Dies beinhaltet organisatorische Maßnahmen im Klassenzimmer (z.B. optimale Platzierung, Beseitigung visueller Ablenkungen), die Schaffung klarer Strukturen und ritualisierter Abläufe, die Integration von Bewegung in den Unterricht, Lernen mit allen Sinnen, Strategien zur Selbststeuerung (z.B. Selbstinstruktionen, kognitives Modellieren), Verstärkungsmaßnahmen und die Arbeit mit Förderplänen.
Welche außerschulischen Fördermöglichkeiten werden angesprochen?
Das Dokument beleuchtet außerschulische Fördermöglichkeiten wie die Optimierung der Hausaufgabensituation, die Einbeziehung von Pharmakotherapie und verhaltenstherapeutischen Maßnahmen sowie die wichtige Zusammenarbeit mit den Eltern. Es betont den ganzheitlichen Ansatz, der sowohl den schulischen als auch den häuslichen Kontext berücksichtigt.
Welche Zielsetzung verfolgt dieses Dokument?
Die Arbeit untersucht wirksame Interventionsmöglichkeiten zur ganzheitlichen Förderung von Schülern mit ADHS. Der Fokus liegt auf der Unterstützung von Lehrkräften bei der Gestaltung eines förderlichen Lernumfelds.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Schwerpunkte liegen auf der Förderung von ADHS-Kindern im Unterricht, der Gestaltung eines strukturierten Lernumfelds, Strategien zur Selbststeuerung bei ADHS, außerschulischen Fördermöglichkeiten und der Zusammenarbeit mit den Eltern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: ADHS, Aufmerksamkeits-Defizit-/Hyperaktivitäts-Störung, Förderung, Intervention, Schule, Unterricht, Strukturierung, Selbststeuerung, Elternarbeit, Verhaltenstherapie, Pharmakotherapie, Klassenzimmermanagement und Lernumfeld.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in zwei Hauptkapitel gegliedert: Kapitel 1 behandelt Fördermöglichkeiten in der Schule, Kapitel 2 die außerschulischen Fördermöglichkeiten. Jedes Kapitel wird detailliert zusammengefasst.
- Quote paper
- Henning Gädeken (Author), 2003, Interventionsmöglichkeiten zur Förderung von ADHS-Kindern in und außerhalb der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322028