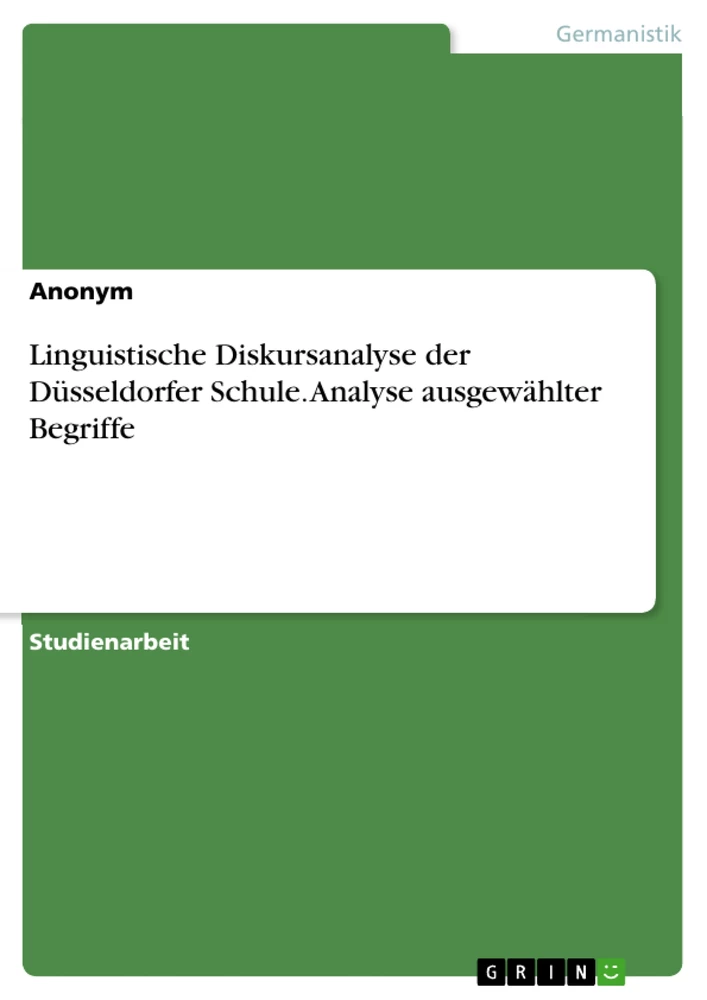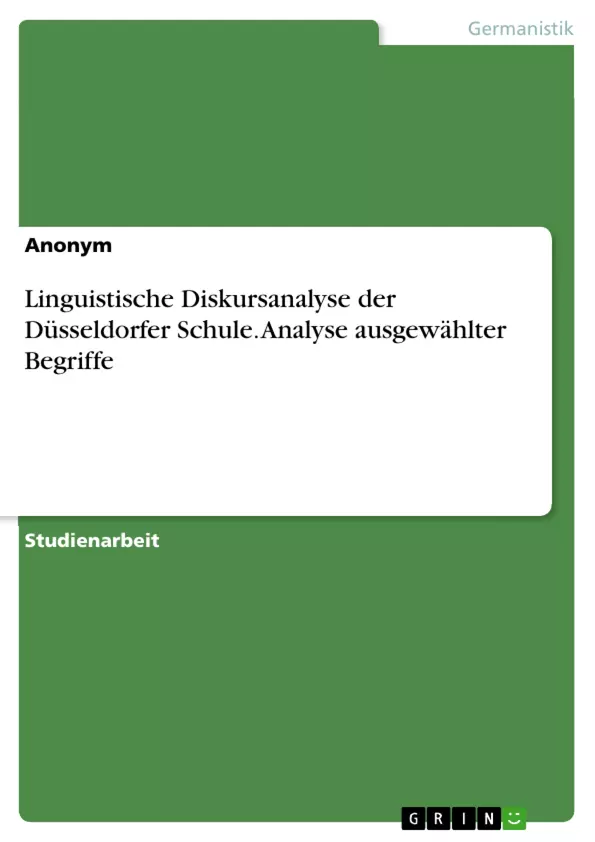In der 25 Seitigen Hausarbeit wird die Düsseldorfer Schule vorgestellt und diese anhand verschiedener Begriffe angewandt.
Die Düsseldorfer Schule oder der Düsseldorfer Ansatz ist eine Forschungsrichtung in der Diskursanalyse. Sie wurde an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf von Martin Wengeler und Georg Stötzl gegründet. Das Forschungsfeld richtet sich an sprachbezogene Probleme, welche die Gesellschaft und die Öffentlichkeit als problematisch oder konfliktträchtig empfindet. Als Beispiele wären hier die Atomenergie-Diskussion und die Rüstungsdebatten zu nennen.
Ein weiteres Ziel ist die Aufklärung, was ein Begriff wie Umweltschutz oder Gastarbeiter wirklich aussagt. Die Entwicklung der Bedeutung und auch bestimmte Perspektiven auf Gegenstände werden hinterfragt. Somit setzt sich die Düsseldorfer Schule als Ziel, die jüngere Vergangenheit sprachlich kommunikativ aufzuklären und ein relevanter Zweig der Linguistik für die Gesellschaft und die Öffentlichkeit zu werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Entwicklung der „Düsseldorfer Schule”
- Arbeitsmethoden der Düsseldorfer Schule
- Beispiel: Diskurshistorisches Wörterbuch
- Das Vokabular der Atomenergiedebatte
- Beeinflussung des Vokabulars durch die Populärliteratur
- Die Entwicklung des Vokabulars aus der Fachsprache
- Das Wort Atom
- Entstehung des Wortes Reaktor
- Vokabular des Atomgegner und das der Atombefürworter
- Diskurs anhand der Wörter Restrisiko und GAU
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Düsseldorfer Schule, eine Forschungsrichtung in der Diskursanalyse, konzentriert sich auf die sprachliche Analyse von gesellschaftlichen und öffentlichen Problemen. Die Zielsetzung liegt darin, die jüngere Vergangenheit sprachlich kommunikativ aufzuarbeiten und die Bedeutung von Begriffen in der Gesellschaft und Öffentlichkeit zu untersuchen.
- Sprachliche Analyse von gesellschaftlichen Problemen und Konflikten
- Untersuchung des Wandels von Begriffen im Zeitverlauf
- Rekonstruktion der sprachlichen Geschichte in Bezug auf gesellschaftliche Entwicklungen
- Analyse von Sprachgebrauch und Sprachstrategien in öffentlichen Diskussionen
- Bedeutung von Diskursen für die öffentliche Meinungsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Diskursbegriff und die Düsseldorfer Schule vor, die sich mit sprachlichen Problemen und Konflikten in der Gesellschaft auseinandersetzt.
- Die Entwicklung der „Düsseldorfer Schule”: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der Düsseldorfer Schule, ihre Forschungsmethoden und die Entwicklung des Diskursbegriffs in der Linguistik.
- Beispiel: Diskurshistorisches Wörterbuch: Das Kapitel zeigt ein Beispiel für die Anwendung der Düsseldorfer Methoden anhand eines Diskurshistorischen Wörterbuchs.
- Das Vokabular der Atomenergiedebatte: Dieses Kapitel analysiert das Vokabular der Atomenergiedebatte und seine Entwicklung im Kontext von Populärliteratur und Fachsprache.
- Das Wort Atom: Das Kapitel untersucht die Entstehung und Entwicklung des Wortes Atom in der öffentlichen Diskussion.
- Entstehung des Wortes Reaktor: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Wortes Reaktor und seinen sprachlichen Kontext.
- Vokabular des Atomgegner und das der Atombefürworter: Das Kapitel analysiert die unterschiedlichen Vokabulare von Atomgegnern und Atombefürwortern.
- Diskurs anhand der Wörter Restrisiko und GAU: Dieses Kapitel untersucht den Diskurs rund um die Wörter Restrisiko und GAU in der Atomenergiedebatte.
Schlüsselwörter
Die Düsseldorfer Schule befasst sich mit zentralen Themen und Begriffen der Diskursanalyse, wie Sprachgeschichte, Diskursbegriff, Sprachwandel, Textkorpora, öffentliche Diskussionen, Sprachstrategien, und Vokabularanalysen. Die Forschung liegt im Bereich der Linguistik und beschäftigt sich mit der Analyse von gesellschaftlichen Problemen und Konflikten unter besonderer Berücksichtigung der sprachlichen Dimension.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Düsseldorfer Schule der Diskursanalyse?
Die Düsseldorfer Schule ist eine linguistische Forschungsrichtung, die von Martin Wengeler und Georg Stötzl begründet wurde. Sie untersucht sprachbezogene Probleme in gesellschaftlich kontroversen Themenfeldern.
Welches Ziel verfolgt dieser Forschungsansatz?
Ziel ist die sprachlich-kommunikative Aufklärung der jüngeren Vergangenheit. Es wird hinterfragt, wie Begriffe (z. B. "Umweltschutz") entstehen und wie sie die öffentliche Meinung beeinflussen.
Welche Rolle spielen die Begriffe "Restrisiko" und "GAU" in der Arbeit?
Diese Begriffe werden als Beispiele für den Diskurs in der Atomenergiedebatte analysiert, um zu zeigen, wie Sprache zur Risikobewertung und politischen Positionierung genutzt wird.
Wie unterscheiden sich die Vokabulare von Atomgegnern und -befürwortern?
Die Arbeit zeigt auf, dass beide Seiten unterschiedliche Begriffe nutzen oder dieselben Wörter unterschiedlich konnotieren, um ihre jeweiligen Interessen und Sichtweisen sprachlich zu untermauern.
Was ist ein diskurshistorisches Wörterbuch?
Es ist ein Instrument der Düsseldorfer Schule, um den Wandel und die Verwendung von politisch-sozialen Begriffen über einen längeren Zeitraum hinweg lexikalisch zu dokumentieren und zu analysieren.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2011, Linguistische Diskursanalyse der Düsseldorfer Schule. Analyse ausgewählter Begriffe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322414