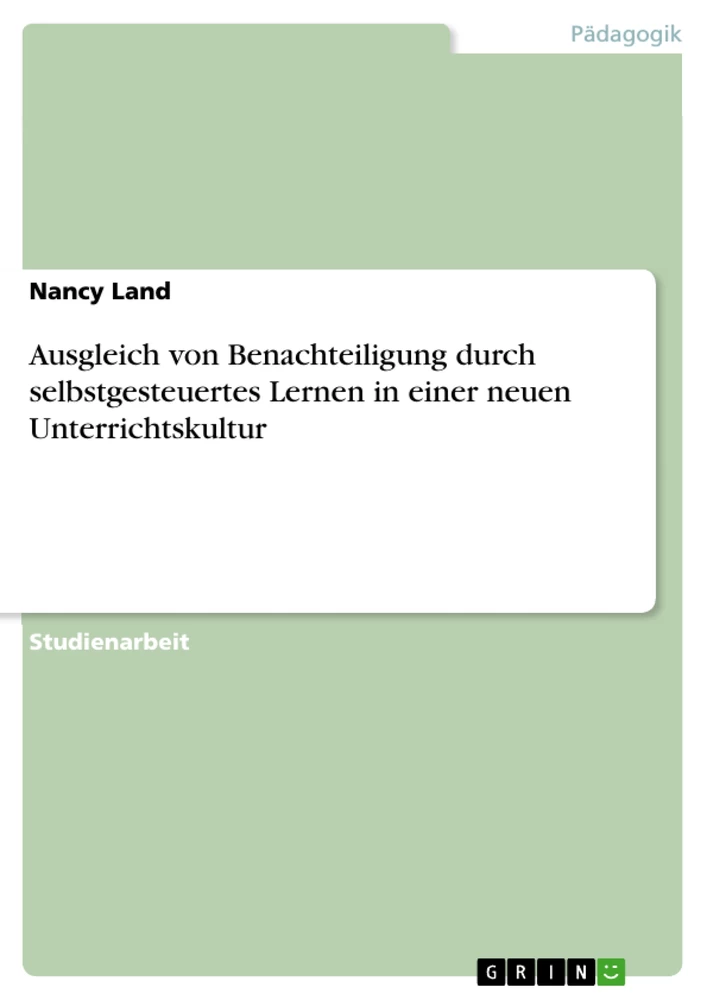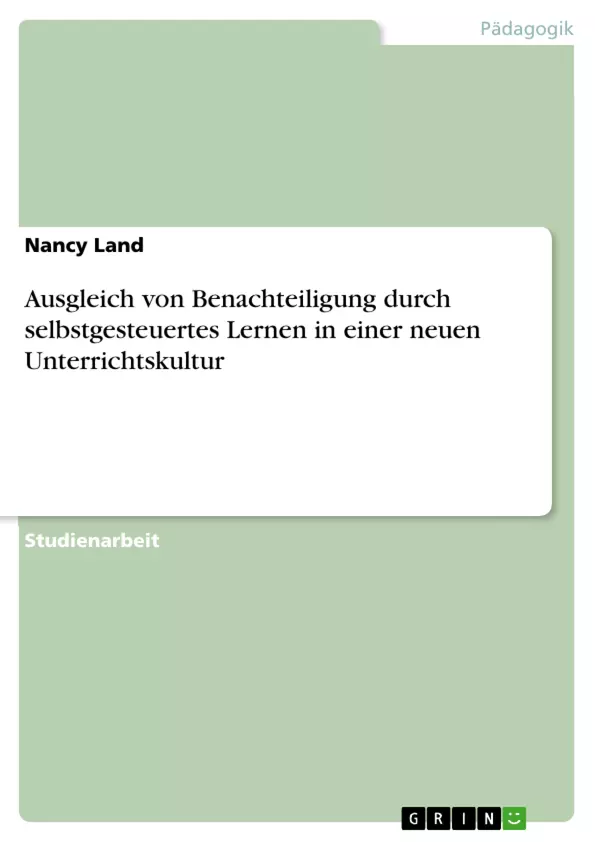Welche Möglichkeiten bietet das selbstgesteuerte Lernen für den Ausgleich von Benachteiligung?
Abgesehen von schweren körperlichen oder geistigen Schäden eines Menschen „habe jeder in der Gesellschaft prinzipiell die gleiche Chance, die Leistungen zu erbringen, und die sozialen Positionen, die einzunehmen er befähigt und gewillt ist, auch tatsächlich vorzuweisen bzw. zu erreichen“ (Klafki 1996, S. 221). Mit diesen Worten formulierte Klafki eine damals verbreitete Auffassung und fügte hinzu, dass diese zugesicherte Chancengleichheit keineswegs Teil der Gesellschaft sei. Tatsächlich hätte man mit einer schichtspezifischen Ungleichheit der Bildungs-, Berufs- und Sozialchancen zu kämpfen.
Diese Benachteiligung scheint einen Widerspruch zu den Menschenrechtsgesetzen zu bilden, welche gleiche Chancen auf Bildung vorschreiben. Diese Rechte sollen „ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen und sonstigen A-schauung, der nationalen und sozialen Herkunft […] ausgeübt werden“ (Deutsches Institut für Menschenrechte 2005, S. 247). Eine Bildungsgerechtigkeit sei in Deutschland jedoch nicht gewährleistet.
Ein weiterer Aspekt ist, „dass es gut drei Viertel der Kinder und Jugendlichen nicht in den Sinn kommt, dass Lernen zu den positiven Erfahrungsmöglichkeiten in der Schule gehören könnte“ (Zinnecker u.a. 2003, 43). Dies zeigt, dass das Lernen in der Schule einer Reform bedarf. Als einen Bestandteil einer neuen Unterrichtskultur möchte ich deshalb auf das selbstgesteuerte Lernen eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Benachteiligung und benachteiligte Jugendliche
- 3. Selbstgesteuertes Lernen in einer neuen Unterrichtskultur
- 4. Fazit
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema der Benachteiligung von Jugendlichen in Bildung und Beruf und untersucht, wie selbstgesteuertes Lernen in einer neuen Unterrichtskultur als Instrument zur Überwindung dieser Benachteiligung dienen kann. Die Arbeit analysiert die Ursachen und Auswirkungen von Benachteiligung und beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen des selbstgesteuerten Lernens in diesem Kontext.
- Definition und Ursachen von Benachteiligung
- Bedeutung und Konzepte des selbstgesteuerten Lernens
- Potenziale des selbstgesteuerten Lernens für benachteiligte Jugendliche
- Herausforderungen und Grenzen des selbstgesteuerten Lernens
- Entwicklung einer neuen Unterrichtskultur, die selbstgesteuertes Lernen fördert
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt den aktuellen Stand der Debatte über Chancengleichheit und Benachteiligung in der Bildung dar und führt in die Thematik des selbstgesteuerten Lernens als mögliches Mittel zum Ausgleich von Benachteiligung ein.
2. Benachteiligung und benachteiligte Jugendliche
Dieses Kapitel definiert den Begriff der Benachteiligung und analysiert die Ursachen für Benachteiligung von Jugendlichen. Es werden verschiedene Ebenen der Benachteiligung – individuelle, sozial-ökonomische und strukturelle – betrachtet und die jeweiligen Einflussfaktoren erläutert.
3. Selbstgesteuertes Lernen in einer neuen Unterrichtskultur
Dieses Kapitel beleuchtet das Konzept des selbstgesteuerten Lernens und seine Bedeutung für die Bildung von Jugendlichen. Es werden verschiedene Modelle und Ansätze des selbstgesteuerten Lernens vorgestellt und deren Potenziale zur Überwindung von Benachteiligung diskutiert.
Schlüsselwörter
Benachteiligung, selbstgesteuertes Lernen, Unterrichtskultur, Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit, Risikogruppe, Lernvoraussetzungen, Bildungsbiografie, soziale Herkunft, Bildungslandschaft, Arbeitsmarktstruktur, pädagogisches Personal, institutionelle Barrieren.
Häufig gestellte Fragen
Kann selbstgesteuertes Lernen Bildungsbenachteiligung ausgleichen?
Die Arbeit untersucht, ob diese neue Unterrichtskultur Schülern hilft, individuelle und soziale Benachteiligungen durch eigenverantwortliches Lernen zu überwinden.
Was sind die Ursachen für Bildungsungleichheit in Deutschland?
Häufige Ursachen sind die soziale Herkunft, ökonomische Faktoren sowie strukturelle Barrieren im Schulsystem, die gegen die Menschenrechte auf Bildung verstoßen.
Was bedeutet „neue Unterrichtskultur“?
Es beschreibt eine Reform des Lernens, weg von reinem Frontalunterricht hin zu Methoden, die die individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler in den Fokus rücken.
Warum ist Bildungsgerechtigkeit in Deutschland ein Problem?
Studien zeigen, dass der Erfolg in der Schule in Deutschland stärker als in anderen Ländern von der sozialen Schicht der Eltern abhängt.
Welche Rolle spielt das pädagogische Personal dabei?
Lehrer müssen in einer neuen Unterrichtskultur eher als Lernbegleiter fungieren, um benachteiligte Jugendliche gezielt beim selbstgesteuerten Lernen zu unterstützen.
- Citation du texte
- Nancy Land (Auteur), 2013, Ausgleich von Benachteiligung durch selbstgesteuertes Lernen in einer neuen Unterrichtskultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322907