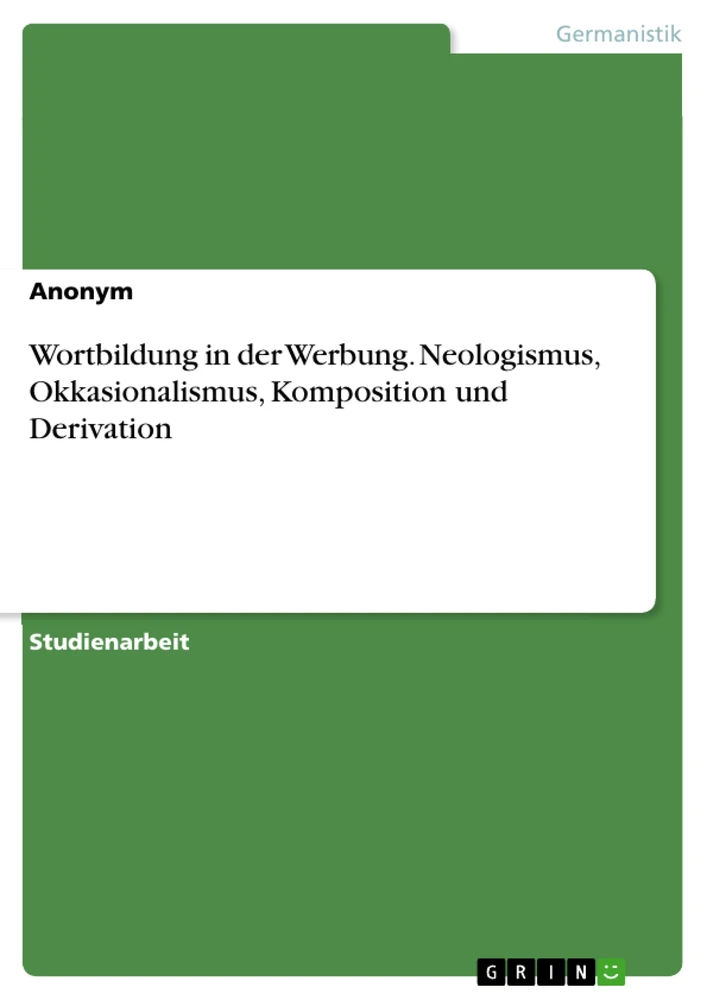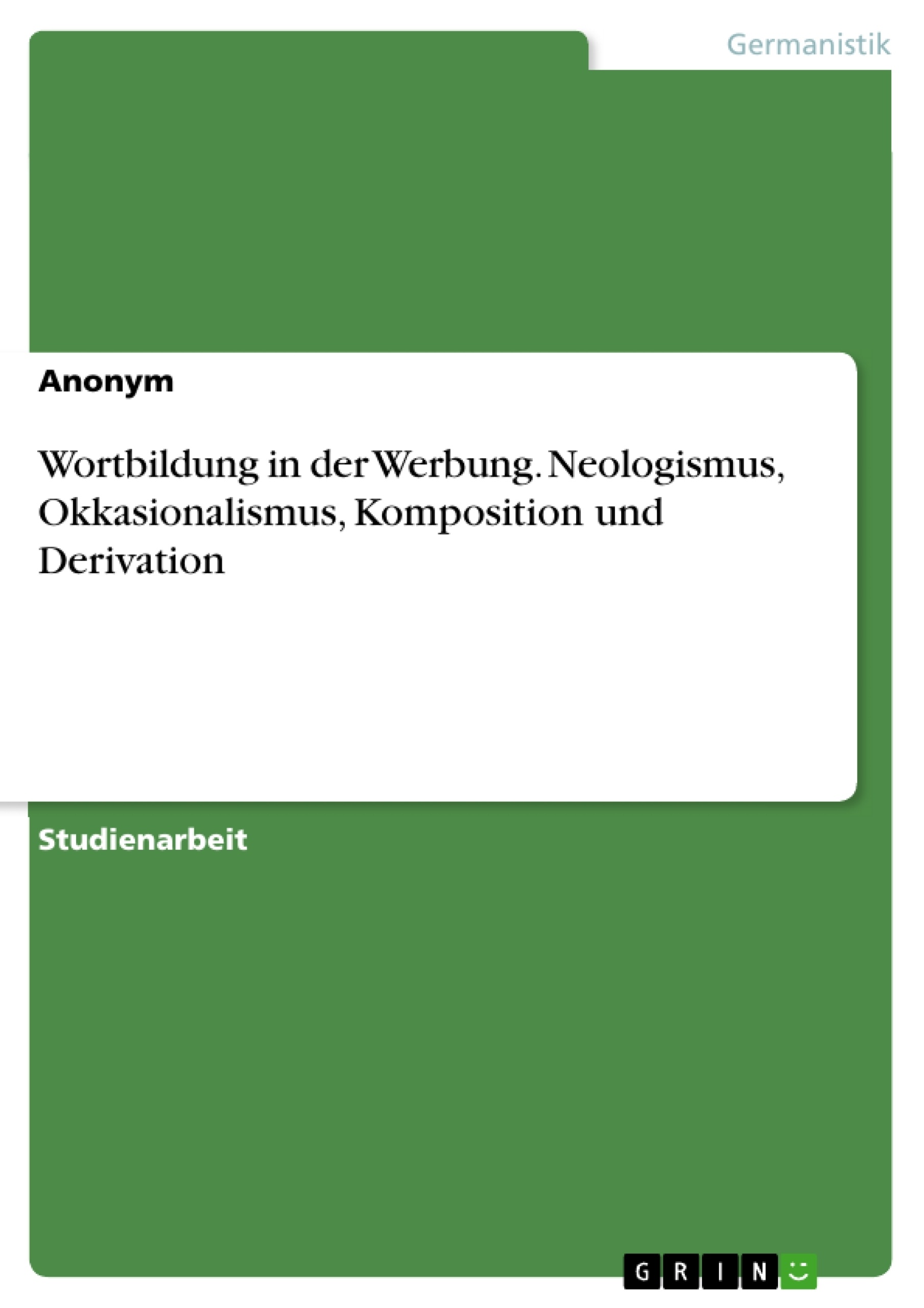Diese wissenschaftliche Arbeit wird sich mit dem Thema Wortbildung in der Werbung beschäftigen und verschiedene Wortschöpfungen genauer untersuchen. Dabei wird zu Beginn definiert, was Werbung allgemein ist. Daraufhin wird der Blick auf die Wortbildungen in der Werbung gerichtet und ein Vergleich zwischen Neologismus und Okkasionalismus, sowie zwischen Komposition und Derivation erstellt und erklärt, warum es jeweils quantitative Unterschiede zwischen ihnen gibt.
Momentan ist der Begriff des Medienzeitalters in aller Munde. Informationen, Suggestionen und Manipulationen von Seiten der Medien sind omnipräsent. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang das Fachgebiet der Werbung. Das Ziel von Werbung ist, möglichen Konsumenten ein Produkt näher zu bringen und bestenfalls den Kauf dieses Produkts zu erreichen. Dabei werden jegliche Tricks und Kniffe der Werbeproduzenten benutzt um das gewünschte Ziel, den Produktverkauf, zu realisieren. Sprache stellt dabei ein essentielles Werkzeug dar. Mithilfe von Sprache, insbesondere durch außergewöhnliche Wortschöpfungen, versprechen sich Werbeproduzenten einen Wiedererkennungsimpuls bei Konsumenten zu erreichen, der eventuell beim nächsten Einkauf anschlägt und das Produkt bestenfalls gekauft wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Definition von Werbung
- 2. Wortbildung in der Werbung
- 2.1 Neologismus versus Okkasionalismus
- 2.2 Komposition versus Derivation
- 3. Fazit
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Wortbildung in der Werbung und analysiert die verwendeten Wortschöpfungen. Das Hauptziel ist es, die sprachlichen Strategien der Werbebranche zu beleuchten und den Unterschied zwischen Neologismen und Okkasionalismen sowie Kompositionen und Derivation in der Werbung zu erklären. Die Arbeit betrachtet dabei die quantitative Verteilung der verschiedenen Wortbildungsarten.
- Definition von Werbung und deren ambivalente Natur als Informations- und Manipulationsmedium
- Analyse der Wortbildungsverfahren (Neologismen, Okkasionalismen, Komposition, Derivation) in der Werbung
- Vergleich der quantitativen Unterschiede verschiedener Wortbildungsarten in Werbetexten
- Die Rolle der Sprache als Werkzeug zur Beeinflussung des Konsumentenverhaltens
- Der Vertrauenskonflikt zwischen Werbesender und Werbeempfänger
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Wortbildung in der Werbung ein und betont die omnipräsente Rolle der Werbung im Medienzeitalter. Sie hebt die Bedeutung der Sprache, insbesondere außergewöhnlicher Wortschöpfungen, für den Werbeerfolg hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der eine Definition von Werbung, eine Analyse der Wortbildungsverfahren und einen Vergleich von Neologismen/Okkassionalismus sowie Komposition/Derivation umfasst. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der sprachlichen Mittel, die Werbeproduzenten einsetzen, um den Konsumenten zum Kauf zu bewegen.
1. Definition von Werbung: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Definitionen von Werbung aus der Forschung, die die Ambivalenz des Begriffs aufzeigen: Werbung als geplante, öffentliche Nachrichtenübermittlung zur Beeinflussung des Urteilens und Handelns, als bewußte Beeinflussung von Menschen zu wirtschaftlichen, politischen oder kulturellen Zwecken, und als Beeinflussung verhaltensrelevanter Einstellungen. Die etymologische Herleitung des Wortes „werben“ wird ebenfalls erläutert. Der Fokus liegt auf der Beeinflussung des Konsumenten und der damit verbundenen Frage nach der Informations- und Manipulationspflicht von Werbung. Die unterschiedlichen Interpretationen des Begriffs „Information“ werden diskutiert, wobei der scheinbare Widerspruch zwischen Informations- und Manipulationsaspekt herausgestellt wird.
2. Wortbildung in der Werbung: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Wortbildungsverfahren in der Werbung. Es beinhaltet einen detaillierten Vergleich zwischen Neologismen und Okkasionalismen, sowie Komposition und Derivation, wobei der Fokus auf den quantitativen Unterschieden dieser Verfahren liegt. Es wird analysiert, welche Verfahren in der Werbung bevorzugt eingesetzt werden und warum. Dieser Teil der Arbeit beleuchtet die sprachlichen Strategien, die zur Erzeugung von Wiedererkennungseffekten und zur Beeinflussung des Konsumenten eingesetzt werden. Die Analyse der Wortbildungsmethoden bildet den Kern der Arbeit und erklärt die konkreten sprachlichen Mechanismen der Werbewirkung.
Schlüsselwörter
Werbung, Wortbildung, Neologismus, Okkasionalismus, Komposition, Derivation, Konsument, Sprachwissenschaft, Medien, Manipulation, Information, Beeinflussung, Werbewirkung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wortbildung in der Werbung
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Wortbildung in der Werbung und analysiert die verwendeten Wortschöpfungen. Sie beleuchtet die sprachlichen Strategien der Werbebranche und erklärt den Unterschied zwischen Neologismen und Okkasionalismen sowie Kompositionen und Derivation in der Werbung. Ein Schwerpunkt liegt auf der quantitativen Verteilung der verschiedenen Wortbildungsarten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition von Werbung und deren ambivalente Natur als Informations- und Manipulationsmedium; Analyse der Wortbildungsverfahren (Neologismen, Okkasionalismen, Komposition, Derivation) in der Werbung; Vergleich der quantitativen Unterschiede verschiedener Wortbildungsarten in Werbetexten; Die Rolle der Sprache als Werkzeug zur Beeinflussung des Konsumentenverhaltens; Der Vertrauenskonflikt zwischen Werbesender und Werbeempfänger.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Werbung, ein Kapitel zur Wortbildung in der Werbung (mit Unterkapiteln zu Neologismus/Okkassionalismus und Komposition/Derivation) und ein Fazit sowie ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung führt in das Thema ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Das Kapitel zur Definition von Werbung präsentiert verschiedene Definitionen und diskutiert die Ambivalenz des Begriffs. Das Hauptkapitel analysiert detailliert die verschiedenen Wortbildungsverfahren in der Werbung und deren quantitative Unterschiede.
Was sind die Kernaussagen der Kapitelzusammenfassungen?
Die Einleitung betont die Bedeutung der Sprache für den Werbeerfolg. Das Kapitel zur Definition von Werbung beleuchtet die Ambivalenz von Werbung als Informations- und Manipulationsmedium. Das Kapitel zur Wortbildung in der Werbung analysiert die verschiedenen Verfahren (Neologismen, Okkasionalismen, Komposition, Derivation) und deren Einsatz in der Werbung, mit Fokus auf die quantitative Verteilung und die sprachlichen Strategien zur Beeinflussung des Konsumenten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Werbung, Wortbildung, Neologismus, Okkasionalismus, Komposition, Derivation, Konsument, Sprachwissenschaft, Medien, Manipulation, Information, Beeinflussung, Werbewirkung.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, die sprachlichen Strategien der Werbebranche zu beleuchten und den Unterschied zwischen Neologismen und Okkasionalismen sowie Kompositionen und Derivation in der Werbung zu erklären. Die Arbeit untersucht, wie Sprache eingesetzt wird, um Konsumenten zum Kauf zu bewegen.
Wie wird die quantitative Verteilung der Wortbildungsarten untersucht?
Die Arbeit analysiert die quantitative Verteilung der verschiedenen Wortbildungsarten in Werbetexten, um zu zeigen, welche Verfahren in der Werbung bevorzugt eingesetzt werden und warum. Der genaue methodische Ansatz wird im Hauptteil der Arbeit detailliert beschrieben.
Welche Rolle spielt der Vertrauenskonflikt zwischen Werbesender und -empfänger?
Die Arbeit thematisiert den Vertrauenskonflikt zwischen Werbesender und -empfänger im Kontext der manipulativen und informativen Aspekte von Werbung. Dieser Konflikt wird im Zusammenhang mit der Definition von Werbung und der Analyse der sprachlichen Strategien diskutiert.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Wortbildung in der Werbung. Neologismus, Okkasionalismus, Komposition und Derivation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323157