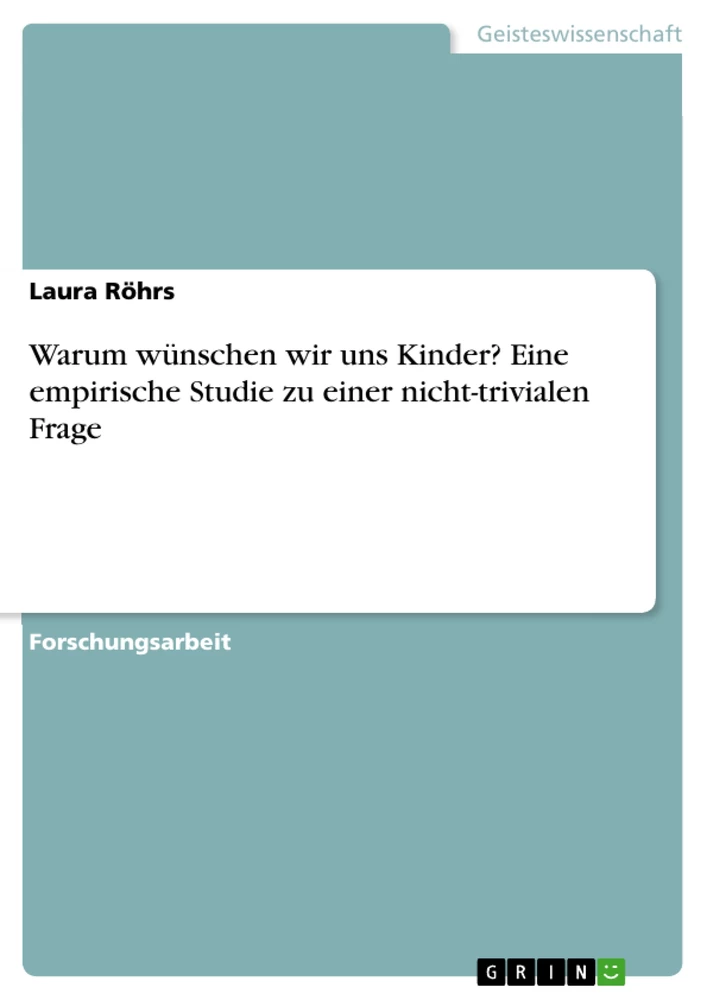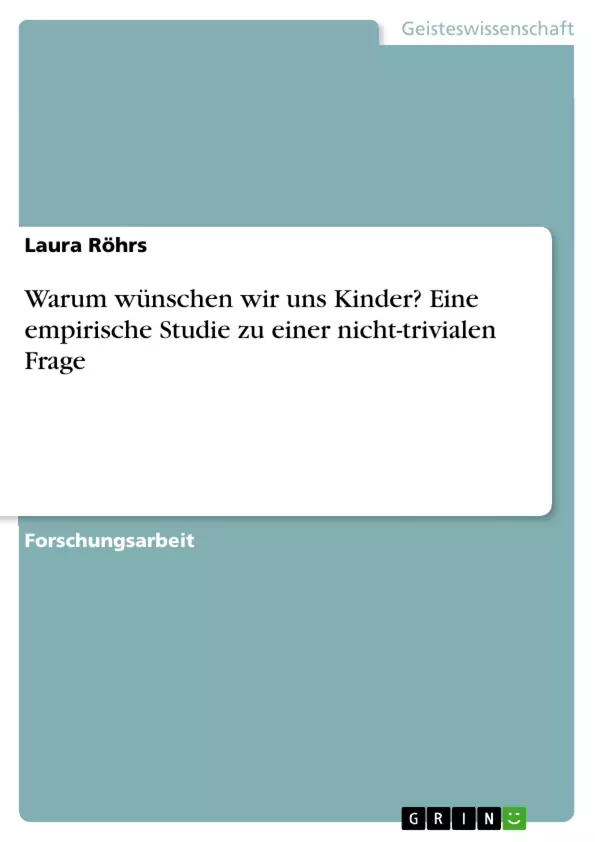In Deutschland geht ein alarmierender Geburtenrückgang durch die Medien und der demographische Wandel wirft seine überalternden Schatten voraus; und das obwohl Kinder in Deutschland immer noch als Inbegriff von Familienglück und Freude gelten. Es kann also nicht davon gesprochen werden, dass die Deutschen grundsätzlich keine Kinder mehr bekommen möchten.
Um die Fragen rund um den Kinderwunsch beantworten zu können, soll anhand der vorliegenden Studie exploriert werden, wie groß der Einfluss bestimmter, ausgewählter Elemente auf die Bereitschaft zur Elternschaft ist. Den theoretischen Rahmen dazu bilden sowohl ökonomische, als auch sozialpsychologische Ansätze, die, aufbauend auf einer historischen Bestimmung der Bedeutung von Kindern und Familien für die Gesellschaft, auf ihre inhaltliche Passung hin untersucht werden (Kapitel 2.2) und als theoretisches Fundament der Analyse dienen (Kapitel 2.3).
Die auf diese Weise strukturierten Daten werden anschließend statistisch aufbereitet (Kapitel 3) und die Ergebnisse dargestellt (Kapitel 4). Anschließend werden die getroffenen Annahmen basierend auf den empirisch gewonnen Daten diskutiert und ihre Relevanz für das Forschungsvorhaben herausgestellt. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einem Ausblick auf relevante weitere Untersuchungsgegenstände.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Aktueller Forschungsstand
- Begriffliche und theoretische Grundlagen
- Kinderwunsch aus einer historischen Perspektive
- Ökonomischer Ansatz
- Value of Children-Ansatz
- Theoretische Annahmen über die Einflussfaktoren
- Zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Zum Frauenbild
- Zur Familientypologie
- Methode
- Datensatzbeschreibung
- Operationalisierung der Kinderorientierung
- Operationalisierung der Indikatoren
- Vereinbarkeit Familie und Beruf
- Frauenbild
- Familientypologie
- Statistische Verfahren
- Ergebnisse
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, welche Faktoren die Bereitschaft von Menschen in Deutschland beeinflussen, Kinder zu bekommen. Sie untersucht den Einfluss von ökonomischen, sozialpsychologischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auf den Kinderwunsch. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Entscheidungsfindung im Hinblick auf Elternschaft zu gewinnen und Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne Kinderwunsch zu analysieren.
- Der Einfluss von ökonomischen Faktoren auf den Kinderwunsch
- Die Rolle von Werten und Idealen in der Entscheidungsfindung
- Die Bedeutung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Das Frauenbild und seine Auswirkungen auf die Elternschaftsentscheidung
- Die Bedeutung von Familientypologie und Lebensentwürfen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den aktuellen Stand der Diskussion dar. Sie verdeutlicht die gesellschaftliche Relevanz des Themas und die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse.
Der theoretische Rahmen beleuchtet verschiedene Ansätze, die den Kinderwunsch erklären können, darunter ökonomische, sozialpsychologische und historische Perspektiven. Er analysiert die Bedeutung von Kindern für die Gesellschaft und die individuellen Entscheidungsfaktoren.
Das Kapitel "Methode" beschreibt die Datenerhebung und -analyse, die in der vorliegenden Studie eingesetzt wurden. Es erläutert die Operationalisierung der zentralen Variablen und die statistischen Verfahren, die zur Analyse der Daten verwendet wurden.
Schlüsselwörter
Kinderwunsch, Fertilität, Familiensoziologie, Ökonomische Ansätze, Wertwandel, Präferenz-Theorie, Familienpolitik, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Frauenbild, Familientypologie.
Häufig gestellte Fragen
Warum sinken die Geburtenraten in Deutschland trotz des Familienideals?
Die Studie untersucht, wie ökonomische und sozialpsychologische Faktoren die Entscheidung gegen oder für Kinder trotz des hohen Stellenwerts von Familienglück beeinflussen.
Was ist der "Value of Children"-Ansatz?
Dieser sozialpsychologische Ansatz analysiert den subjektiven Wert, den Kinder für Eltern haben – von emotionaler Erfüllung bis hin zu ökonomischen Überlegungen.
Welche Rolle spielt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
Sie ist einer der zentralen Einflussfaktoren. Die Studie prüft, wie stark die beruflichen Rahmenbedingungen die Bereitschaft zur Elternschaft einschränken.
Wie beeinflusst das Frauenbild den Kinderwunsch?
Die Arbeit untersucht, inwieweit moderne oder traditionelle Rollenbilder von Frauen Auswirkungen auf die Entscheidung für ein Kind haben.
Was versteht man unter dem ökonomischen Ansatz beim Kinderwunsch?
Hierbei werden Kinder als "Konsumgüter" oder Investition betrachtet, wobei Kosten (Opportunitätskosten) und Nutzen der Elternschaft gegeneinander abgewogen werden.
- Citar trabajo
- Laura Röhrs (Autor), 2014, Warum wünschen wir uns Kinder? Eine empirische Studie zu einer nicht-trivialen Frage, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323172