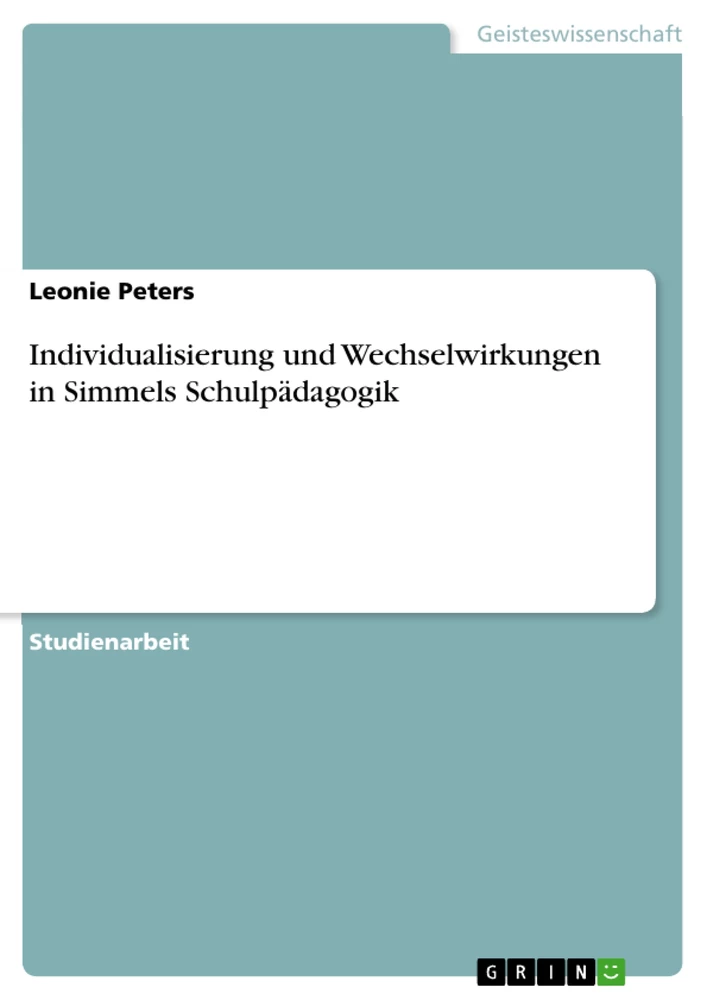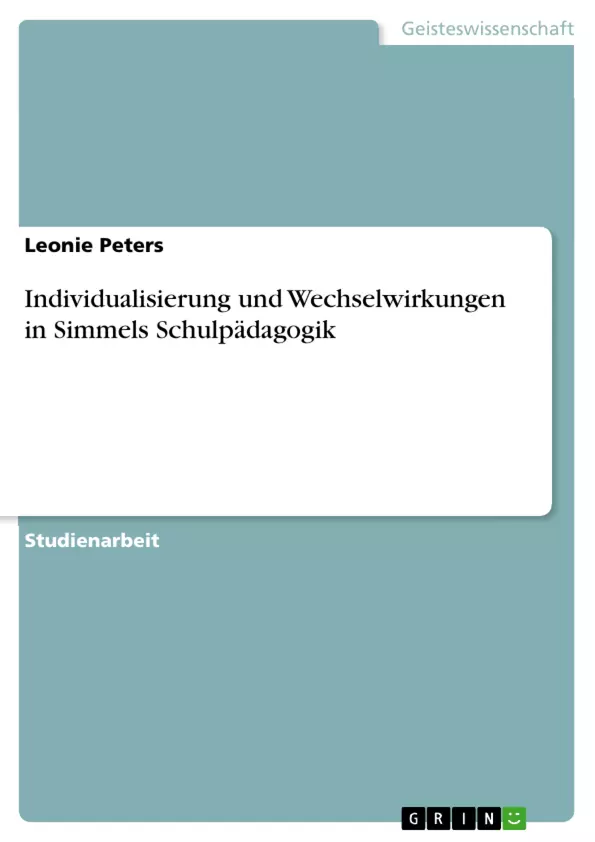Simmels Ausführungen zur Schulpädagogik wurden posthum veröffentlicht. Die vorliegende Arbeit sucht nach den für Simmels soziologische Werke entscheidenden Begriffen von Individualisierung und Wechselwirkungen und untersucht diese in Bezug auf ihre Bedeutung für die Pädagogik sowie in Bezug auf mögliche Widersprüche innerhalb von Simmels Werk.
Begonnen wird mit Simmels Ausführungen zur Notwendigkeit des Anknüpfens an den individuellen Hintergrund des Schülers und daraus folgend seiner Ablehnung des schichtübergreifenden Unterrichts. Desweiteren sollen die sozialen Kreise in und um die Schule, sowie Simmels Ausführungen in Bezug auf die Individualität des Kindes im Unterschied zum Erwachsenen besprochen werden. Am Ende der Ausarbeitung soll die Frage beantwortet werden, welcher Gewinn aus einer konzentrierten Betrachtung der Funktion von Wechselwirkungen in der Schulpädagogik zu ziehen ist und auch wie konsequent sich Simmels besondere Art des Denkens und der Betrachtung der modernen Gesellschaft in diesem Werk widerspiegelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Simmel und Wechselwirkungen
- Individuen als Schnittpunkte sozialer Kreise / Individualisierung
- Vergleiche und Ansätze in Simmels Schulpädagogik
- Ausgehend vom Hintergrund des Schülers
- Die Ablehnung heterogener Klassen
- Soziale Kreise in der Schule
- Das Kind im Unterschied zum Erwachsenen
- Fazit: Individualisierung und Wechselwirkungen in Simmels Schulpädagogik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit Georg Simmels Ausführungen zur Schulpädagogik, die in seinen letzten Werken und postum veröffentlicht wurden. Die Arbeit analysiert Simmels Gedanken zur Individualität und deren Wechselwirkungen im Kontext der Schulpädagogik. Sie untersucht, wie Simmel die Rolle des Schülers als Individuum und aktives Wesen im Bildungsprozess begreift und wie er die Bedeutung von sozialen Kreisen und Wechselwirkungen im schulischen Umfeld betont.
- Die Bedeutung von Individualität in Simmels Schulpädagogik
- Die Rolle von Wechselwirkungen in Simmels soziologischer Theorie
- Simmels Ansätze zur Gestaltung des Unterrichts und der Schule
- Die Bedeutung von sozialen Kreisen im schulischen Kontext
- Der Vergleich zwischen dem Kind und dem Erwachsenen in Simmels Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Hausarbeit dar und beleuchtet die Bedeutung von Simmels Schulpädagogik. Es wird auf die Zeitlosigkeit seiner Ausführungen und deren Relevanz für die heutige pädagogische Praxis hingewiesen.
Das Kapitel „Simmel und Wechselwirkungen“ beschäftigt sich mit Simmels soziologischer Theorie und seiner Auffassung von Individuen als Schnittpunkten sozialer Kreise. Es wird erläutert, wie Simmel Individualität durch die Interaktion mit verschiedenen sozialen Kreisen definiert.
Das Kapitel „Vergleiche und Ansätze in Simmels Schulpädagogik“ analysiert Simmels Ansätze zur Schulpädagogik und untersucht seine Gedanken zur Notwendigkeit des Anknüpfens an den individuellen Hintergrund des Schülers, zur Ablehnung des schichtübergreifenden Unterrichts und zur Bedeutung sozialer Kreise im schulischen Kontext. Es wird auch Simmels Sicht auf die Unterschiede zwischen Kind und Erwachsenen in Bezug auf Bildung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Schulpädagogik, Georg Simmel, Individualisierung, Wechselwirkungen, Soziale Kreise, Bildungsprozess, Schüler, Individuum, Unterricht, Moderne, Philosophie des Geldes, Objektive Kultur, Subjektive Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Individualisierung in Simmels Pädagogik?
Simmel betont die Notwendigkeit, an den individuellen Hintergrund des Schülers anzuknüpfen, da er das Individuum als Schnittpunkt verschiedener sozialer Kreise begreift.
Warum lehnte Georg Simmel heterogene Klassen ab?
Simmel sprach sich gegen schichtübergreifenden Unterricht aus, da er davon ausging, dass Bildungsprozesse stark vom spezifischen sozialen Hintergrund und den individuellen Voraussetzungen der Schüler abhängen.
Was versteht Simmel unter "Wechselwirkungen" in der Schule?
Wechselwirkungen bezeichnen die sozialen Interaktionen innerhalb der Schule, die das Individuum formen und durch die soziale Kreise überhaupt erst entstehen und wirken.
Wie unterscheidet Simmel das Kind vom Erwachsenen?
Die Arbeit untersucht Simmels spezifische Ausführungen zur Individualität des Kindes, die sich in ihrer Struktur und ihren Bildungsbedürfnissen wesentlich von der des Erwachsenen unterscheidet.
Sind Simmels schulpädagogische Ansichten heute noch relevant?
Ja, die Arbeit weist auf die Zeitlosigkeit seiner Gedanken hin, insbesondere in Bezug auf die Rolle des Schülers als aktives Wesen im Bildungsprozess.
- Citation du texte
- Leonie Peters (Auteur), 2014, Individualisierung und Wechselwirkungen in Simmels Schulpädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323256