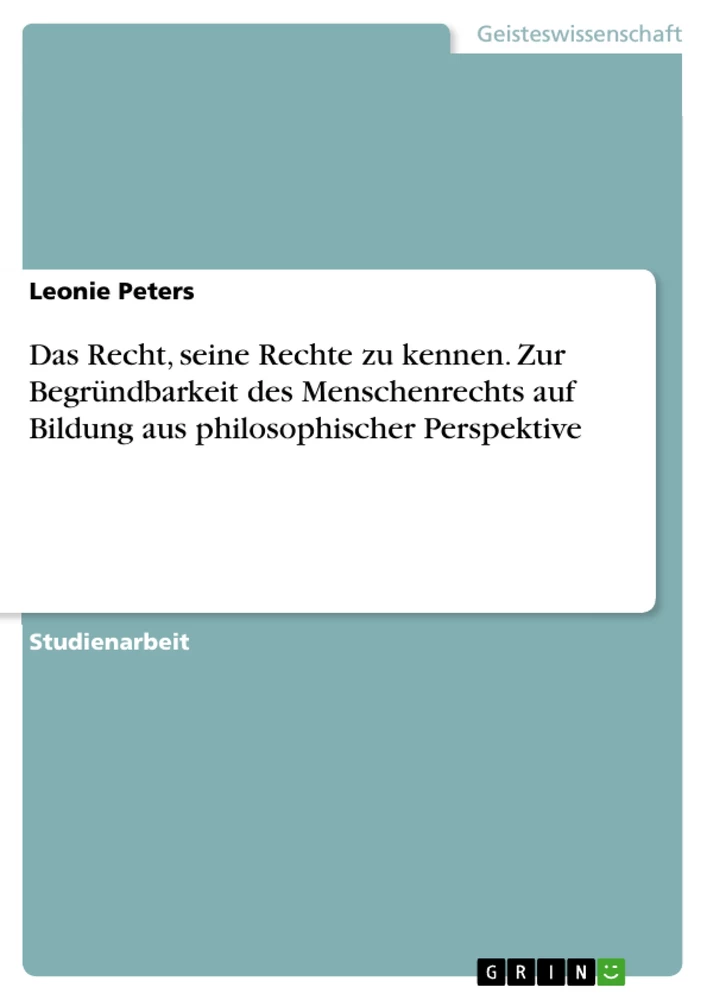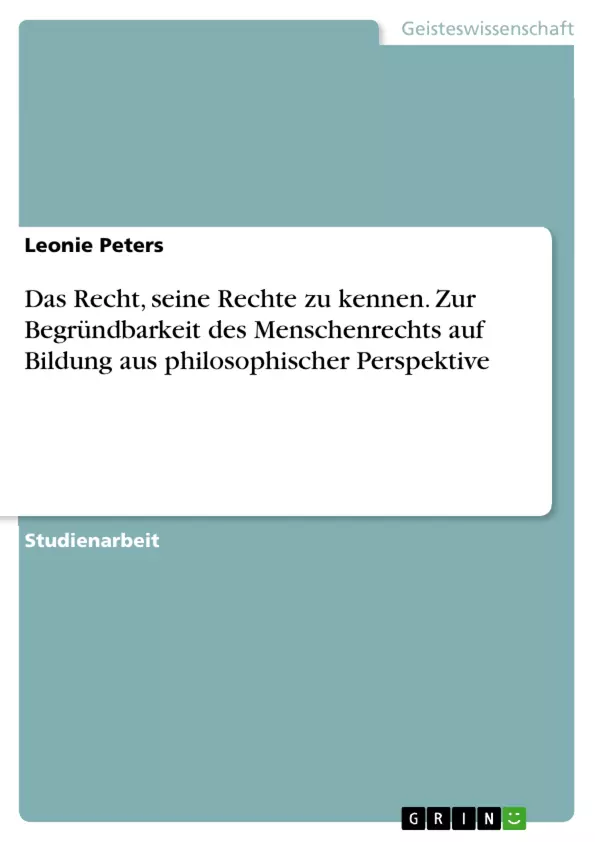Die vorliegende Arbeit thematisiert die Problematik einer Begründbarkeit des Menschenrechts auf Bildung zuerst anhand der drei Kategorien "Recht auf Bildung", "Rechte durch Bildung" und "Rechte in der Bildung" sowie anhand der Implikationen für den Bildungsbegriff.
Anschließend werden Ansätze von Jürgen Habermas und Hannah Arendt diskutiert, an deren Ausführungen zum "Recht, Rechte zu haben" der Titel der Arbeit und auch das in ihr gezogene Fazit anknüpft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hintergrund/Probleme
- 2.1 Recht auf Bildung; Rechte durch Bildung; Rechte in der Bildung
- 2.1.1 Recht auf Bildung
- 2.1.2 Rechte durch Bildung
- 2.1.3 Rechte in der Bildung
- 2.2 Rechtliche Verankerung
- 2.3 Zum Bildungsbegriff
- 3. Lösungsansätze
- 3.1 Zu Jürgen Habermas / (Karl-Otto Apel) – Diskursethische Letztbegründung
- 3.2 Zu Hannah Arendt - Das Recht, Rechte zu haben
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Menschenrecht auf Bildung und untersucht dessen Begründbarkeit aus philosophischer Perspektive. Sie befasst sich mit der Frage, wie dieses Recht im Kontext unterschiedlicher Menschenbilder und Bildungsverständnisse verstanden und begründet werden kann.
- Das Recht auf Bildung als interdependent mit anderen Menschenrechten
- Die Herausforderungen bei der Umsetzung des Rechts auf Bildung
- Die philosophische Perspektive auf das Recht auf Bildung
- Die Bedeutung von Bildung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- Der Zusammenhang von Bildung und dem Recht, Rechte zu haben
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt das Recht auf Bildung als Kernproblematik der Menschenrechtsdiskussion vor und betont die Bedeutung unterschiedlicher Menschenbilder und Bildungsverständnisse für dessen Begründung. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Unklarheiten und der Suche nach Lösungsansätzen.
2. Hintergrund/Probleme
Dieses Kapitel beleuchtet die Verknüpfung des Rechts auf Bildung mit anderen Menschenrechten und geht auf die Unterscheidung von „Recht auf Bildung“, „Rechte durch Bildung“ und „Rechte in der Bildung“ ein. Es werden die vier Bedingungen (availability, accessibility, acceptability, adaptability) für die Erfüllung des Rechts auf Bildung dargestellt.
2.1 Recht auf Bildung; Rechte durch Bildung; Rechte in der Bildung
Dieser Abschnitt erläutert die drei Kernbereiche des Rechts auf Bildung und beschreibt ihre spezifischen Merkmale. Es wird auf die Bedeutung von Bildung als Befähigungsrecht und die Rolle der Menschenrechtsbildung eingegangen.
2.2 Rechtliche Verankerung
Dieser Abschnitt befasst sich mit der rechtlichen Verankerung des Rechts auf Bildung und beleuchtet die historische Entwicklung dieses Rechts.
2.3 Zum Bildungsbegriff
Dieser Abschnitt problematisiert den Bildungsbegriff und seine Auslegung im Kontext des Rechts auf Bildung.
3. Lösungsansätze
Dieses Kapitel präsentiert verschiedene philosophische Ansätze zur Begründung des Rechts auf Bildung. Es werden die Ideen von Jürgen Habermas und Hannah Arendt im Hinblick auf das Recht auf Bildung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Menschenrecht auf Bildung, Philosophie, Bildungstheorie, Menschenbilder, Bildungsverständnis, Rechtliche Verankerung, Interdependenz, Befähigungsrecht, Menschenrechtsbildung, Diskursethik, Hannah Arendt, Jürgen Habermas, UNESCO Weltbildungsbericht.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die drei Kategorien des Menschenrechts auf Bildung?
Es wird unterschieden zwischen dem „Recht auf Bildung“, „Rechten durch Bildung“ (Bildung als Befähigung) und „Rechten in der Bildung“ (Schutzrechte innerhalb des Systems).
Welche philosophischen Ansätze werden zur Begründung herangezogen?
Die Arbeit diskutiert insbesondere die Diskursethik von Jürgen Habermas und Hannah Arendts Konzept des „Rechts, Rechte zu haben“.
Was besagt Hannah Arendts Konzept für das Bildungsrecht?
Es knüpft an die Idee an, dass Bildung die Voraussetzung dafür ist, seine eigenen Rechte überhaupt zu kennen und einfordern zu können.
Was sind die „4 As“ der Erfüllung des Bildungsrechts?
Dies sind Verfügbarkeit (availability), Zugänglichkeit (accessibility), Annehmbarkeit (acceptability) und Adaptierbarkeit (adaptability).
Warum ist Bildung ein „Befähigungsrecht“?
Weil Bildung oft erst die Grundlage schafft, um andere Menschenrechte (wie politische Teilhabe oder Religionsfreiheit) effektiv ausüben zu können.
- Quote paper
- B.A. Leonie Peters (Author), 2014, Das Recht, seine Rechte zu kennen. Zur Begründbarkeit des Menschenrechts auf Bildung aus philosophischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323259