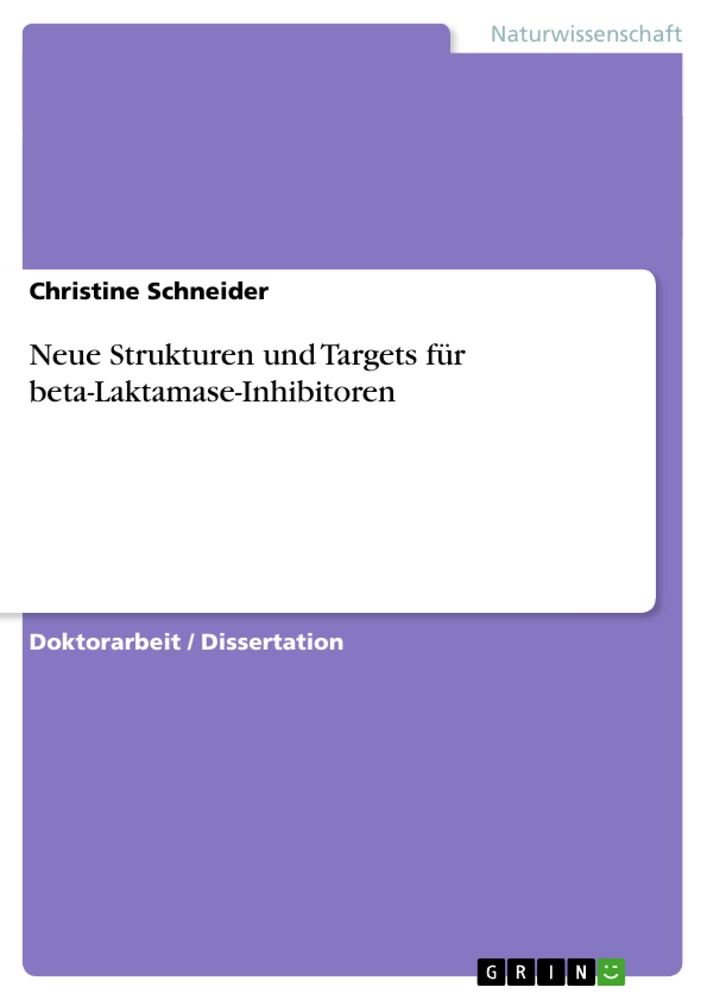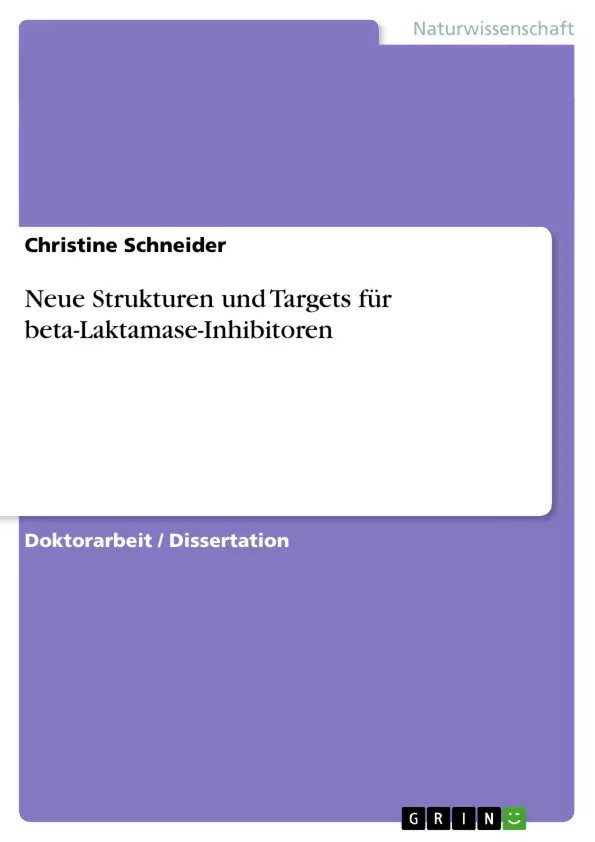Zwischen diesen Aussagen liegen ungefähr 30 Jahre, in denen die Resistenz von Bakterien gegenüber Antibiotika stark zugenommen hat. Immer noch sind akute Atemwegsinfektionen, insbesondere Pneumonien, die Haupttodesursache weltweit (HEYMANN, 2000). Seit der Entdeckung des Penicillins durch Sir Alexander Fleming 1928 war vor allem in den 1940er Jahren eine rasante Entwicklung neuer Antibiotika zu verzeichnen (AMYES, 2000). Darunter Streptomycin (1944), Chloramphenicol (1947), Chlortetracyclin (1948) und Erythromycin (1952). Heutzutage gibt es etwa sieben große Antibiotikaklassen, die an drei verschiedenen Angriffspunkten wirken (MUTSCHLER, 1996). Dies sind
> Hemmung der Zellwandsynthese, durch die Gruppen der Penicilline und Cephalosporine
> Blockade der Proteinbiosynthese, verursacht durch Aminoglykoside, Tetracycline und Makrolide
> Unterdrückung der Nukleinsäuresynthese, bewirkt durch Sulfonamide und (Fluor) Chinolone
Zeitgleich mit der Entdeckung bzw. Weiterentwicklung von Wirkstoffen, entstanden Resistenzen gegen Antibiotika. Mutationen oder Gentransfer führten zu Bakterien, die nicht mehr mit den ursprünglich wirksamen Stoffen bekämpft werden konnten. Häufig weisen diese Erreger eine Multiresistenz gegenüber verschiedenster Antibiotika auf. Als besonders gefährlich gelten heute beispielsweise Methicillin-resistente S. aureus (MRSA) und Vancomycinresistente Enterokokken (VRE). Abbildung 1 zeigt den Anstieg von MRSA in britischen Krankenhäusern in den Jahren 1987 bis 1997. Generell hat die Häufigkeit von Resistenzen gegenüber Antibiotika bei fast allen wichtigen bakteriellen Infektionserregern weltweit zugenommen (BAQUERO, 1996). Auch in Deutschland ist ein Anstieg zu verzeichnen. So ist z.B. zwischen 1998 und 2001 eine Resistenzzunahme von E. coli gegenüber Ciprofloxacin (Fluorchinolon) von 7,7 auf 14,5 % ermittelt worden. Die Resistenzraten von E. coli gegenüber Ampicillin stiegen von 40 auf 50 % (PEG, 2001).
Eine der Hauptursachen für die Entstehung von Resistenzen ist der falsche Umgang mit Antibiotika. Darunter fallen unnötige oder falsche Verschreibungen, falsche Anwendung und unkontrollierte Erwerbsmöglichkeiten. Auch der intensive Gebrauch von Antibiotika in Krankenhäusern fördert die Resistenzentwicklung (WHO, 2000).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die B-Laktam-Antibiotika
- Penicilline (Pename)
- Cephalosporine (Cepheme)
- Carbapeneme
- Monobaktame
- B-Laktamase-Inhibitoren
- Wirkungsweise von B-Laktam-Antibiotika
- Der Aufbau der bakteriellen Zellwand
- Die Angriffspunkte der B-Laktam-Antibiotika
- B-Laktamasen
- B-Laktamasen der Gruppe 1
- Chromosomale, nicht induzierbare AmpC-B-Laktamasen
- Chromosomale, induzierbare AmpC-B-Laktamasen
- Plasmid-kodierte AmpC-B-Laktamasen
- B-Laktamasen der Gruppe 2
- B-Laktamasen der Gruppen 3 und 4
- Regulation der ß-Laktamase-Expression
- Die B-Laktamase-Expression bei C. freundii und E. cloacae
- Das AmpR-Protein
- Zielsetzung der Arbeit
- Material und Methoden
- Material
- Bakterienstämme
- Enzyme
- Plasmide
- Oligonukleotide
- DNA- und Protein-Marker
- Chemikalien
- Nährmedien und Antibiotika
- Häufig verwendete Puffer und Lösungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Erforschung neuer Strukturen und Targets für B-Laktamase-Inhibitoren. Ziel ist es, die Wirksamkeit von B-Laktam-Antibiotika gegen resistente Bakterien zu verbessern.
- Die Funktionsweise von B-Laktamase-Inhibitoren
- Die Rolle von B-Laktamasen in der Antibiotikaresistenz
- Die Regulation der B-Laktamase-Expression
- Neue Strukturen für B-Laktamase-Inhibitoren
- Potentielle Targets für die Entwicklung neuer B-Laktamase-Inhibitoren
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Dieses Kapitel führt in die Thematik der B-Laktam-Antibiotika und deren Resistenzmechanismen ein. Es werden die verschiedenen Klassen von B-Laktam-Antibiotika, die Funktionsweise von B-Laktamase-Inhibitoren und die Rolle von B-Laktamasen in der bakteriellen Zellwand erläutert.
- Kapitel 2: Material und Methoden
In diesem Kapitel werden die verwendeten Materialien und Methoden der Untersuchung vorgestellt. Dazu gehören die verwendeten Bakterienstämme, Enzyme, Plasmide und Oligonukleotide, sowie die verwendeten Nährmedien und Antibiotika.
Schlüsselwörter
B-Laktam-Antibiotika, B-Laktamase-Inhibitoren, Antibiotikaresistenz, B-Laktamasen, Zellwand, AmpC-B-Laktamasen, Regulation, Expression, Targets, Strukturen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Beta-Laktamase-Inhibitoren?
Das sind Wirkstoffe, die Enzyme (Beta-Laktamasen) blockieren, welche Bakterien produzieren, um Antibiotika wie Penicillin unwirksam zu machen.
Warum nehmen Antibiotikaresistenzen weltweit zu?
Hauptursachen sind der falsche Umgang mit Antibiotika, unnötige Verschreibungen, unkontrollierter Erwerb und der intensive Gebrauch in Krankenhäusern, was Mutationen und Gentransfer bei Bakterien fördert.
Welche Bakterien gelten als besonders gefährlich?
Besonders kritisch sind Methicillin-resistente S. aureus (MRSA) und Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE), da sie Multiresistenzen gegen viele gängige Antibiotika aufweisen.
Wie wirken Beta-Laktam-Antibiotika?
Sie hemmen die bakterielle Zellwandsynthese, was dazu führt, dass sich die Bakterien nicht mehr stabil vermehren können und schließlich absterben.
Was ist das Ziel der Forschung an neuen Targets?
Ziel ist es, neue Angriffspunkte (Targets) in der Regulation der Beta-Laktamase-Expression zu finden, um die Wirksamkeit von Antibiotika gegen resistente Stämme wiederherzustellen.
- Citation du texte
- Christine Schneider (Auteur), 2004, Neue Strukturen und Targets für beta-Laktamase-Inhibitoren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32337