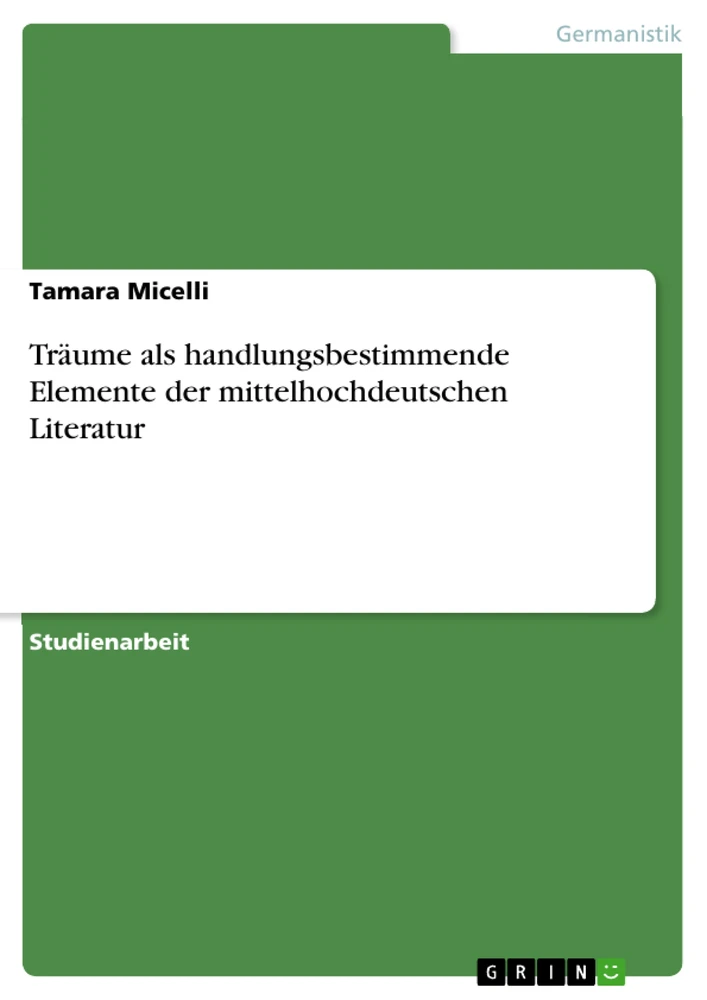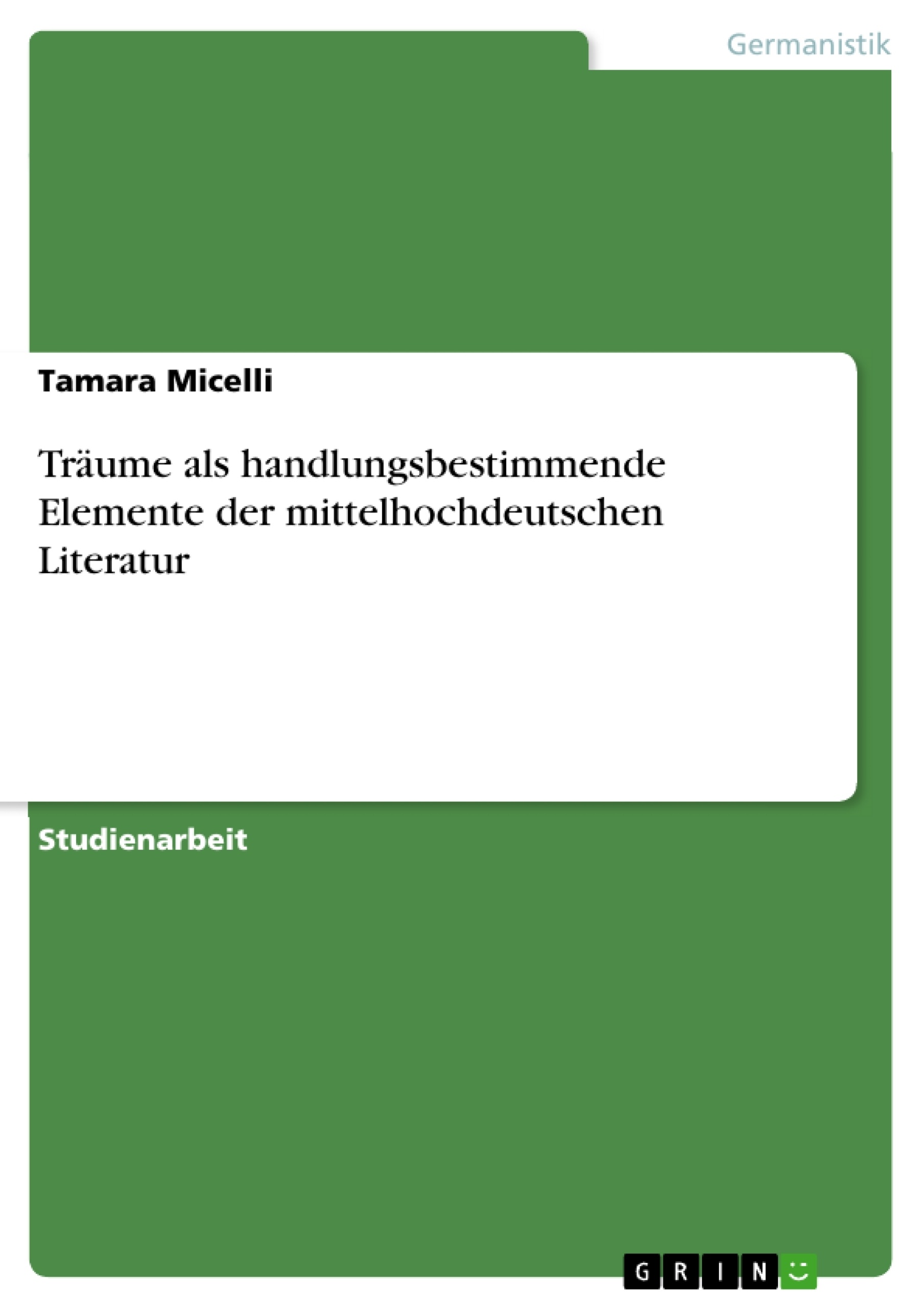Alle Menschen haben Träume, denn in ihnen werden persönliche Erlebnisse und Gedanken verarbeitet. Jedoch können wir uns meistens nur noch verschwommen an sie erinnern. Aufgrund dieser Tatsache faszinieren und verwirren Träume die Menschen seit mehreren Jahrtausenden. Bereits in der Antike setzte man sich mit Träumen auseinander und Philosophen wie Aristoteles versuchten die Ursachen und Bedeutungen von Träumen zu erklären.
Der Traum fand auch in der Literatur einen besonderen Stellungswert. Schon die mittelalterlichen Autoren ließen sich von Träumen inspirieren. In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf der mittelalterlichen Epik, da die Träume in diesen Texten immer zu einem bestimmten Handeln der Figur führen. Des Weiteren träumen die Figuren immer aus einem bestimmten Grund; ihre Träume sind bedeutungsvoll, denn sie treiben die Handlung weiter. Diese Arbeit behandelt die Darstellung des Traumes sowie die Reaktionen der handelnden Figuren in den Werken „Parzival“ von Wolfram von Eschenbach, dem „Nibelungenlied“ und „Flore und Blanscheflur“ von Konrad Fleck.
Der Umgang mit den Träumen der Figuren ist in jedem einzelnen Werk anders. Es wird sich zeigen, dass jeder, der hier aufgeführten Träume eine prophetische Einstellung hat. Außerdem werden die verschiedenen Reaktionen der Träumenden deutlich gemacht werden. Ich möchte an dieser Stelle noch anführen, dass sich durch Träume ein Spannungsmoment entwickelt. Der Grad zwischen dem Wissen was passieren kann und der Ungewissheit wann das Ereignis eintreten wird, ist höchst spannend.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Traumtheorie
- Das Frühmittelalter
- Hochmittelalter
- Fazit
- Die Klassifikation der Träume
- Der Traum teilt dem Leser Wissen mit
- Parzival
- Der Traum Parzivals
- Fazit
- Der Traum teilt der Figur und dem Leser Wissen mit
- Ignoranz
- Der Traum der Herzeloyde
- Flug durch das Gewitter
- Angriff des Greifen
- Geburt und Säugung des Drachen
- Fazit
- Der Traum der Herzeloyde
- Angst
- Das Nibelungenlied
- Der Falkentraum
- Der Ebertraum
- Der Bergtraum
- Fazit
- Das Nibelungenlied
- Fehldeutung
- Flore und Blanscheflur
- Fazit
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung von Träumen in der mittelhochdeutschen Literatur und analysiert die Reaktionen der Figuren auf diese Träume. Die Untersuchung fokussiert auf die Werke „Parzival“ von Wolfram von Eschenbach, das „Nibelungenlied“ und „Flore und Blanscheflur“ von Konrad Fleck.
- Die Traumtheorie im Mittelalter
- Die Klassifikation von Träumen und ihre Bedeutung
- Die Rolle von Träumen als Wissensträger für den Leser und die Figuren
- Die verschiedenen Arten von Träumen und ihre Auswirkungen auf die Figuren
- Die Reaktion der Figuren auf Träume und die daraus resultierenden Handlungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Bedeutung von Träumen in der Literatur und die Besonderheit der Träume in der mittelhochdeutschen Epik. Sie stellt die untersuchten Werke und die zentrale Forschungsfrage vor.
Das zweite Kapitel analysiert die Entwicklung der Traumtheorie von der Antike bis ins Mittelalter. Es beleuchtet die Klassifikationsmodelle von Macrobius und Augustinus und zeigt die unterschiedlichen Einstellungen zum Traum in der Antike und im Frühmittelalter auf.
Das dritte Kapitel diskutiert die unterschiedlichen Arten von Träumen und ihre Bedeutung für den Leser und die Figuren. Es untersucht, wie Träume den Figuren Wissen vermitteln und die Handlung beeinflussen können.
Das vierte Kapitel widmet sich der Darstellung von Träumen in „Parzival“. Es analysiert, wie der Traum Parzivals dem Leser und der Figur selbst Wissen vermittelt und die Handlung des Romans vorantreibt.
Das fünfte Kapitel behandelt das Thema „Ignoranz“ und untersucht den Traum der Herzeloyde in „Flore und Blanscheflur“. Es analysiert die verschiedenen Traumbilder und ihre Bedeutung für die Handlung des Romans.
Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema „Angst“ und untersucht die Träume im „Nibelungenlied“. Es analysiert die verschiedenen Traumbilder, ihre Bedeutung für die Figuren und die Handlung des Epos.
Das siebte Kapitel beleuchtet das Thema „Fehldeutung“ und analysiert den Umgang mit Träumen in „Flore und Blanscheflur“. Es untersucht, wie die Figuren Träume falsch interpretieren und welche Konsequenzen dies für die Handlung hat.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen Traumtheorie, mittelhochdeutsche Literatur, Traumdeutung, prophetische Träume, Figurenreaktionen, Spannungsmomente, „Parzival“, „Nibelungenlied“, „Flore und Blanscheflur“, Wolfram von Eschenbach, Konrad Fleck.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Träume in der mittelalterlichen Literatur?
Träume fungieren als handlungsbestimmende Elemente, die oft prophetisch sind und die Figuren zu bestimmten Taten motivieren.
Wie wird der Traum der Herzeloyde in „Parzival“ gedeutet?
Ihr Traum (Flug durch das Gewitter, Geburt eines Drachen) kündigt symbolisch das Schicksal ihres Sohnes Parzival und den Verlust ihres Schutzes an.
Welche Traumtheorien gab es im Mittelalter?
Die mittelalterliche Sicht wurde stark von antiken Denkern wie Macrobius und Augustinus geprägt, die Träume in verschiedene Klassen (z. B. göttlich vs. körperlich) einteilten.
Was sind die Träume im „Nibelungenlied“?
Bekannte Beispiele sind der Falkentraum Kriemhilds oder der Eber- und Bergtraum, die alle das kommende Unheil und den Tod der Helden vorwegnehmen.
Warum führen Träume in der Literatur oft zu Spannung?
Weil der Leser durch den Traum oft mehr weiß als die Figur (Wissensvorsprung), aber ungewiss bleibt, wann und wie das Ereignis eintritt.
- Citar trabajo
- Tamara Micelli (Autor), 2015, Träume als handlungsbestimmende Elemente der mittelhochdeutschen Literatur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323401