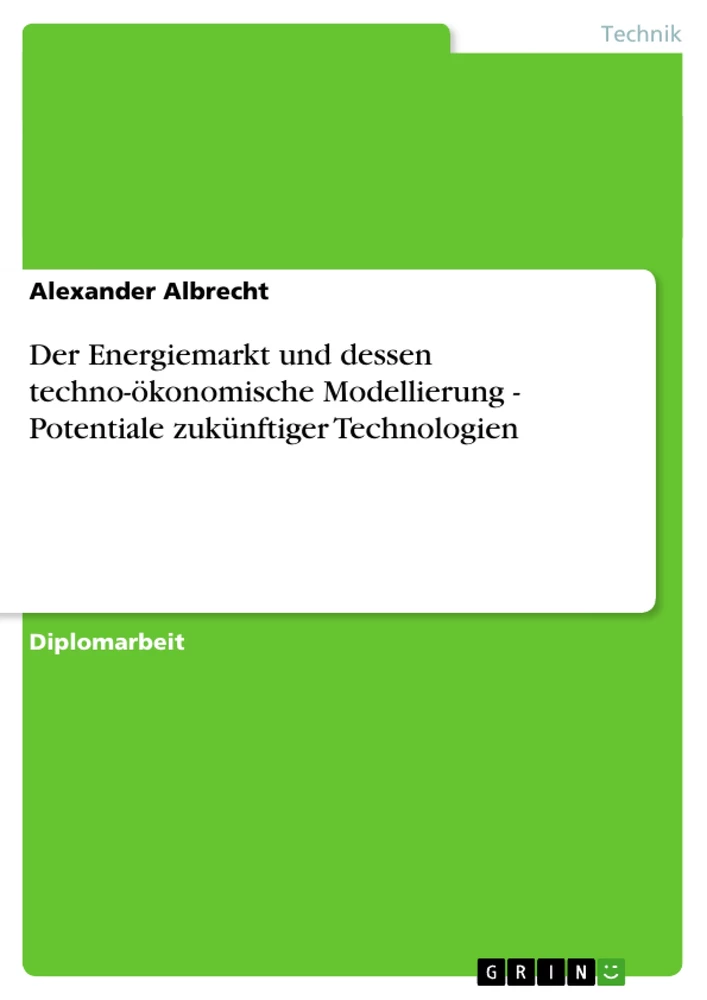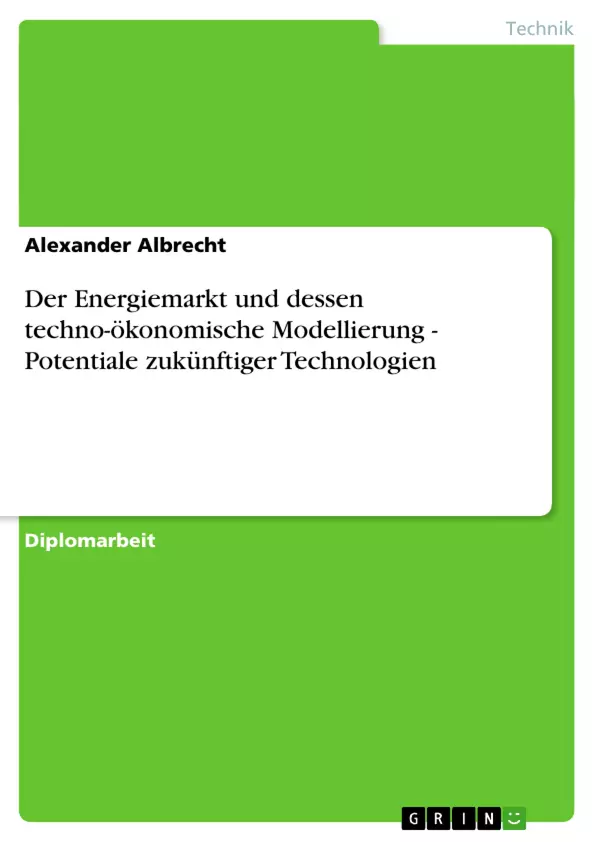Die Themenstellung für diese Diplomarbeit stellte die Universität Augsburg in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Garching bei München. Ziel der Arbeit ist es, in der ersten Hälfte (Kapitel 2 bis 5) den Energiemarkt in seinen realen Charakteren darzustellen. Im zweiten Teil (Kapitel 6 bis 8) wird der Energiemodellgenerator TIMES präsentiert. Diese Abbildung der Realwelt soll auf Konsistenz und auf ökonomische Grundannahmen analysiert werden.
Im nachfolgenden Kapitel werden die physikalischen Grundlagen, der Begriff „Energie“ und zentrale Ergebnisse bzw. Trends im Energiemarkt vorgestellt. Im dritten Kapitel folgen die fossilen und erneuerbaren Energieträger sowie Umwandlungstechnologien, die das Energieangebot repräsentieren. Die physikalischen und ökonomischen Ausführungen bilden die Grundlage für die nachfolgenden Kapitel. Das vierte und fünfte Kapitel widmet sich der Energieökonomik. Im ersten Part wird die Umwelt- und Innovationsökonomik im Energiesektor genauer dargestellt. Dabei werden die einzelnen Energietechnologien in verschiedenen Kontexten genauer analysiert, sowie der technische Fortschritt und Innovationen im Energiesektor hinterleuchtet. Im fünften Kapital bzw. zweiten Part werden die Energienachfrage und ihre Einflussfaktoren wie Bevölkerungswachstum und Sozialprodukt aufgezeigt. Der Fokus liegt durchgehend auf weltweiter Ebene. Wenn die Daten für eine globale Erfassung nicht zugänglich waren, wurde auf supranationale oder deutsche Daten zurückgegriffen.
Im sechsten Kapitel werden Energiemodelle und ihre Anforderungen generell dargestellt. Das siebte Kapitel ist dem Modellgenerator TIMES gewidmet. Der Aufbau, die Funktionsweise und ausgewählte Features werden erläutert. Im Anschluss werden die ökonomischen Annahmen, die dem Modell zugrunde liegen, aufgezeigt und im achten Kapitel mit Aspekten der evolutorischen/ Neo-Schumpeterainischen Ökonomik abgeglichen. Der Schwerpunkt liegt in der Marktstruktur, in den grundlegenden Annahmen der Neoklassik und in der Modellierung des technischen Fortschritts. Das neunte und letzte Kapitel rundet die Diplomarbeit mit Fazit und Ausblick ab.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort und Aufbau der Arbeit
- Energie und ihre Facetten
- Begriffsbestimmung und Formen von Energie
- Energie aus naturwissenschaftliche Sicht - Erscheinungsformen der Energie
- Die Hauptsätze der Thermodynamik
- Energie aus technischer Sicht
- Energie aus ökonomischer Sicht
- Besonderheiten der Energiemärkte
- Trends im Energiemarkt und wichtige Ergebnisse
- Energieträger und Umwandlungssektoren
- Fossile Primärenergieträger
- Primärenergieträger Kohle
- Primärenergieträger Erdöl
- Primärenergieträger Erdgas
- Schlussfolgerungen Fossile Energieträger
- Kernenergie
- Kernspaltung
- Kernfusion mit magnetischem Einschluss
- Erneuerbare, regenerative Energien
- Windkraft
- Wasserkraft
- Biomasse
- Solare Energie
- Photothermik (Solarwärme)
- Photovoltaik (Solarstrom)
- Schlussfolgerungen: erneuerbare Energien
- Neue Konzepte: Wasserstoff und die Brennstoffzelle
- Fossile Primärenergieträger
- Energieökonomik
- Energiesysteme - Ein Vergleich mit Blick auf die Kostenstrukturen
- Investitionskosten
- Stromgestehungs- und Grenzkosten
- Erntefaktoren
- Energiesysteme - Ein Vergleich mit Blick auf die Nachhaltigkeit
- Nachhaltige Entwicklung
- LCA - Emissionen der unterschiedlichen Energiesysteme
- Gesundheitsgefährdende Emissionen und Strahlungen
- Klimaschädliche Emissionen und der Treibhauseffekt
- Externe Kosten im Energiesektor
- Technische Optionen zur Minderung der Kohlendioxidemissionen
- Schlussfolgerungen
- Energie aus Sicht der Innovationsökonomik – Der technische Fortschritt
- Technischer Fortschritt und Nachhaltigkeit
- Energieinventionen
- Energieinnovationen aus Sicht der Evolutorik/ Neo-Schumpeterianik
- Backstop-Technologien und die Hotelling-Regel
- Technologie-Diffusion im Energiemarkt
- Substitutionsmechanismen im Energiemarkt
- Energie, technischer Fortschritt und Wirtschaftswachstum
- Energienachfrage
- Energienachfrage, wirtschaftliche Entwicklung und Energiepreise
- Energienachfrage und Strukturwandel
- Determinanten der Energienachfrage
- Der Energiepreis
- Globales Wirtschaftswachstum
- Bevölkerungswachstum
- Schlussfolgerungen
- Energiemodelle
- Energiemodellarten: Top-down vs. bottom-up
- Weitere Unterscheidungen
- Umfassende Energiemodelle und Fazit
- TIMES
- Einleitung und Einordnung des Modells
- Vorgehensweise und Abbildung des Energiesystems
- Beschreibung des Energiesystems: Das RES und seine Komponenten
- Processes und Commodities
- Input: Sets und Parameter
- Zeithorizont, zeitliche Auflösung und Indexierung
- Zeitfenster
- Alterungsprozesse (Vintaging)
- Regionale Aufteilung
- Commodities und Prozesse - eine genauere Betrachtung
- Einheiten und Diskontraten
- Output
- Gleichungen
- Variablen
- Die (Neoklassische) Zielfunktion
- Unterscheidung der Investitionsarten
- Güterpartialmarktgleichgewicht und elastische Nachfrage
- Zusammenfassung der techno-ökonomischen Implementierungen in TIMES
- Grundlegende Annahme der Neoklassik in TIMES
- TIMES - Eine kritische Würdigung
- Marktstrukturen
- Neoklassische Grundannahmen
- Der homo oeconomicus und Risiko
- Heterogene Akteure, Technologien und Energieträger
- Die (Kosten-) Minimierung der Zielfunktion
- Technischer Fortschritt und Innovationsprozess
- Endogenous Technological Learning (ETL)
- Diffusion und technologische Übergänge
- Endogenisierung des technischen Fortschrittes in TIMES
- Schlussfolgerungen und Fazit
- Energiesysteme - Ein Vergleich mit Blick auf die Kostenstrukturen
- Die Modellierung des Energiemarktes und die Analyse der Potentiale zukünftiger Technologien
- Die Rolle von Energie in der Wirtschaft und die Auswirkungen des technischen Fortschritts auf die Energienachfrage
- Die Bewertung verschiedener Energieträger hinsichtlich Kosten und Nachhaltigkeit
- Die Bedeutung der Innovationsökonomik im Energiesektor und die Rolle von Endogenous Technological Learning (ETL)
- Die Anwendung des TIMES-Modells zur Simulation und Analyse von Energiesystemen
- Kapitel 2: Energie und ihre Facetten: Dieses Kapitel definiert den Begriff Energie, beschreibt seine Erscheinungsformen und untersucht seine Bedeutung aus naturwissenschaftlicher, technischer und ökonomischer Perspektive.
- Kapitel 3: Energieträger und Umwandlungssektoren: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Energieträger, einschließlich fossiler Brennstoffe, Kernenergie und erneuerbarer Energien. Es betrachtet die jeweiligen Vor- und Nachteile sowie die technischen und ökonomischen Aspekte.
- Kapitel 4: Energieökonomik: Dieses Kapitel beleuchtet die ökonomischen Aspekte der Energieversorgung, einschließlich der Kostenstrukturen verschiedener Energiesysteme, der Nachhaltigkeit der verschiedenen Energieträger und der Rolle des technischen Fortschritts im Energiesektor.
- Kapitel 5: Energieökonomik - Die Energienachfrage: Dieses Kapitel untersucht die Energienachfrage, ihre Determinanten und ihren Zusammenhang mit wirtschaftlicher Entwicklung und Energiepreisen.
- Kapitel 6: Energiemodelle: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Energiemodelltypen, ihren Vor- und Nachteilen sowie der Bedeutung für die Analyse und Prognose des Energiemarktes.
- Kapitel 7: TIMES: Dieses Kapitel stellt das TIMES-Modell vor, beschreibt seine Funktionsweise und erläutert seine Anwendung in der techno-ökonomischen Modellierung des Energiesystems.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der techno-ökonomischen Modellierung des Energiemarktes und der Potentiale zukünftiger Technologien. Sie untersucht die verschiedenen Energieträger und deren Einordnung in den Kontext der Nachhaltigkeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die folgenden Schlüsselthemen: Energiemarkt, techno-ökonomische Modellierung, Energieträger, Nachhaltigkeit, Innovationsökonomik, technischer Fortschritt, Energienachfrage, TIMES-Modell.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der TIMES-Modellgenerator?
Ein umfassendes Energiemodell zur techno-ökonomischen Abbildung und Analyse von Energiesystemen auf globaler oder regionaler Ebene.
Welche Energieträger werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit analysiert fossile Träger (Kohle, Öl, Gas), Kernenergie (Spaltung/Fusion) sowie regenerative Energien wie Wind, Wasser, Biomasse und Solar.
Was bedeutet "Endogenous Technological Learning" (ETL)?
Es beschreibt die Modellierung des technischen Fortschritts, bei dem Technologien durch deren vermehrte Anwendung effizienter und kostengünstiger werden.
Wie hängen Bevölkerungswachstum und Energienachfrage zusammen?
Das Bevölkerungswachstum und das Sozialprodukt gelten als zentrale Determinanten, die die weltweite Nachfrage nach Energie steuern.
Was wird am neoklassischen Ansatz von TIMES kritisiert?
Die Arbeit gleicht die neoklassischen Grundannahmen (wie den Homo Oeconomicus) mit Aspekten der evolutorischen Ökonomik ab, um die Realitätsnähe zu prüfen.
- Citar trabajo
- Alexander Albrecht (Autor), 2004, Der Energiemarkt und dessen techno-ökonomische Modellierung - Potentiale zukünftiger Technologien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32606