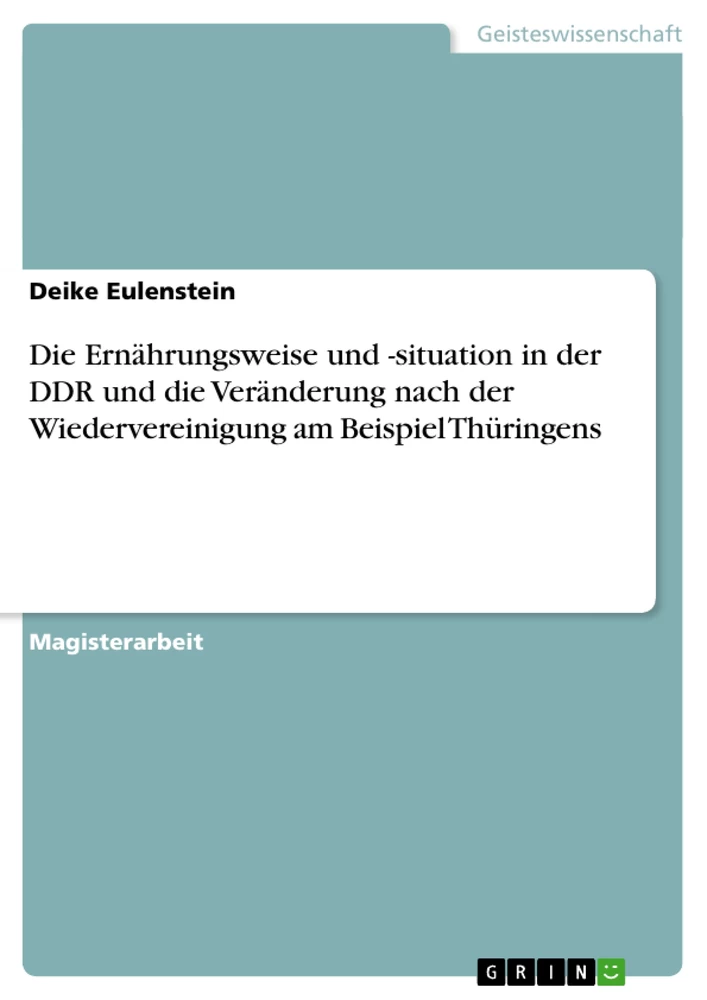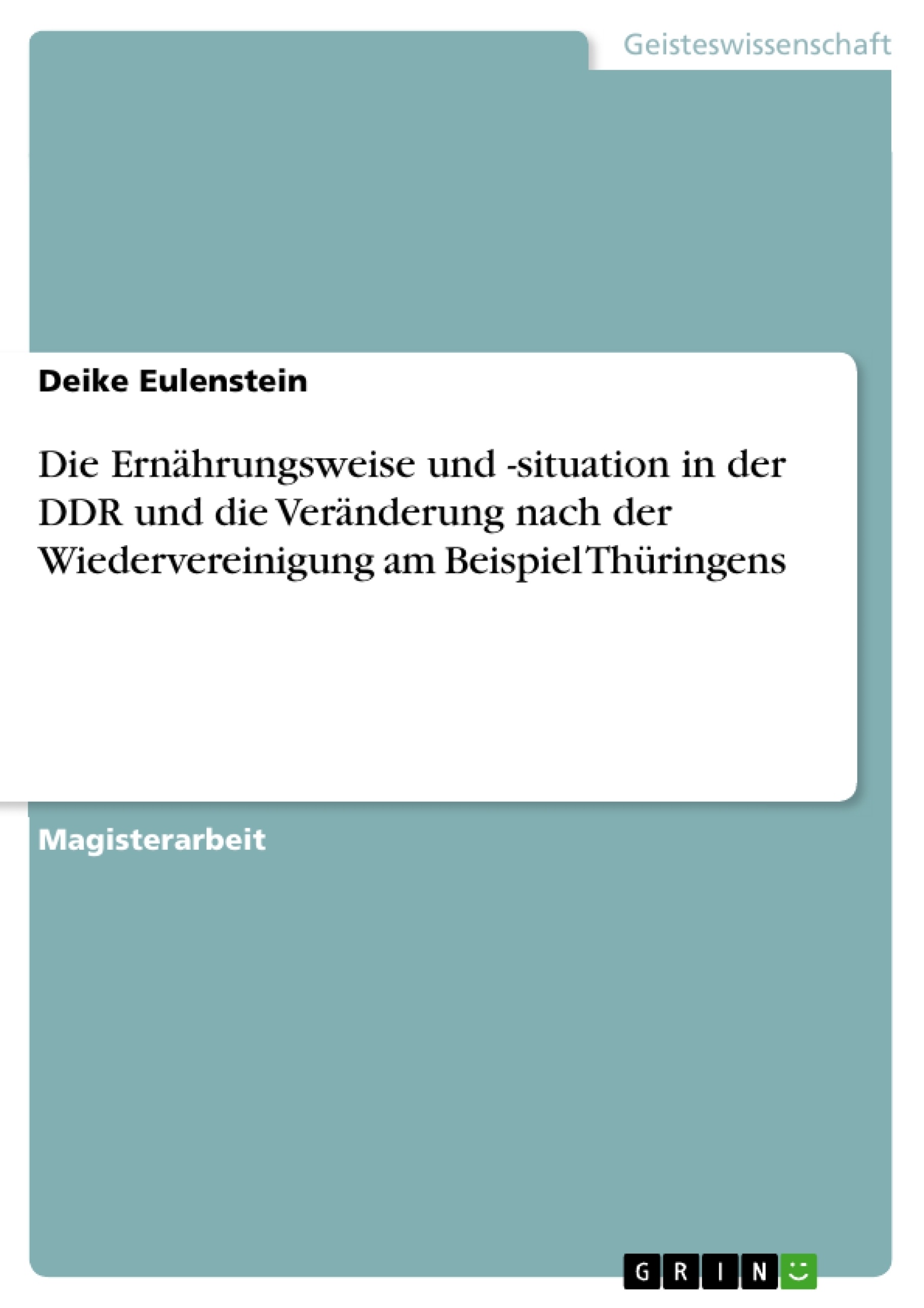Die Ernährungsweise und das Essverhalten spiegelt nicht nur die Art und Weise wider, wie bio-physiologische Grundbedürfnisse abgedeckt werden, sondern geben weiterhin Aufschluss über soziale Strukturen, Normen, Werte und Verhaltensweisen. Klassen- und gruppenspezifische Identitätsmerkmale kommen durch Aufnahme unterschiedlicher Nahrungsmittel und unterschiedliche Formen des Essverhaltens zum Ausdruck, wodurch diese Klassen- und/oder Gruppenidentität symbolisch vermitteln. Somit spiegeln sich dann auch ökonomische und gesellschaftliche Veränderungen in diesem Bereich wieder.
Die drastischen Veränderungen, die sich 1990 durch die Wiedervereinigung Deutschlands in der ehemaligen DDR ergeben haben, sollten sich auch im veränderten Ernährungsverhalten zeigen. Weiterhin sollte in jüngerer Zeit, durch die zahlreichen Enttäuschungen und Probleme in der Beziehung zwischen den alten und neuen Bundesländern eine Rückbesinnung deutlich werden, die die lokalen und regionalen Identitäten zum Ausdruck bringen und als Teil einer neuen Abgrenzungstendenz gedeutet werden können.
Dieser Ernährungswandel wurde in einer Befragung, 13 Jahre nach der Wiedervereinigung, in Thüringen untersucht.
Wesentliches Ergebnis der Arbeit bildet die Analyse der Veränderungen der Einstellung zur Nahrung und Nahrungsverhalten bei den Menschen in den Neuen Ländern in der Phase zwischen Mauerfall und Gegenwart. Hier zeigt sich deutlich, wie eine Rückbesinnung auf die traditionellen Vorstellungen über und Einstellungen zur Nahrung hand in hand gehen mit einem Erstarken des angeschlagenen Selbstbewusstseins und einer Identitätsfindung, die eine negative Pauschalisierung der Zustände in der vergangenen DDR ablehnt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Vorbemerkungen zur Ernährungsforschung
- 2. Ernährungswandel in der BRD und der DDR sowie das Ernährungs- und Mahlzeitenverhalten in der DDR vor der Wiedervereinigung
- 2.1 Ernährungswandel in der BRD
- 2.1.1 Die Nachkriegszeit und die 50er Jahre
- 2.1.2 Die 60er Jahre
- 2.1.3 Die 70er Jahre
- 2.1.4 Die 80er Jahre
- 2.2 Ernährungswandel in der DDR
- 2.2.1 Die Nachkriegszeit und die 50er Jahre
- 2.2.2 Die 60er Jahre
- 2.2.3 Die 70er Jahre
- 2.2.4 Die 80er Jahre
- 2.3 Ausgewählte Aspekte des Ernährungs- und Mahlzeitenverhaltens in der DDR
- 2.3.1 Ernährungsverhalten
- 2.3.1.1 Tendenzen beim Lebensmittelverbrauch
- 2.3.1.2 Staatliche Ernährungsbeeinflussung
- 2.3.1.3 Eigenproduktion von Nahrungsmitteln
- 2.3.2 Mahlzeitenverhalten
- 2.3.2.1 Restaurantbesuche
- 2.3.2.2 Gemeinschaftsverpflegung
- 2.3.2.3 Mahlzeitenrhythmus und Bedeutung von Mahlzeiten
- 2.4 Zusammenfassung und Vergleich der Tendenzen im Ernährungsverhalten der BRD und DDR von den 50er Jahren bis zur Wiedervereinigung
- 3. Ernährungs- und Mahlzeitenverhalten in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung und Identität als Einflussfaktor
- 3.1 Identität als Einflussfaktor auf die Ernährungsweise
- 3.1.1 Herausbildung der Ost-Identität
- 3.1.2 Bedeutung und Bedeutungswandel von DDR-Produkten für die Ost-Identität
- 3.1.3 Ernährung und Identität
- 3.2 Ernährungs- und Mahlzeitenverhalten nach der Wiedervereinigung
- 3.2.1 Ernährungsverhalten
- 3.2.2 Mahlzeitenverhalten
- 3.2.2.1 Restaurantbesuche
- 3.2.2.2 Gemeinschaftsverpflegung
- 3.3 Veränderungen der Ernährungssituation und des Ernährungs- und Mahlzeitenverhaltens in Thüringen
- 3.3.1 Methodisches Vorgehen
- 3.3.2 Subjektiv empfundene Veränderungen der Ernährungssituation
- 3.3.2.1 Positiv empfundene Veränderungen
- 3.3.2.2 Negativ empfundene Veränderungen
- 3.3.3 Ernährungsverhalten
- 3.3.3.1 Lebensmittelverbrauch
- 3.3.3.2 Herkunft der Lebensmittel
- 3.3.3.3 Eigenproduktion von Nahrungsmitteln
- 3.3.4 Mahlzeitenverhalten
- 3.3.4.1 Restaurantbesuche
- 3.3.4.2 Gemeinschaftsverpflegung
- 3.3.4.3 Mahlzeitenrhythmus und Kochgewohnheiten
- 3.3.4.4 Essenseinladungen
- 3.3.5 Auswertung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Ernährungssituation und des Ernährungs- und Mahlzeitenverhaltens in Thüringen nach der deutschen Wiedervereinigung. Sie analysiert den Einfluss von Identität und regionalen Produkten auf das Essverhalten der Bevölkerung.
- Ernährungswandel in der DDR vor und nach der Wiedervereinigung
- Der Einfluss der Ost-Identität auf das Ernährungsverhalten
- Veränderungen im Lebensmittelkonsum nach der Wende
- Entwicklung von Mahlzeitenverhalten und Restaurantbesuchen
- Methodische Untersuchung der Ernährungssituation in Thüringen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den beobachteten Trend steigender Nachfrage nach Produkten aus der ehemaligen DDR, besonders in Thüringen, als Ausgangspunkt der Studie. Sie hebt die Bedeutung der Ernährungsforschung und die kulturelle Bedingtheit des Ernährungsverhaltens hervor.
2. Ernährungswandel in der BRD und der DDR sowie das Ernährungs- und Mahlzeitenverhalten in der DDR vor der Wiedervereinigung: Dieses Kapitel vergleicht den Ernährungswandel in der BRD und der DDR im Zeitraum von den Nachkriegsjahren bis zur Wiedervereinigung. Es analysiert Tendenzen im Lebensmittelverbrauch, staatliche Einflüsse auf die Ernährung in der DDR, die Eigenproduktion von Nahrungsmitteln, sowie das Mahlzeitenverhalten inklusive Restaurantbesuche und Gemeinschaftsverpflegung in beiden deutschen Staaten. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der Entwicklungen in Ost und West.
3. Ernährungs- und Mahlzeitenverhalten in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung und Identität als Einflussfaktor: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung des Ernährungs- und Mahlzeitenverhaltens in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung. Es analysiert die Rolle der Identität, insbesondere die Herausbildung einer „Ost-Identität“ und deren Einfluss auf die Wertschätzung von DDR-Produkten und den Konsum regionaler Lebensmittel. Zusätzlich werden Veränderungen im Ernährungs- und Mahlzeitenverhalten, wie Restaurantbesuche und Gemeinschaftsverpflegung, nach der Wiedervereinigung untersucht.
Schlüsselwörter
Ernährungswandel, DDR, Wiedervereinigung, Thüringen, Ost-Identität, Lebensmittelkonsum, Mahlzeitenverhalten, Restaurantbesuche, Gemeinschaftsverpflegung, regionale Produkte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Ernährungswandel in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Ernährungssituation und des Ernährungs- und Mahlzeitenverhaltens in Thüringen nach der deutschen Wiedervereinigung. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Einfluss von Identität und regionalen Produkten auf das Essverhalten der Bevölkerung.
Welche Zeiträume werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet den Ernährungswandel sowohl in der BRD als auch in der DDR von der Nachkriegszeit bis zur Wiedervereinigung und analysiert die Entwicklungen in den neuen Bundesländern danach.
Welche Aspekte des Ernährungsverhaltens werden untersucht?
Untersucht werden der Lebensmittelkonsum, die Eigenproduktion von Nahrungsmitteln, der Mahlzeitenrhythmus, Restaurantbesuche, Gemeinschaftsverpflegung und der Einfluss staatlicher Maßnahmen auf die Ernährung (insbesondere in der DDR).
Welche Rolle spielt die Identität?
Die Arbeit analysiert die Rolle der Identität, insbesondere die Herausbildung einer „Ost-Identität“ und deren Einfluss auf die Wertschätzung von DDR-Produkten und den Konsum regionaler Lebensmittel.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Einleitung, Ernährungswandel in der BRD und DDR vor der Wiedervereinigung und Ernährungs- und Mahlzeitenverhalten in den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung. Jedes Kapitel untergliedert sich in weitere Unterkapitel, die detailliert auf die jeweiligen Aspekte eingehen.
Welche Methode wurde in der Studie angewendet?
Im Kapitel 3.3.1 wird das methodische Vorgehen zur Untersuchung der Ernährungssituation in Thüringen beschrieben. Weitere Details zur Methodik sind im vollständigen Text der Studie enthalten.
Welche konkreten Veränderungen des Ernährungsverhaltens werden untersucht?
Die Studie untersucht Veränderungen im Lebensmittelverbrauch, der Herkunft der Lebensmittel, der Eigenproduktion, Restaurantbesuchen, Gemeinschaftsverpflegung, dem Mahlzeitenrhythmus und Kochgewohnheiten sowie Essenseinladungen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Konkrete Schlussfolgerungen sind im vollständigen Text der Studie nachzulesen. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet bereits einen ersten Überblick über die Ergebnisse.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Ernährungswandel, DDR, Wiedervereinigung, Thüringen, Ost-Identität, Lebensmittelkonsum, Mahlzeitenverhalten, Restaurantbesuche, Gemeinschaftsverpflegung, regionale Produkte.
Wo finde ich den vollständigen Text?
Der vollständige Text dieser Studie ist bei der jeweiligen Publikationsgesellschaft erhältlich.
- Citar trabajo
- Deike Eulenstein (Autor), 2004, Die Ernährungsweise und -situation in der DDR und die Veränderung nach der Wiedervereinigung am Beispiel Thüringens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32963