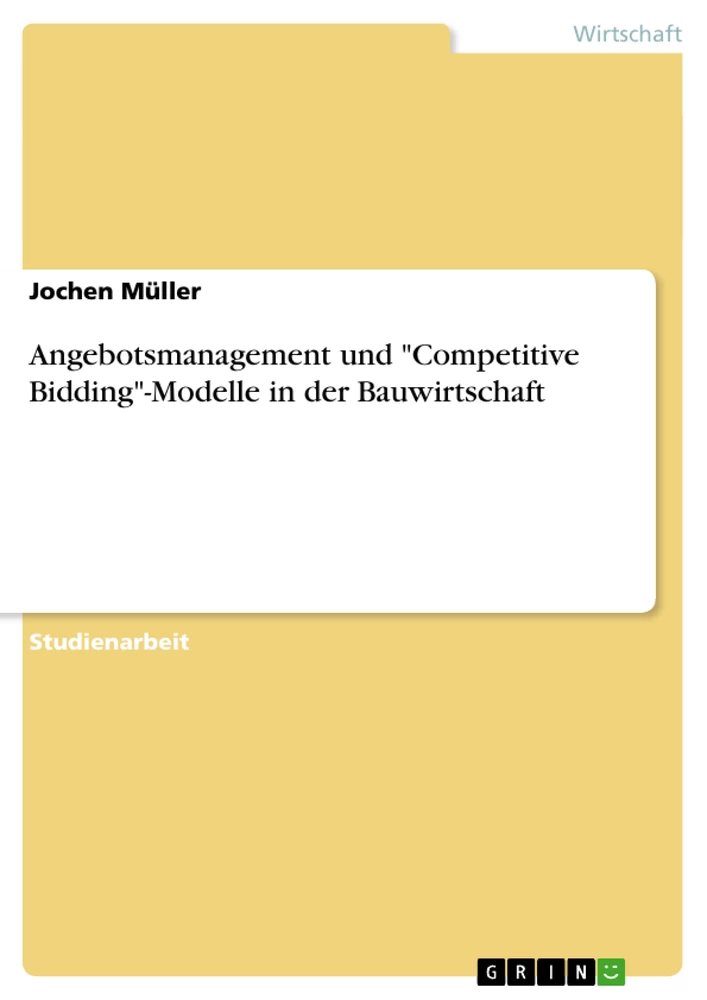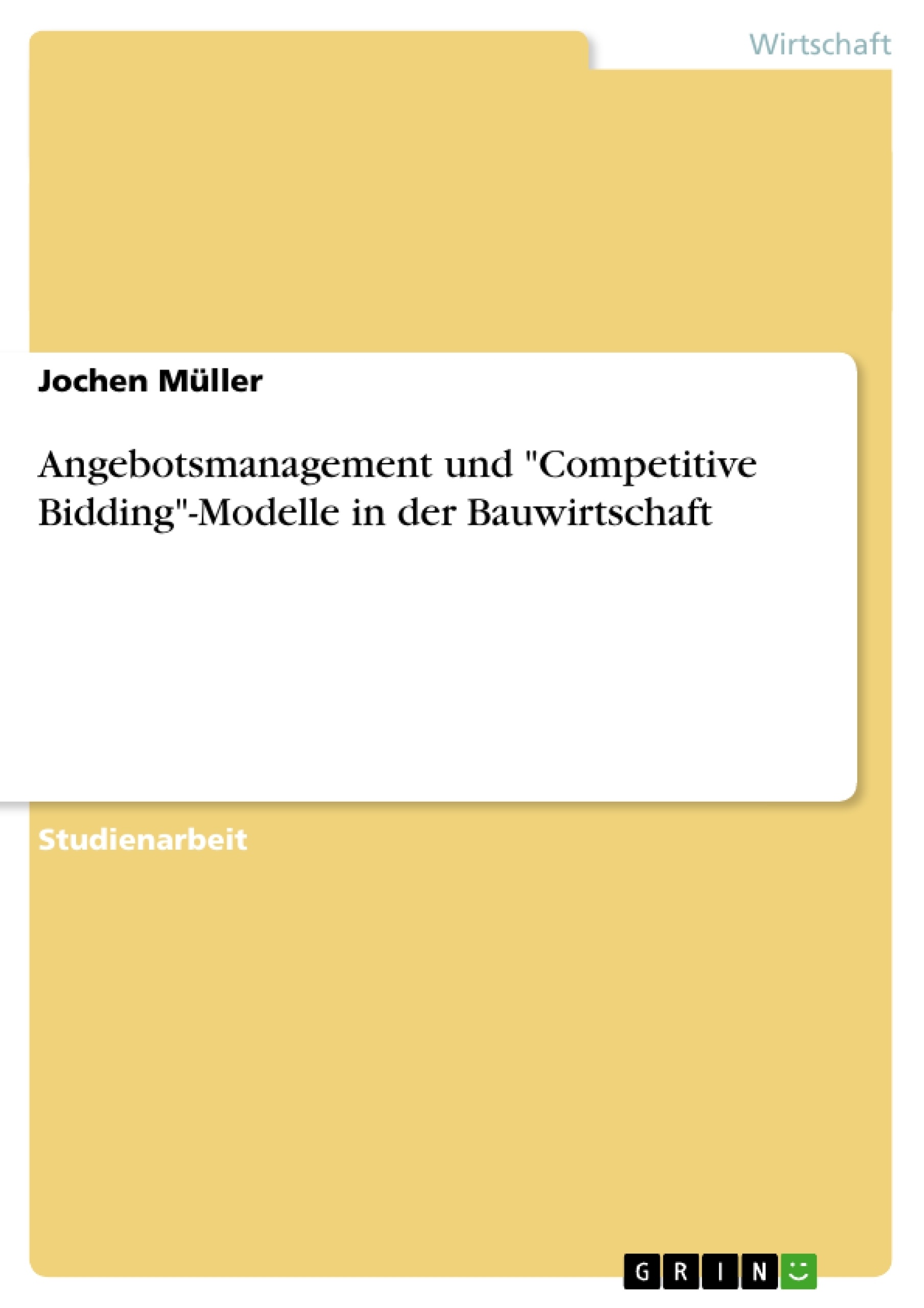Der Begriff des "Competitive Bidding" bezeichnet das Bieten unter Wettbewerbsbedingungen, d. h. das Formulieren von Angeboten in der Situation der Ausschreibung (Submission). Kennzeichnend für diese Situation ist das Bieten mehrerer Wettbewerber, wobei Preisentscheidungen im Rahmen einer Ausschreibung als endgültig anzusehen sind. "Competitive Bidding" in der Bauwirtschaft bezieht sich somit auf die Abgabe von Angeboten und Angebotspreisen für eine qualitativ und quantitativ präzisierte Bauleistung. Der Bieter steht dabei einerseits vor der Frage, ob er überhaupt bieten will (problem of bidding), andererseits vor der Frage, wie ein Angebot zu gestalten ist, das zugleich Konkurrenzangebote schlägt und einen ausreichenden oder optimalen Gewinn mit sich bringt (bidding problem). Die Problemstellung des bidding problem legen de Neufville, Hani und Lesage folgendermaßen dar:
A bidder must, first of all, develop a good estimate of the actual costs of construction, properly accounting for all the uncertainties in the price of labour and materials, the quantities required, and the difficulties. To obtain a worthwhile contract, he must in addition outguess his competitors and should do so at the least cost to himself. If his bid is too high, he fails to get the contract and loses the time and money spent on preparing the proposal. When he bids much lower than his rivals, he loses again. This time he obtains the contract, but has undertaken to fulfill it at a price far lower than necessary. [...] A good bid will both allow for a decent profit and yet be fractionally less than any others. Das Problem besteht demnach darin, daß ein hoher Angebotspreis mit einem hohen Deckungsbeitrag bzw. Gewinn verbunden ist, aber nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit, den Auftrag zu erhalten, während ein niedriger Preis mit einer hohen Zuschlagswahrscheinlichkeit verknüpft ist, aber nur einen geringen Gewinn oder sogar einen Verlust bedeuten kann. Die Festlegung des Angebotspreises zwischen dem im voraus unbekannten "Prohibitivpreis" des zweitbilligsten Anbieters und der durch die auftragsabhängigen Kosten bestimmten kurzfristigen Preisuntergrenze ist das Hauptproblem, das bei der Angebotsabgabe auf dem Baumarkt zu lösen ist. Jeder Wettbewerber muß folglich die Entscheidungsgröße "Zuschlagsprozentsatz" und die Erwartungsgröße "Erfolgswahrscheinlichkeit" unter Berücksichtigung seiner Zielsetzung und seiner Nutzenvorstellung gegeneinander abwägen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ausschreibungssituation, die Einflußfaktoren auf das Angebotsmanagement und die Grundzüge von "Competitive Bidding"-Modellen
- Ausgewählte "Competitive Bidding"-Modelle
- Wahrscheinlichkeitsmodelle – das Modell von Pin und Scott
- Die Modellierung des bidding problems
- Kritik
- Nutzenmodelle – das Modell von Dozzi, AbouRizk und Schroeder
- Die Modellierung des Problems der Nutzenmaximierung
- Kritik
- Resümee: Vergleich und Bewertung der Modelle
- Wahrscheinlichkeitsmodelle – das Modell von Pin und Scott
- Anhang
- Tabellen für k-Werte und cn-Werte
- Von-Mises-Verfahren und Berechnung von Eigenwerten und Eigenvektoren
- Literaturverzeichnis
- Verzeichnis der verwendeten Literatur
- Verzeichnis weiterer, nicht in die Arbeit eingegangener Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Anwendung von "Competitive Bidding"-Modellen im Angebotsmanagement der Bauwirtschaft. Ziel ist es, zwei ausgewählte Modelle – ein Wahrscheinlichkeitsmodell (Pin und Scott) und ein Nutzenmodell (Dozzi, AbouRizk und Schroeder) – vorzustellen, zu analysieren und hinsichtlich ihrer Praxistauglichkeit zu bewerten. Die Arbeit konzentriert sich auf die Modellkritik, sowohl im Hinblick auf interne Konsistenz und Annahmen als auch auf externe Faktoren wie Handhabbarkeit und Praxisrelevanz.
- Modellierung des "Bidding Problems" in der Bauwirtschaft
- Vergleich von Wahrscheinlichkeits- und Nutzenmodellen
- Bewertung der Praxistauglichkeit von "Competitive Bidding"-Modellen
- Analyse der Fehleranfälligkeit der Modelle
- Anwendung der Modelle auf konkrete Projekte
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des "Competitive Bidding" in der Bauwirtschaft ein und beschreibt das zentrale Problem: Die Bestimmung eines Angebotspreises, der sowohl Gewinnmaximierung als auch eine hohe Wahrscheinlichkeit des Auftragszuschlags ermöglicht. Es wird die Notwendigkeit der Modellierung des Entscheidungsprozesses betont und die Vorgehensweise der Arbeit skizziert, die darin besteht, zwei exemplarische Modelle zu analysieren und auf ihre Praxistauglichkeit hin zu untersuchen. Die komplexe Abwägung zwischen hohem Preis und Gewinn mit niedriger Zuschlagwahrscheinlichkeit versus niedrigem Preis und hoher Zuschlagwahrscheinlichkeit, aber möglichem Verlust, steht im Fokus.
Die Ausschreibungssituation, die Einflußfaktoren auf das Angebotsmanagement und die Grundzüge von "Competitive Bidding"-Modellen: Dieses Kapitel beschreibt den Kontext des "Competitive Bidding" im Bauwesen. Es beleuchtet die Einflüsse auf das Angebotsmanagement und die Herausforderungen bei der Preisfindung unter Wettbewerbsbedingungen. Die Schwierigkeit, alle relevanten Faktoren (Kosten, Risiken, Wettbewerb) präzise zu quantifizieren und in die Entscheidungsfindung einzubeziehen, wird hervorgehoben. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, subjektive Entscheidungen durch objektivere Methoden zu ersetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die beschriebenen Herausforderungen begründen die Notwendigkeit von Modellen zur Unterstützung der Entscheidungsfindung.
Ausgewählte "Competitive Bidding"-Modelle: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert zwei verschiedene "Competitive Bidding"-Modelle: das Wahrscheinlichkeitsmodell von Pin und Scott und das Nutzenmodell von Dozzi, AbouRizk und Schroeder. Für jedes Modell werden Gegenstand, Zielsetzung, Annahmen, und die mathematische Formulierung erläutert. Die Kapitel behandeln detailliert die Stärken und Schwächen der jeweiligen Modelle, wobei sowohl modellinterne (Konsistenz, Annahmen) als auch modellexterne (Praktikabilität, Anwendbarkeit) Kriterien berücksichtigt werden. Im Mittelpunkt steht ein kritischer Vergleich der beiden Modelle, um deren Vor- und Nachteile in Bezug auf die Praxisanwendung zu beleuchten. Die Analyse umfasst auch Sensitivitätsanalysen, um die Robustheit der Modelle gegenüber ungenauen Eingabedaten zu prüfen.
Schlüsselwörter
Competitive Bidding, Angebotsmanagement, Bauwirtschaft, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Nutzenmodelle, Entscheidungsfindung unter Unsicherheit, Modellkritik, Praxistauglichkeit, Kostenkalkulation, Risikomanagement, Gewinnmaximierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Competitive Bidding-Modelle im Angebotsmanagement der Bauwirtschaft
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Anwendung von "Competitive Bidding"-Modellen im Angebotsmanagement der Bauwirtschaft. Der Fokus liegt auf der Analyse und Bewertung der Praxistauglichkeit ausgewählter Modelle.
Welche Modelle werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit analysiert zwei "Competitive Bidding"-Modelle: ein Wahrscheinlichkeitsmodell von Pin und Scott und ein Nutzenmodell von Dozzi, AbouRizk und Schroeder. Diese werden hinsichtlich ihrer Stärken, Schwächen und Praxistauglichkeit verglichen.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Ziel ist es, die beiden ausgewählten Modelle vorzustellen, zu analysieren und ihre Praxistauglichkeit zu bewerten. Die Modellkritik, sowohl intern (Konsistenz, Annahmen) als auch extern (Handhabbarkeit, Praxisrelevanz), steht im Mittelpunkt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Modellierung des "Bidding Problems", den Vergleich von Wahrscheinlichkeits- und Nutzenmodellen, die Bewertung der Praxistauglichkeit, die Analyse der Fehleranfälligkeit und die Anwendung der Modelle auf konkrete Projekte. Die Einflüsse auf das Angebotsmanagement und die Herausforderungen der Preisfindung unter Wettbewerbsbedingungen werden ebenfalls beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist strukturiert in eine Einleitung, ein Kapitel zur Ausschreibungssituation und den Einflussfaktoren, ein Kapitel zu den ausgewählten "Competitive Bidding"-Modellen (mit detaillierter Analyse von Pin & Scott und Dozzi et al.), einen Anhang mit Tabellen und Berechnungsverfahren sowie ein Literaturverzeichnis.
Welche Kritikpunkte werden an den Modellen geäußert?
Die Arbeit kritisiert die Modelle sowohl hinsichtlich ihrer internen Konsistenz und Annahmen als auch bezüglich ihrer externen Faktoren wie Handhabbarkeit und Praxisrelevanz. Es werden Sensitivitätsanalysen durchgeführt, um die Robustheit der Modelle gegenüber ungenauen Eingabedaten zu prüfen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Competitive Bidding, Angebotsmanagement, Bauwirtschaft, Wahrscheinlichkeitsmodelle, Nutzenmodelle, Entscheidungsfindung unter Unsicherheit, Modellkritik, Praxistauglichkeit, Kostenkalkulation, Risikomanagement, Gewinnmaximierung.
Wo finde ich weitere Informationen?
Das Literaturverzeichnis enthält sowohl die verwendete als auch weitere, nicht in die Arbeit eingegangene Literatur.
Was ist das zentrale Problem, das die Arbeit behandelt?
Das zentrale Problem ist die Bestimmung eines Angebotspreises, der sowohl Gewinnmaximierung als auch eine hohe Wahrscheinlichkeit des Auftragszuschlags ermöglicht. Die Arbeit betont die Notwendigkeit, den komplexen Abwägungsprozess zwischen hohem Preis mit niedriger Zuschlagwahrscheinlichkeit und niedrigem Preis mit hoher Zuschlagwahrscheinlichkeit, aber möglichem Verlust, zu modellieren.
- Arbeit zitieren
- Jochen Müller (Autor:in), 1999, Angebotsmanagement und "Competitive Bidding"-Modelle in der Bauwirtschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33206