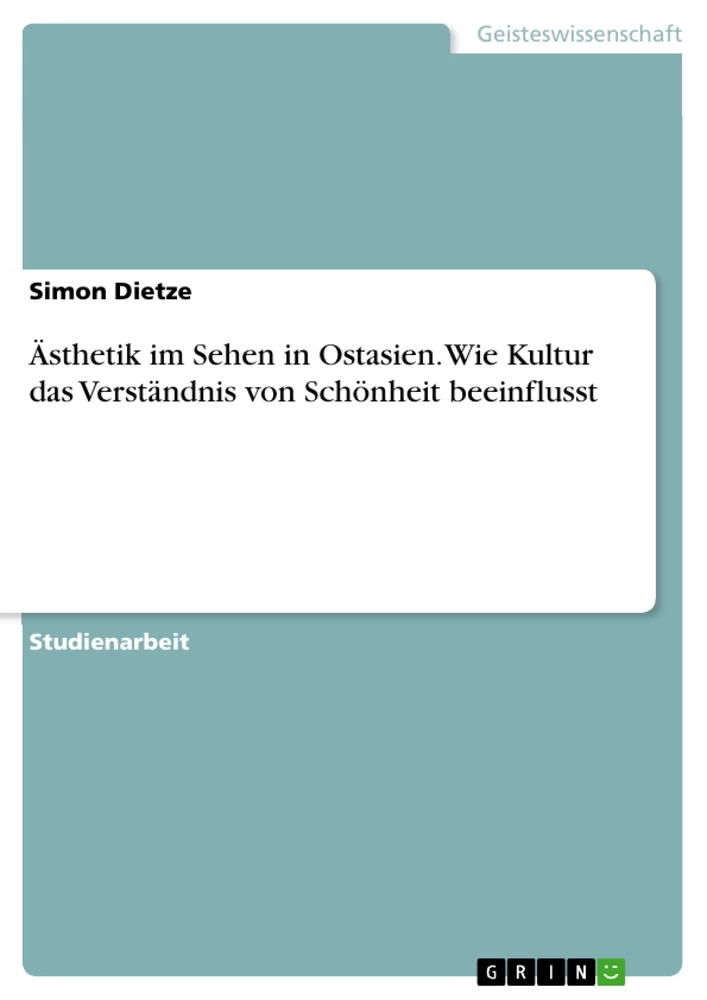In unserem Projektmodul zur „Ostasiatischen Ästhetik und Philosophie“ diskutierten wir zum Einstieg die „Komparative Ästhetik“ von Rolf Elberfeld. Diese möchte ich in meiner Verschriftlichung ebenfalls für den Einstieg in das Thema nutzen, um vor allem den kulturellen Einfluss auf die Ästhetik deutlich zu machen. Danach wird die Ästhetik im Sehen zentral. Dabei geht es speziell um die Annahme der Schönheit, die sich beispielsweise auch im Prinzip der Leere, der Anordnung eines Parks oder auch in Mustern verbergen kann. Es soll ein kleiner Einblick in die Annahme der Schönheit in Ostasien sein. Bevor ich im Fazit noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasse, ist auch die Kunst der Fadheit Thema.
Der Begriff der Ästhetik lässt sich nicht einfach definieren. Er unterliegt stetig dem historischen Wandel und wird je nach Kultur unterschiedlich aufgefasst. In der europäischen Kultur ist die Ästhetik als Disziplin erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts aufgetaucht und verknüpfte dabei die Wissenschaft mit der sinnlichen Erkenntnis. Ausgangspunkt ist dabei immer der altgriechische Begriff αἴσθησις (aisthesis), der wörtlich mit „Wahrnehmung“ oder „Empfindung“ übersetzt wird.
Inhaltsverzeichnis (Inhaltsverzeichnis)
- 1. Einleitung
- 2. Komparative Ästhetik
- 3. Die Ästhetik im Sehen
- 3.1 Die Betrachtung der chinesischen Gartenkunst
- 3.2 Das Prinzip der Leere
- 3.3 Von Mustern der Regelmäßigkeit zur Unregelmäßigkeit
- 3.4 Die Freiheit in der Fadheit entdecken
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Der Reflexionsbericht beleuchtet die Besonderheiten der ostasiatischen Ästhetik, insbesondere im Bereich des Sehens, im Kontext des Projektmoduls „Ostasiatische Ästhetik“ an der Bauhaus-Universität Weimar.
- Komparative Ästhetik: Unterschiede in der Definition und Wahrnehmung von Ästhetik zwischen Ostasien und Europa
- Ästhetik des Sehens: Betrachtung chinesischer Gartenkunst als Paradigma für ostasiatische Wahrnehmung
- Das Prinzip der Leere: Die Bedeutung von Leere als Ausdruck höchster Erkenntnis und Vollkommenheit im Zen-Buddhismus
- Muster und Unregelmäßigkeit: Die Rolle von Regelmäßigkeit und Unregelmäßigkeit in der ostasiatischen Ästhetik
- Die Fadheit: Die Schönheit des Einfachen und Natürlichen in der Kunst der Fadheit
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung beleuchtet die vielschichtige Bedeutung des Begriffs „Ästhetik“ und dessen Wandel im Laufe der Geschichte.
Das Kapitel „Komparative Ästhetik“ untersucht die Unterschiede in der Wahrnehmung von Ästhetik zwischen Ostasien und Europa und zeigt, wie kulturelle Einflüsse die ästhetischen Schwerpunkte prägen.
Im Abschnitt „Die Ästhetik im Sehen“ wird die chinesische Gartenkunst als Beispiel für das ostasiatische Prinzip der Betrachtungsweise und die Rolle des Sehens in der Ästhetik vorgestellt. Die Analyse des Prinzips der Leere untersucht die Bedeutung von Leerheit als Ausdruck von Erkenntnis und Vollkommenheit, insbesondere im Kontext des Zen-Buddhismus.
Das Kapitel „Von Mustern der Regelmäßigkeit zur Unregelmäßigkeit“ analysiert die Bedeutung von Mustern in der ostasiatischen Ästhetik und stellt den Kontrast zwischen der Regelmäßigkeit und der Unregelmäßigkeit als Ausdruck von Freiheit und individueller Gestaltung dar.
Der Abschnitt „Die Freiheit in der Fadheit entdecken“ untersucht die ästhetischen Eigenschaften der Kunst der Fadheit und zeigt, wie sie die Schönheit des Einfachen und Natürlichen widerspiegelt und den Betrachter zu Ruhe und Meditation einlädt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Ostasiatische Ästhetik, Komparative Ästhetik, Sehen, Gartenkunst, Prinzip der Leere, Muster, Unregelmäßigkeit, Fadheit, Zen-Buddhismus, Tao, Intuition, Freiheit, Kanso, Fukinsei, Yûgen, Seijaku, Kokô, Neutralität.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Komparative Ästhetik“?
Die komparative Ästhetik (nach Rolf Elberfeld) vergleicht die unterschiedliche Wahrnehmung und Definition von Schönheit und Kunst zwischen verschiedenen Kulturen, hier speziell zwischen Europa und Ostasien.
Welche Rolle spielt das „Prinzip der Leere“ in der ostasiatischen Ästhetik?
Im Zen-Buddhismus gilt die Leere als Ausdruck höchster Erkenntnis und Vollkommenheit. Sie ist kein Mangel, sondern ein wesentliches Gestaltungselement in der Kunst und Architektur.
Was charakterisiert die chinesische Gartenkunst?
Die Gartenkunst dient als Paradigma für die ostasiatische Wahrnehmung. Sie nutzt Anordnungen, die Schönheit oft im Verborgenen oder in der bewussten Unregelmäßigkeit suchen.
Was ist die „Kunst der Fadheit“?
Fadheit beschreibt die Schönheit des Einfachen, Neutralen und Natürlichen. Sie lädt den Betrachter zu Ruhe, Meditation und dem Entdecken von Freiheit im Unaufdringlichen ein.
Wie unterscheidet sich die ostasiatische von der europäischen Ästhetik?
Während die europäische Ästhetik oft wissenschaftlich-sinnlich geprägt ist, basiert die ostasiatische stärker auf Intuition, Naturverbundenheit und Begriffen wie Kanso (Einfachheit) oder Fukinsei (Asymmetrie).
- Citation du texte
- Simon Dietze (Auteur), 2014, Ästhetik im Sehen in Ostasien. Wie Kultur das Verständnis von Schönheit beeinflusst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334330