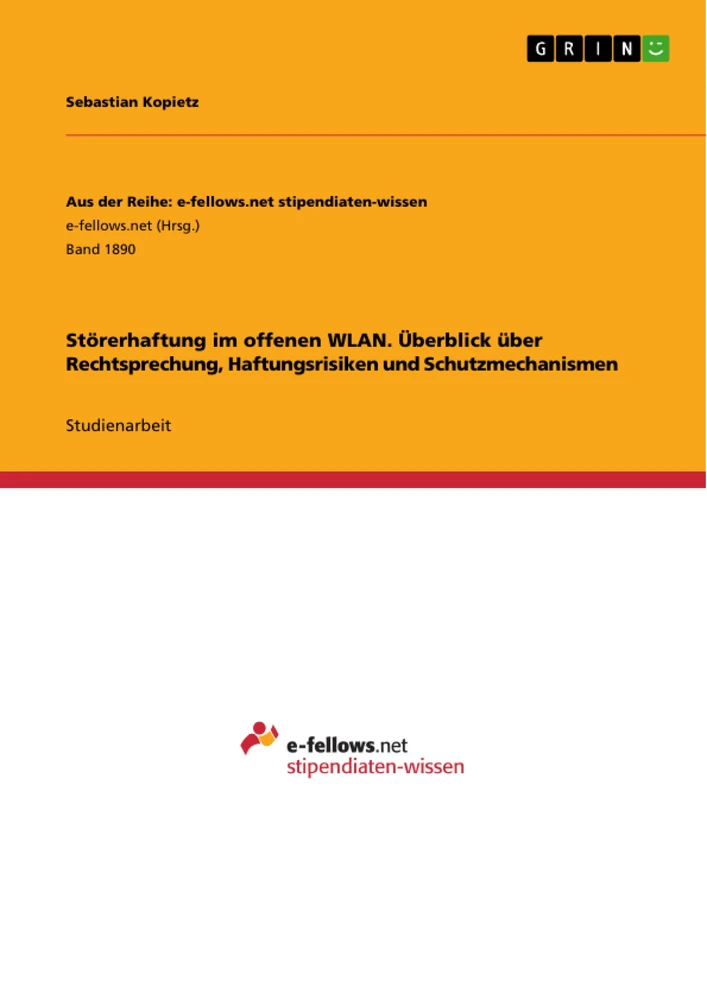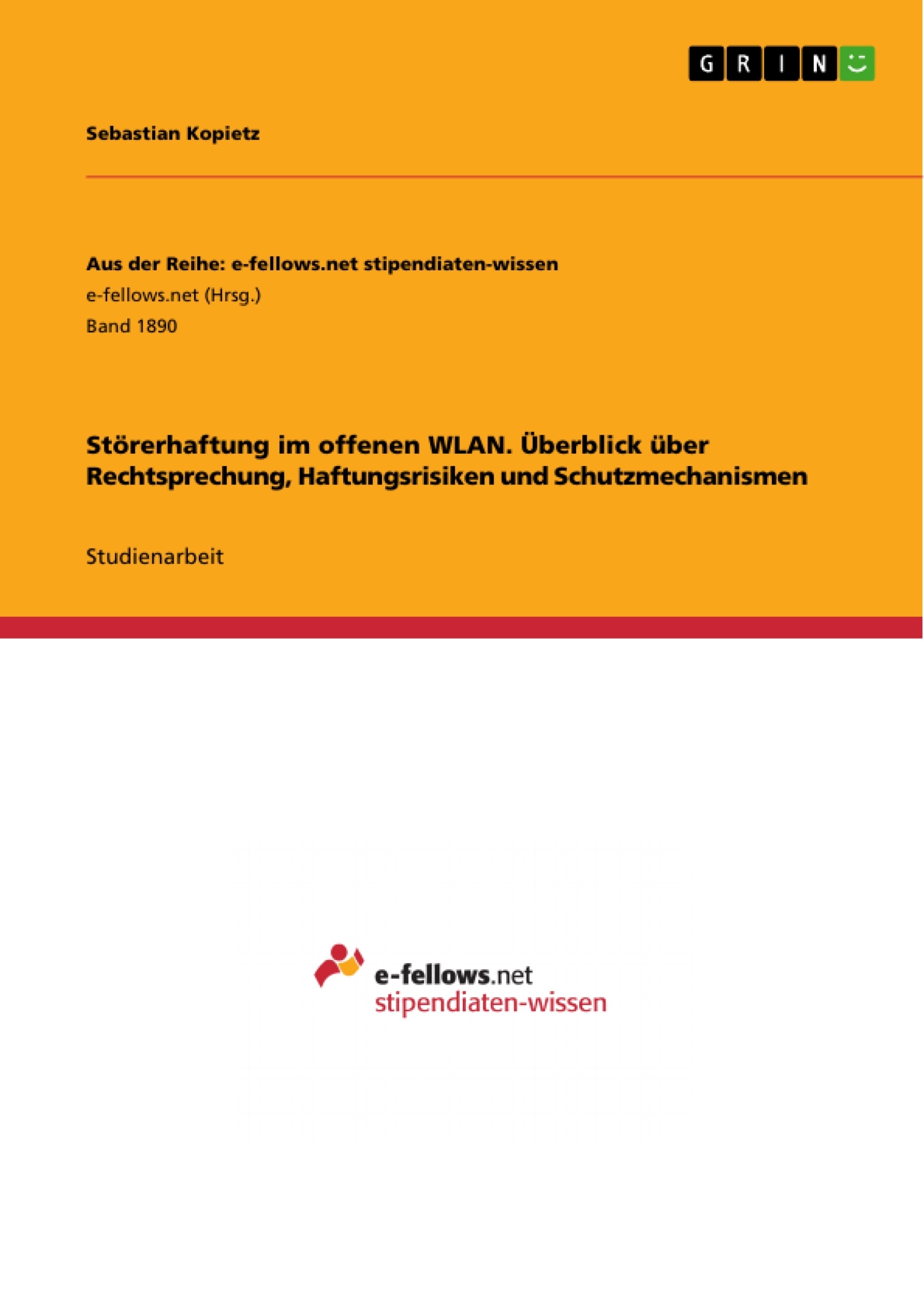Mobile Devices wie Smartphones und Tablets sind aus der heutigen Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Die Smartphone-Nutzung ist alleine in Deutschland von 2013 bis 2014 um 25% gestiegen, bei Tablets lag der Anstieg im gleichen Zeitraum bei 33%. Solche Mobile Devices zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass es mit ihnen möglich ist im Internet zu surfen - überall wo man Funkempfang hat. Mit einer erhöhten Verbreitung an Mobile Devices ist auch die Nachfrage an frei verfügbarem Internet über WLAN (Wireless Local Area Network) gestiegen. Um diese Nachfrage für ihre eigenen Geschäftszwecke zu nutzen haben Cafés, Bars, Restaurants, Hotels und andere Einrichtungen damit begonnen, ihren Kunden als zusätzliche Serviceleistung kostenfreies WLAN zur Verfügung zu stellen. Allerdings kommt es auch vor, dass von Dritten Rechtsverletzungen über diese bereitgestellten Anschlüsse begangen werden.
In den letzten vier Jahren gab es zu dieser Rechtsthematik, der sogenannten Störerhaftung, mehrere Urteile. Hierbei handelt es sich um ein intensiv diskutiertes Thema des IT-Rechts, bei dem die Frage zu beantworten ist, inwieweit der Betreiber eines WLAN für Rechtsverletzungen durch unbekannte Dritte haftbar gemacht werden kann? Mögliche Rechtsverletzungen sind beispielweise die Verbreitung von urheberrechtlich geschütztem Material oder das Eindringen in fremde Computernetzwerke.
Immer häufiger werden die Betreiber öffentlicher WLAN-Netzwerke aber auch Privatpersonen von Rechtsanwaltskanzleien abgemahnt. Es wird zur Unterlassung und zur Zahlung eines Pauschalbetrages aufgefordert. Den abmahnenden Kanzleien kommt es entgegen, das es seit 2008 leichter geworden ist an die persönlichen Daten der anonymen IP-Adressen zu gelangen, da man nun im Sammelverfahren Auskünfte gegenüber den Providern erwirken kann.
In dieser Arbeit wird das Thema Störerhaftung näher untersucht. Zu Beginn wird erläutert, um was es sich bei der Störerhaftung im juristischen Sinne genauer handelt und welche Pflichten es bei der Bereitstellung eines WLAN-Netzwerkes in Deutschland gibt. Anhand einiger wichtiger Fälle der herrschenden Rechtsprechung werden Möglichkeiten der Absicherung von WLAN-Netzwerken dargestellt. Abschließend folgt einem kurzen Fazit zur aktuellen Situation ein Ausblick, da auch der Gesetzgeber aktuell darüber nachdenkt das Thema durch Anpassung der Gesetze zu entschärfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Betrieb eines WLAN-Netzwerkes im rechtlichen Kontext
- Berücksichtigung des TKG und des TMG
- Abgrenzung Bestandsdaten und Verkehrsdaten
- Abgrenzung Täterhaftung und Teilnehmerhaftung zur Störerhaftung
- Exkurs: Einbeziehung des Urherberrechtsgesetzes in die Thematik der Störerhaftung
- Die Privilegierung der §§ 8, 10 TMG für Access- und Host-Provider
- Zusammenfassung des Kapitels
- Haftungsrisiken für WLAN-Betreiber und herrschende Rechtsprechung
- „Sommer unseres Lebens“, Urteil des BGH vom 12.05.2010
- WLAN in einem Internet-Café, Urteil des LG Hamburg vom 25.11.2010
- WLAN in einem Hotel, Urteil des AG Hamburg-Mitte vom 10.06.2014
- Schutzmechanismen für ein geringeres Haftungsrisiko
- Schutzmaßnahmen für Betreiber eines privaten WLANS
- Schutzmaßnahmen für Betreiber eines geschäftsmäßigen WLAN-Netzwerks
- Unentgeltliche WLAN-Angebote aus datenschutzrechtlicher Sicht
- Entgeltliche WLAN-Angebote aus datenschutzrechtlicher Sicht
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Störerhaftung im Zusammenhang mit dem Betrieb von WLAN-Netzwerken. Sie analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen, die für WLAN-Betreiber relevant sind, und beleuchtet die Haftungsrisiken, die durch Rechtsverletzungen von Dritten über das bereitgestellte WLAN entstehen können.
- Rechtliche Rahmenbedingungen für den Betrieb von WLAN-Netzwerken
- Haftungsrisiken für WLAN-Betreiber
- Abgrenzung von Täterhaftung, Teilnehmerhaftung und Störerhaftung
- Schutzmechanismen zur Minimierung des Haftungsrisikos
- Aktuelle Rechtsprechung und zukünftige Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und erläutert die Bedeutung des Themas im Hinblick auf die steigende Nutzung von WLAN-Netzwerken. Kapitel 2 behandelt die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Betrieb von WLAN-Netzwerken, wobei das Telekommunikationsgesetz (TKG), das Telemediengesetz (TMG) und das Urheberrechtsgesetz (UrhG) im Mittelpunkt stehen. Es werden wichtige Begrifflichkeiten wie Bestandsdaten und Verkehrsdaten sowie die unterschiedlichen Haftungsformen, die im Zusammenhang mit der Störerhaftung relevant sind, definiert. Kapitel 3 beleuchtet die Haftungsrisiken für WLAN-Betreiber, wobei wichtige Urteile des Bundesgerichtshofs (BGH) und anderer Gerichte analysiert werden.
Schlüsselwörter
Störerhaftung, WLAN, Telekommunikationsgesetz (TKG), Telemediengesetz (TMG), Urheberrechtsgesetz (UrhG), Haftungsrisiko, Rechtssicherheit, Datenschutz, Bestandsdaten, Verkehrsdaten, Access-Provider, Host-Provider.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Störerhaftung" bei WLAN-Anschlüssen?
Es beschreibt die Haftung eines Anschlussinhabers für Rechtsverletzungen (z. B. Filesharing), die Dritte über sein WLAN begehen.
Müssen Cafés oder Hotels für das Surfen ihrer Gäste haften?
Die Rechtsprechung unterscheidet zwischen privaten und geschäftsmäßigen Betreibern, wobei letztere unter bestimmten Bedingungen privilegiert sein können (Access-Provider-Privileg).
Was besagt das BGH-Urteil "Sommer unseres Lebens"?
Privatpersonen müssen ihr WLAN durch marktübliche Sicherungsmaßnahmen (wie Passwörter) schützen, um nicht als Störer zu haften.
Welche Gesetze sind für WLAN-Betreiber relevant?
Zentral sind das Telemediengesetz (TMG), das Telekommunikationsgesetz (TKG) und das Urheberrechtsgesetz (UrhG).
Wie können Betreiber ihr Haftungsrisiko minimieren?
Durch technische Schutzmaßnahmen, Vorschaltseiten mit Nutzungsbedingungen (AGB) und die Verschlüsselung des Netzwerks.
- Citation du texte
- Sebastian Kopietz (Auteur), 2015, Störerhaftung im offenen WLAN. Überblick über Rechtsprechung, Haftungsrisiken und Schutzmechanismen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334639