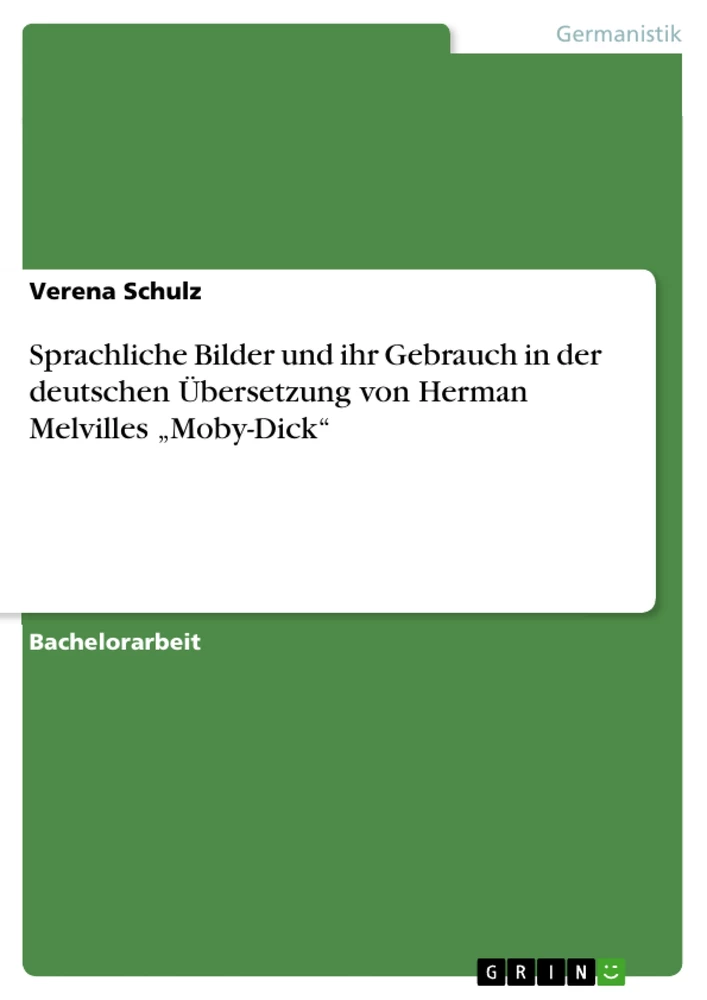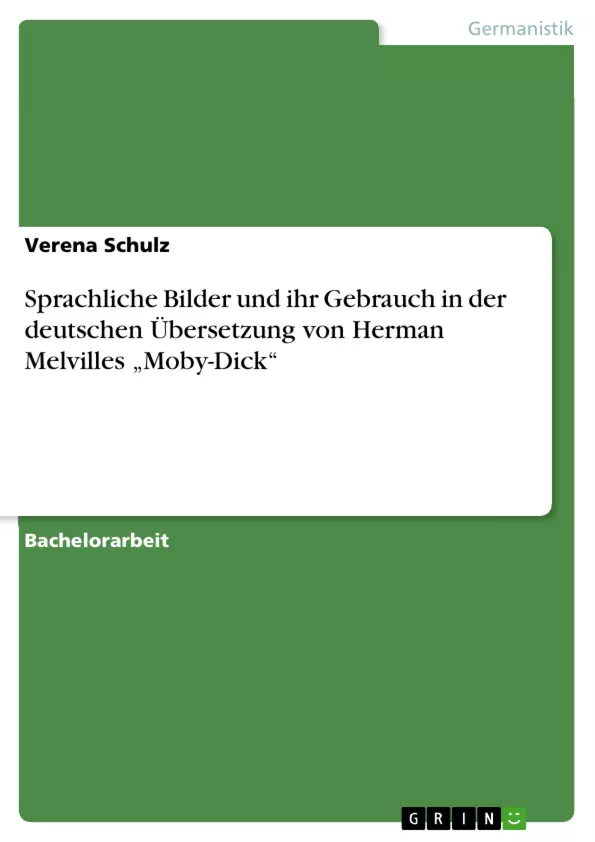Es ist das Abenteuer des wahnwitzigen Kapitäns Ahab und seiner Mannschaft, durch Rache getrieben auf ewiger Suche nach dem Wal, der ihm einst das Bein genommen hat. Es ist das Abenteuer des jungen Ishmael, der seiner Melancholie entfliehen möchte und sich entschließt, als Matrose anzuheuern. Und es ist das Abenteuer von Moby-Dick, dem gesuchten und gefürchteten Wal, der zugleich den Mittelpunkt eines philosophischen Abenteuerromans und auch wissenschaftlichen Sachbuchs bildet.
1851 veröffentlicht, stieß Herman Melvilles Roman „Moby-Dick“ auf schlechte Rezensionen und Ablehnung. Durch Melvilles mehrdeutige Weise, über traditionelle Religion zu spotten und philosophische Ansätze einfließen zu lassen, traf „Moby-Dick“ auf Verständnislosigkeit unter den Kritikern. Seine neuartige Stilistik, Wortspiele und sein anschaulicher Ausdruck waren neues Terrain für die Leser. Heute hingegen gehört das Buch nicht nur in der deutschsprachigen Literaturwelt zu den Klassikern, auch weltweit wird es als Meisterstück eines Jahrhunderts betitelt. Durch Melvilles metaphernreichen Ausdruck und Bildlichkeit steuert der Künstler die Rezeption des Romans und lässt somit die Intention des Werkes sichten. Was vor 150 Jahren noch auf Ablehnung stieß, feiert heute große künstlerische Bewunderung.
Die Bildlichkeit, die in der Erzählung „Moby-Dicks“ zu finden ist, eignet sich hervorragend für eine linguistische Analyse. Diese wirft Fragen auf, die es zu beantworten gilt: Welche bildlichen Entitäten stehen im Vordergrund? Lassen die sprachlichen Bilder Besonderheiten erkennen? Wirken sich diese auf den Gebrauch sprachlicher Bilder aus? Mit welcher Intention nutzt Herman Melville sprachliche Bilder? Gibt es einen Zusammenhang zwischen den genutzten sprachlichen Bildern und der schlechten Rezensionen der damaligen Leser? Und entsteht durch die große Bildlichkeit in Melvilles Roman ein Metaphorisierungstext?
Diese Arbeit hat die Aufgabe, sprachliche Bilder und ihren Gebrauch in der deutschen Übersetzung von Herman Melvilles „Moby-Dick“ zu analysieren, einen Überblick über das Buch sowie über sprachwissenschaftliche Grundlagen von sprachlichen Bildern zu schaffen und eine linguistische Analyse auszuführen, die Metaphern und Vergleiche sinnvoll aufgliedert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen über die Thematik Sprachlicher Bilder
- Basisaussagen Metaphern und Vergleiche
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Metaphern und Vergleichen
- Funktionen von Metaphern und Vergleichen
- Der Begriff des sprachlichen Bildes
- Die Edition als Grundlage dieser Arbeit
- Handlung
- Methodische Grundlagen zur empirischen Analyse
- Methodisches Vorgehen
- Problematik
- Analyse der sprachlichen Bilder in „Moby-Dick“
- Bildliche Darstellung von ausgewählten Zielbereichen
- Der Wal
- Das Schiff
- Die Waljägerfahrt
- Gefühle/Zustände
- Sprachliche Bilder im Paratext
- Markante Ursprungsbereiche
- Pflanzen
- Andere Kulturen
- Charakterisierung der handelnden Figuren durch sprachliche Bilder
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Bildliche Darstellung von ausgewählten Zielbereichen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Gebrauch sprachlicher Bilder in Herman Melvilles „Moby-Dick“, insbesondere Metaphern und Vergleiche. Ziel ist es, die Funktionen dieser Bilder im Roman zu beleuchten und ihren Einfluss auf die Rezeption zu untersuchen. Die Analyse betrachtet die gewählte Edition, die Handlung des Romans und die methodischen Herausforderungen der Untersuchung.
- Analyse sprachlicher Bilder (Metaphern und Vergleiche) in „Moby-Dick“
- Untersuchung der Funktionen dieser Bilder in Bezug auf die Erzählung
- Rezeption und Interpretation der Bilder im Kontext des Romans
- Methodische Aspekte der linguistischen Analyse
- Bedeutung der Edition für die Analyse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, stellt den Roman „Moby-Dick“ und dessen Rezeptionsgeschichte vor. Sie beschreibt den Fokus der Arbeit auf die sprachlichen Bilder und deren Bedeutung für das Verständnis des Romans. Es wird die Frage nach dem Einfluss der bildhaften Sprache auf die damalige und heutige Rezeption des Werkes aufgeworfen, und die methodischen Ansätze der Arbeit werden kurz umrissen.
Grundlagen über die Thematik Sprachlicher Bilder: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse sprachlicher Bilder dar. Es werden Basisaussagen zu Metaphern und Vergleichen getroffen, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede beleuchtet und ihre Funktionen erläutert. Der Begriff des „sprachlichen Bildes“ wird definiert und eingegrenzt, um eine klare Basis für die folgende Analyse zu schaffen. Der Fokus liegt auf dem kognitiven Ansatz, der die Struktur und Funktion von Metaphern und Vergleichen im Denken und Handeln erklärt.
Die Edition als Grundlage dieser Arbeit: Dieses Kapitel erläutert die Wahl der spezifischen Edition von „Moby-Dick“ für diese Arbeit und begründet die Entscheidung für die Übersetzung von Friedhelm Rathjen. Es werden die relevanten Kriterien dargelegt, die bei der Auswahl der Edition berücksichtigt wurden, und es wird die Bedeutung der Edition für den Erfolg der Analyse unterstrichen.
Handlung: Die Zusammenfassung der Handlung von „Moby-Dick“ dient als Kontext für die anschließende Analyse der sprachlichen Bilder. Die wichtigsten Handlungsstränge, Charaktere und der zentrale Konflikt werden vorgestellt. Der Abschnitt zielt darauf ab, dem Leser ein umfassendes Verständnis des Handlungsverlaufs zu vermitteln, ohne ins Detail der einzelnen Ereignisse zu gehen. Der Fokus liegt auf der Struktur und den zentralen Motiven der Erzählung.
Methodische Grundlagen zur empirischen Analyse: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Vorgehensweisen und die damit verbundenen Probleme bei der empirischen Analyse der sprachlichen Bilder in „Moby-Dick“. Es werden die gewählten Methoden detailliert erläutert und mögliche Schwierigkeiten und Einschränkungen der Analyse angesprochen. Die Kapitel erläutert das methodische Vorgehen, um die empirische Analyse der sprachlichen Bilder in „Moby-Dick“ durchzuführen. Es wird auf potentielle Probleme und Herausforderungen der gewählten Methode eingegangen.
Analyse der sprachlichen Bilder in „Moby-Dick“: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und präsentiert die Ergebnisse der empirischen Analyse der sprachlichen Bilder in „Moby-Dick“. Es untersucht verschiedene Aspekte der sprachlichen Bilder, wie z.B. die bildliche Darstellung von zentralen Themen, die Verwendung sprachlicher Bilder im Paratext und die Charakterisierung der Figuren durch sprachliche Bilder. Die Analyse wird detailliert erläutert und die Ergebnisse werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Moby-Dick, Herman Melville, Sprachliche Bilder, Metapher, Vergleich, Linguistische Analyse, Empirische Forschung, Rezeption, Bildlichkeit, Kognitive Metapherntheorie, Literaturwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen zu der Arbeit über sprachliche Bilder in Herman Melvilles "Moby-Dick"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Gebrauch sprachlicher Bilder, insbesondere Metaphern und Vergleiche, in Herman Melvilles Roman "Moby-Dick". Sie untersucht deren Funktionen im Roman und deren Einfluss auf die Rezeption des Werkes.
Welche Aspekte werden in der Analyse betrachtet?
Die Analyse umfasst die gewählte Edition von "Moby-Dick", die Handlung des Romans, methodische Herausforderungen der Untersuchung, die bildliche Darstellung verschiedener Themen (Wal, Schiff, Waljägerfahrt, Gefühle/Zustände), die Verwendung sprachlicher Bilder im Paratext, markante Ursprungsbereiche der Bilder (Pflanzen, andere Kulturen) und die Charakterisierung von Figuren durch sprachliche Bilder.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit beschreibt detailliert die methodischen Vorgehensweisen und die damit verbundenen Probleme der empirischen Analyse sprachlicher Bilder. Es wird auf das methodische Vorgehen, potentielle Probleme und Herausforderungen eingegangen. Der Fokus liegt auf einem kognitiven Ansatz, der die Struktur und Funktion von Metaphern und Vergleichen im Denken und Handeln erklärt.
Welche Edition von "Moby-Dick" wurde verwendet?
Die Arbeit begründet die Wahl der spezifischen Edition von "Moby-Dick" und die Entscheidung für eine bestimmte Übersetzung (Friedhelm Rathjen). Die relevanten Auswahlkriterien werden dargelegt und die Bedeutung der Edition für den Analyseerfolg unterstrichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Grundlagen sprachlicher Bilder, ein Kapitel zur verwendeten Edition, eine Handlungszusammenfassung, ein Kapitel zu den methodischen Grundlagen, die Hauptanalyse der sprachlichen Bilder in "Moby-Dick" und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind ebenfalls enthalten.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die Arbeit untersucht die Funktionen sprachlicher Bilder in "Moby-Dick", ihren Einfluss auf die Rezeption (damals und heute) und die methodischen Aspekte der linguistischen Analyse. Die Bedeutung der Edition für die Analyse wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Moby-Dick, Herman Melville, Sprachliche Bilder, Metapher, Vergleich, Linguistische Analyse, Empirische Forschung, Rezeption, Bildlichkeit, Kognitive Metapherntheorie, Literaturwissenschaft.
Wo finde ich eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Eine detaillierte Zusammenfassung der einzelnen Kapitel (Einleitung, Grundlagen sprachlicher Bilder, Edition, Handlung, Methodik, Analyse, Fazit) ist im HTML-Dokument enthalten.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Gebrauch sprachlicher Bilder in "Moby-Dick", um deren Funktionen im Roman zu beleuchten und ihren Einfluss auf die Rezeption zu untersuchen. Methodische Aspekte der linguistischen Analyse werden ebenfalls behandelt.
- Citation du texte
- Verena Schulz (Auteur), 2015, Sprachliche Bilder und ihr Gebrauch in der deutschen Übersetzung von Herman Melvilles „Moby-Dick“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334944