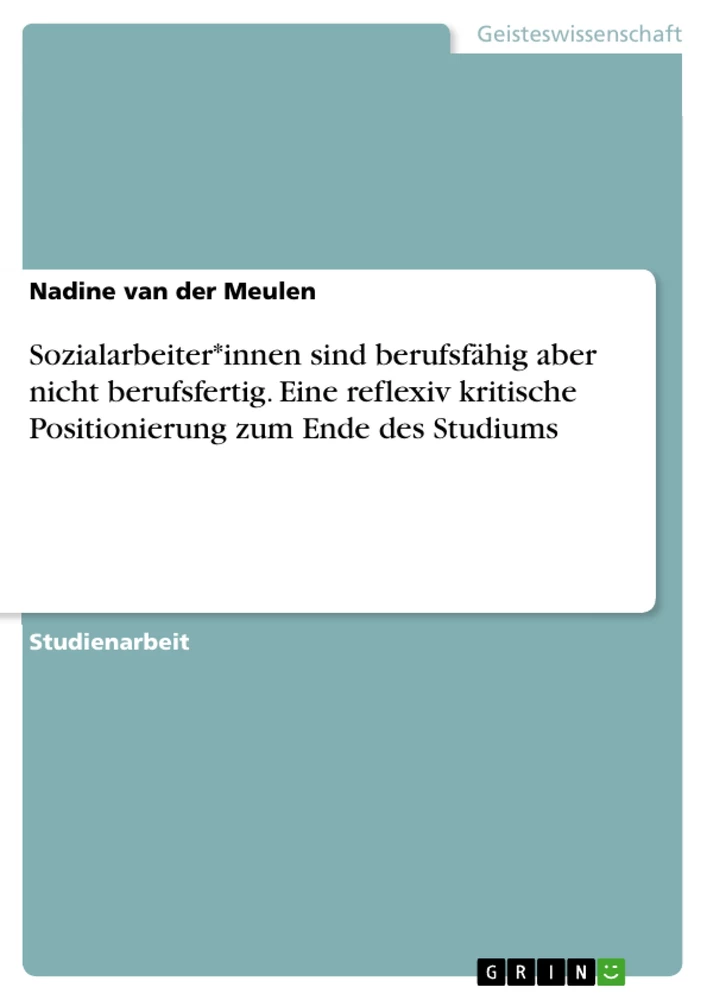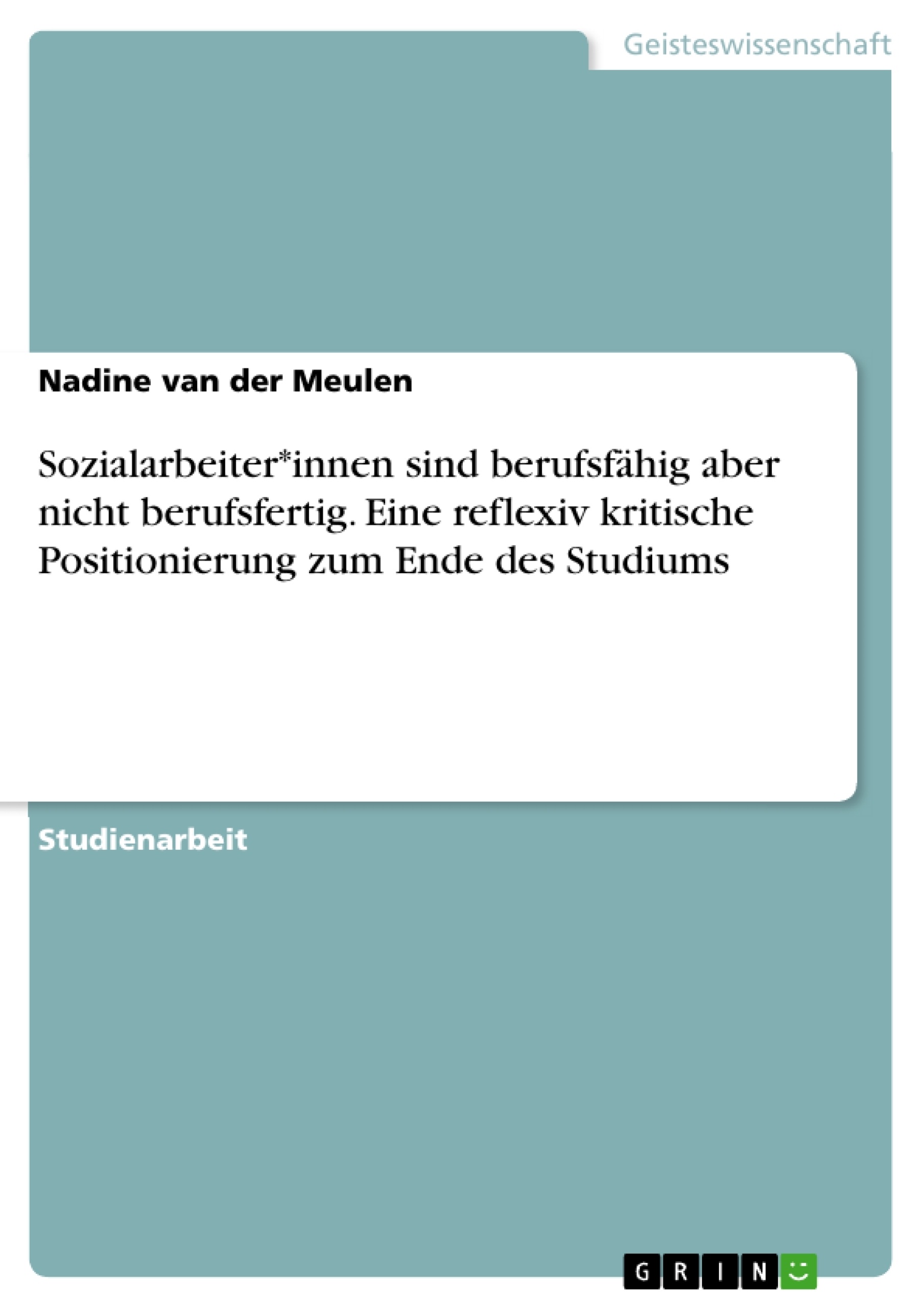Der Fokus des eigenen Konzepts Sozialer Arbeit liegt darauf, unter Berücksichtigung unterschiedlicher Schwerpunkte, zu reflektieren, dass man berufsfähig durch das Studium der Sozialen Arbeit wird, aber niemals berufsfertig ist.
Hierbei soll die reflexiv – kritisch – positionierte professionelle Identität betrachtet werden, im Sinne eines Verständnisses, dass die Soziale Arbeit als Disziplin, Profession und Beruf verstanden wird, die sich aus unterschiedlichen Kernkompetenzen zusammensetzt, die vielleicht auf den ersten Blick nicht zusammen zu gehören scheinen. Beispielsweise meiner Arbeit in einem ökonomisierten Dienstleistungssektors, wie dem Bereich des Einzelhandels.
Nach der Beschreibung des Konzepts in Unterkapitel 1.1 folgt eine Begründung des Konzepts in Unterkapitel 1.2. In Kapitel 2 werden die Herausforderungen der Sozialen Arbeit dargestellt und in Unterkapitel 2.1 exemplarisch ein Spannungsfeld dargestellt, welches zu den gewählten Seminaren mit den Titeln „Präventions- und Interventionsmaßnahmen bei psychisch kranken Straftätern“ und „Einführung in die psychopathologische Diagnostik“ in Modul 4 passt. Ziele und Aufgaben werden in Unterkapitel 2.2 dargestellt und die daraus resultierenden zentralen Fragen in Unterkapitel 2.3 aufgezeigt. Im Anschluss daran werden in Unterkapitel 2.4 Theorien und Methoden kritisch betrachtet um in Kapitel 3 daran anknüpfend das Verhältnis zur eigenen beruflichen Rolle darstellen zu können. Kapitel 4 widmet sich als Fazit des eigenen Berufsprofils zum Abschluss der vorgelegten Hausarbeit kritisch mit der zukünftigen Tätigkeit als Sozialarbeiterin und den bereits erworbenen Kenntnissen.
Die Theorieumsetzungen bestehen unter anderem aus dem Professionsverständnis des Deutschen Berufsverbands für Soziale Arbeit, der Mitarbeit im Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit, der Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit, der Leitung der Arbeitskreise Musik und Nachhaltigkeit, sowie dem Schwerpunkt im Bereich der Hochschule, Forschung, Lehre und Studierende miteinander über die Arbeit im Allgemeinen Studierendenausschuss zu vernetzen und Leitungsposition erproben und lernen zu können, sowie als Hilfswissenschaftliche Mitarbeiterin zu Forschung und Lehre im musikalischen und künstlerischen Bereich beitragen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung des eigenen Konzepts Sozialer Arbeit
- Beschreibung
- Begründung
- Herausforderungen Sozialer Arbeit
- Spannungsfelder
- Ziele und Aufgaben
- zentrale Fragen
- Theorien und Methoden
- Verhältnis zur eigenen beruflichen Rolle
- Fazit des eigenen Berufsprofils
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines eigenen Konzepts Sozialer Arbeit, das auf unterschiedlichen Schwerpunkten und der Reflexion der eigenen beruflichen Entwicklung basiert. Sie analysiert die Herausforderungen der Sozialen Arbeit und beleuchtet exemplarisch ein Spannungsfeld, das zu den gewählten Seminaren passt. Zudem werden Ziele und Aufgaben der Sozialen Arbeit dargestellt sowie zentrale Fragen und Theorien und Methoden kritisch betrachtet. Schließlich wird das Verhältnis zur eigenen beruflichen Rolle und die zukünftige Tätigkeit als Sozialarbeiterin in einem Fazit zusammengefasst.
- Reflexion der eigenen beruflichen Entwicklung und Berufsbefähigung
- Analyse von Herausforderungen und Spannungsfeldern in der Sozialen Arbeit
- Kritische Betrachtung von Theorien und Methoden
- Entwicklung eines eigenen Konzepts Sozialer Arbeit
- Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung des eigenen Konzepts Sozialer Arbeit: Dieses Kapitel beschreibt das eigene Konzept Sozialer Arbeit, das auf der Arbeit auf Augenhöhe, der Wahrung der Menschenrechte und der Rechte nach der UN-Kinderrechtskonvention basiert. Es werden verschiedene Qualifikationen und Interessen des Autors/der Autorin beleuchtet, die in das Konzept einfließen.
Herausforderungen Sozialer Arbeit: Dieses Kapitel stellt verschiedene Herausforderungen der Sozialen Arbeit dar, darunter Spannungsfelder, Ziele und Aufgaben, zentrale Fragen und Theorien und Methoden. Exemplarisch wird ein Spannungsfeld beleuchtet, das zu den gewählten Seminaren „Präventions- und Interventionsmaßnahmen bei psychisch kranken Straftätern“ und „Einführung in die psychopathologische Diagnostik“ passt.
Verhältnis zur eigenen beruflichen Rolle: In diesem Kapitel wird das Verhältnis des Autors/der Autorin zur eigenen beruflichen Rolle im Kontext der Sozialen Arbeit dargestellt. Es werden Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis und der Theorie miteinander verbunden.
Fazit des eigenen Berufsprofils: Dieses Kapitel fasst die Erkenntnisse der Hausarbeit zusammen und reflektiert die zukünftige Tätigkeit des Autors/der Autorin als Sozialarbeiterin. Es werden die bereits erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten kritisch betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit zentralen Themen der Sozialen Arbeit, wie z.B. Menschenrechte, Soziale Gerechtigkeit, Ethik-Code, Berufsbefähigung, Lebenswelt- und Ressourcenorientierung, psychopathologische Befunde, Diagnostik, globales Lernen, Fairer Handel, Nachhaltigkeit, klinische Therapie und Bildungsarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „berufsfähig, aber nicht berufsfertig“?
Es bedeutet, dass das Studium die notwendigen Grundlagen und Kompetenzen vermittelt, die professionelle Identität und Praxisreife jedoch ein lebenslanger Lernprozess sind.
Welche Rolle spielen Menschenrechte in der Sozialen Arbeit?
Menschenrechte, wie die UN-Kinderrechtskonvention, bilden das ethische Fundament für die Arbeit auf Augenhöhe und die professionelle Positionierung von Sozialarbeiter*innen.
Was sind typische Spannungsfelder in der Sozialen Arbeit?
Ein Beispiel ist die Arbeit mit psychisch kranken Straftätern, wo Hilfeansprüche des Individuums und Sicherheitsinteressen der Gesellschaft aufeinandertreffen.
Wie hängen Ökonomisierung und Soziale Arbeit zusammen?
Die Arbeit reflektiert die Herausforderungen, soziale Dienstleistungen in einem zunehmend ökonomisierten Sektor zu erbringen, ohne die ethischen Standards zu verlieren.
Was ist der Fokus der „Kritischen Sozialen Arbeit“?
Sie hinterfragt bestehende Machtstrukturen, setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein und fördert eine reflexive, kritisch positionierte professionelle Identität.
- Quote paper
- Nadine van der Meulen (Author), 2015, Sozialarbeiter*innen sind berufsfähig aber nicht berufsfertig. Eine reflexiv kritische Positionierung zum Ende des Studiums, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335300