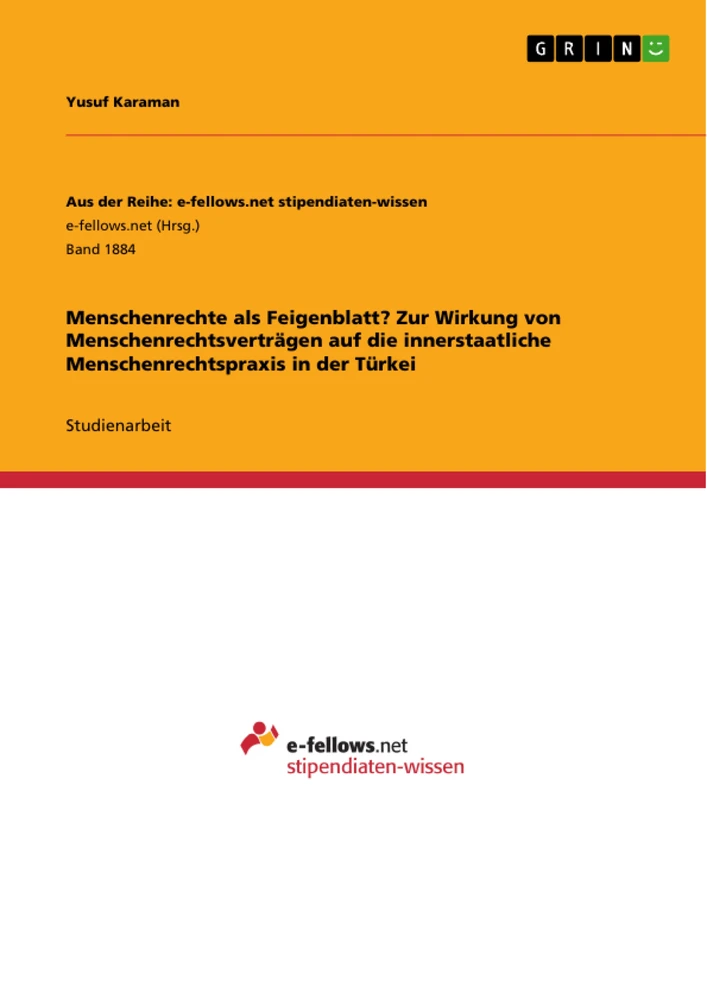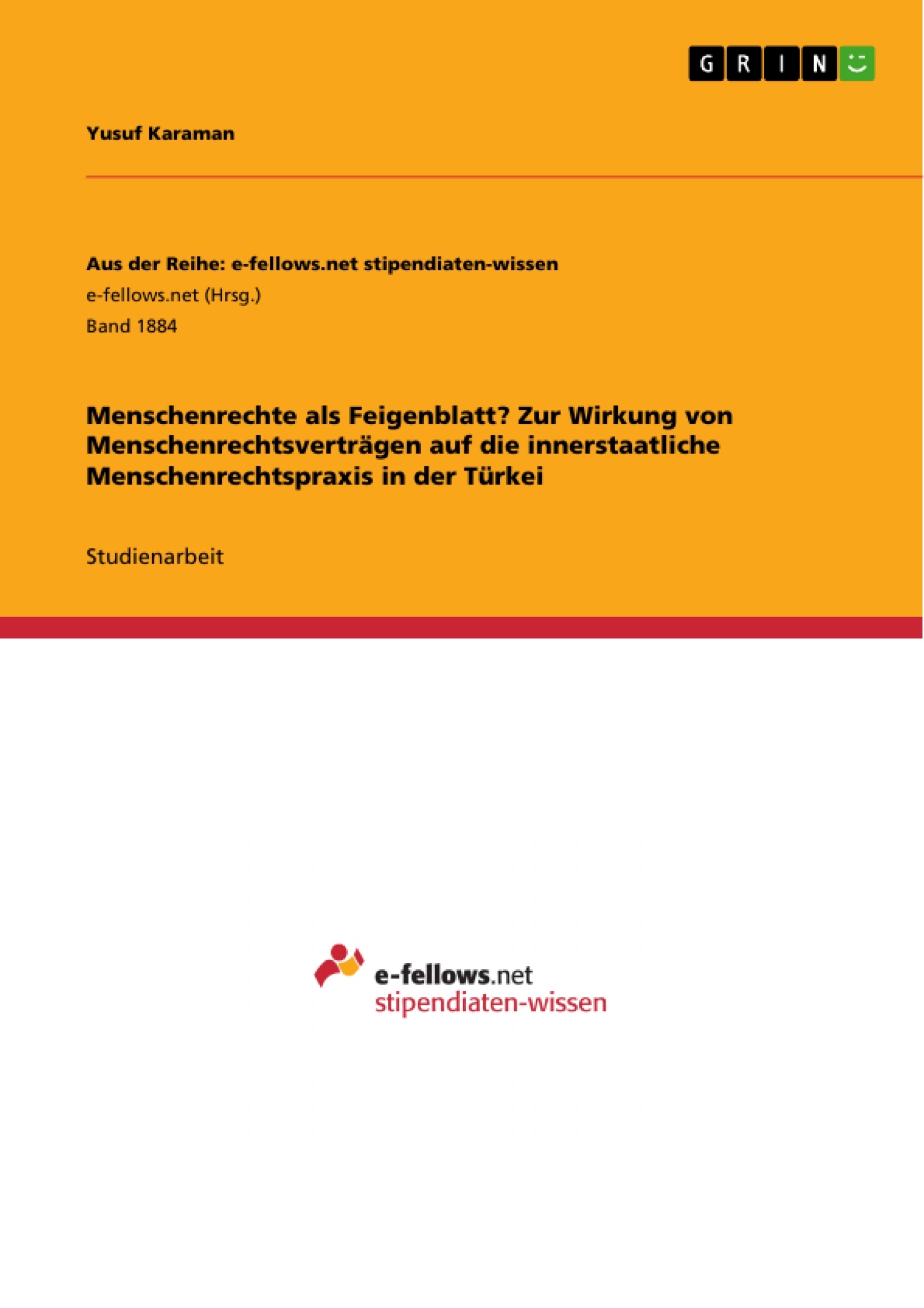Weltweit ist die Zahl der Ratifikationen völkerrechtlicher Verträge gestiegen. Insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einer beachtlichen Verrechtlichung von Menschenrechtsnormen. So gibt es seit 1994 keinen Staat mehr, der nicht Vertragspartei mindestens eines der zentralen Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen ist.
Allerdings besteht eine hohe Diskrepanz zwischen weitgehender Ratifikation auf der einen Seite und mangelnder Umsetzung der eingegangenen Verpflichtungen auf der anderen Seite. Folglich scheinen derartige Verträge völlig anders zu wirken als bezweckt, womit sich die Frage stellt, weshalb Staaten Menschenrechtsverträge überhaupt ratifizieren.
Verfolgen sie mit der Ratifizierung etwa andere als die von den Verträgen beabsichtigten Ziele? Dienen Menschenrechtsverträge etwa bloß als Feigenblatt? Diese Arbeit geht diesen Fragen auf den Grund und überprüft die Ergebnisse am Fallbeispiel der Türkei, nachdem zuvor einige Theorien zu diesem Thema erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Internetquellenverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Aufbau der Arbeit
- III. Oona A. Hathaway: Macht die Ratifikation einen Unterschied?
- 1. Ratifikation als Substitut tatsächlicher Verbesserungen
- 2. Schwachstellen einer statistischen Studie
- a) Defizite im empirischen Teil
- b) Schwächen von Hathaways Theorie
- c) Probleme des alternativen Konzepts
- 3. Treffende Replik
- IV. Alternative Studien
- 1. Einfluss nationaler Zivilgesellschaften
- 2. Kontextualisierte Wirkung internationaler Verträge
- 3. Ratifikation als Ausdruck von Präferenzen
- V. Die Menschenrechtslage in der Türkei
- 1. Situation in der Türkei vor der Jahrtausendwende
- 2. Internationale Verträge zum Schutz der Menschenrechte, in denen die Türkei eingebunden ist
- 3. Reformen zu Menschenrechten nach Bekannt werden des EU-Beitrittskandidatenstatus
- a) Reformen zur Meinungsfreiheit
- b) Reformen zur Folter im Polizeigewahrsam
- c) Reformen zur Todesstrafe
- 4. Aktuelle Menschenrechtslage in der Türkei
- a) Verletzung des Rechts auf freie Meinungsäußerung
- b) Folter und Misshandlungen durch Sicherheitskräfte
- c) Tötungen durch Sicherheitskräfte
- 5. Zusammenfassung und Kontextualisierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Beziehung zwischen der Ratifikation von Menschenrechtsverträgen und deren tatsächliche Umsetzung in der Praxis. Sie analysiert die Studie von Oona A. Hathaway, die argumentiert, dass Staaten Menschenrechtsverträge hauptsächlich aus Reputationsgründen ratifizieren, ohne ihre Verpflichtungen ernsthaft zu erfüllen. Die Arbeit beleuchtet zudem kritische Punkte von Hathaways Analyse und präsentiert alternative Studien, die verschiedene Faktoren wie die Rolle der Zivilgesellschaft, die Kontextualisierung der Ratifikation und die Präferenzen von Staaten hervorheben. Schließlich wird die Gültigkeit dieser Theorien anhand des Beispiels der Türkei überprüft, wobei die Türkei aufgrund ihrer komplexen Beziehungen zur EU und ihrem jahrzehntelangen Ringen um eine EU-Mitgliedschaft ein besonders interessantes Fallbeispiel darstellt.
- Die Wirkung von Menschenrechtsverträgen auf die innerstaatliche Menschenrechtspraxis
- Die Motive hinter der Ratifikation von Menschenrechtsverträgen
- Die Rolle der Zivilgesellschaft bei der Durchsetzung von Menschenrechten
- Der Einfluss von Demokratisierung und politischen Präferenzen auf die Menschenrechtslage
- Die Menschenrechtslage in der Türkei im Kontext der EU-Beitrittsbemühungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Diskrepanz zwischen der weit verbreiteten Ratifikation von Menschenrechtsverträgen und der weiterhin bestehenden Menschenrechtsverletzungen in vielen Staaten. Sie stellt die Studie von Oona A. Hathaway vor, die diese Diskrepanz untersucht und argumentiert, dass Staaten Menschenrechtsverträge nur als Feigenblatt nutzen, um ihr Reputationsbild zu verbessern. Im zweiten Kapitel wird der Aufbau der Arbeit dargelegt und die einzelnen Kapitel vorgestellt. Das dritte Kapitel widmet sich der Studie von Hathaway, deren Ergebnisse, Kritikpunkte und Repliken im Detail betrachtet werden. Im vierten Kapitel werden weitere Studien zum Zusammenhang zwischen Ratifikation und Menschenrechtslage vorgestellt, die verschiedene Faktoren wie die Rolle der Zivilgesellschaft und die Kontextualisierung der Ratifikation untersuchen. Das fünfte Kapitel analysiert die Menschenrechtslage in der Türkei und untersucht, in welche Menschenrechtsverträge die Türkei eingebunden ist und wie die innerstaatliche Menschenrechtspolitik und die aktuelle Lage in der Türkei sich entwickelt haben. Die Arbeit schließt mit einer Auswertung und Schlussfolgerung, die die Gültigkeit der verschiedenen Theorien anhand des Beispiels der Türkei überprüft und die komplexen Zusammenhänge zwischen Ratifikation, innerstaatlicher Politik und Menschenrechtslage beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Menschenrechte, Menschenrechtsverträge, Ratifikation, Wirkung von Verträgen, innerstaatliche Menschenrechtspraxis, Reputationsgründe, Zivilgesellschaft, Demokratisierung, politische Präferenzen, Türkei, EU-Beitritt, Kurdenfrage, Folter, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Justizreform. Die Arbeit befasst sich mit der Forschung zu den Auswirkungen von Menschenrechtsverträgen auf die Menschenrechtslage in Staaten, wobei insbesondere das Verhältnis von Ratifikation und Umsetzung in der Praxis im Vordergrund steht.
Häufig gestellte Fragen
Warum ratifizieren Staaten Menschenrechtsverträge, ohne sie einzuhalten?
Oona Hathaway argumentiert, dass dies oft aus Reputationsgründen geschieht ("Feigenblatt"), um international als modern und rechtsstaatlich zu gelten.
Welche Rolle spielt die Zivilgesellschaft bei Menschenrechtsverträgen?
Alternative Studien zeigen, dass Verträge besonders dann wirken, wenn eine starke nationale Zivilgesellschaft den Staat zur Einhaltung der Verpflichtungen drängt.
Wie hat sich die Menschenrechtslage in der Türkei durch die EU-Bewerbung verändert?
Es gab bedeutende Reformen zur Meinungsfreiheit, zur Abschaffung der Todesstrafe und gegen Folter, um die Kopenhagener Kriterien für einen EU-Beitritt zu erfüllen.
Was sind die aktuellen menschenrechtlichen Herausforderungen in der Türkei?
Trotz Reformen gibt es weiterhin Berichte über die Einschränkung der Pressefreiheit, Misshandlungen durch Sicherheitskräfte und Defizite in der Justiz.
Sind internationale Verträge wirkungslos?
Nicht zwingend; ihre Wirkung hängt stark vom politischen Kontext, dem Druck internationaler Organisationen (wie der EU) und dem internen Demokratisierungsprozess ab.
- Quote paper
- Yusuf Karaman (Author), 2016, Menschenrechte als Feigenblatt? Zur Wirkung von Menschenrechtsverträgen auf die innerstaatliche Menschenrechtspraxis in der Türkei, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335311