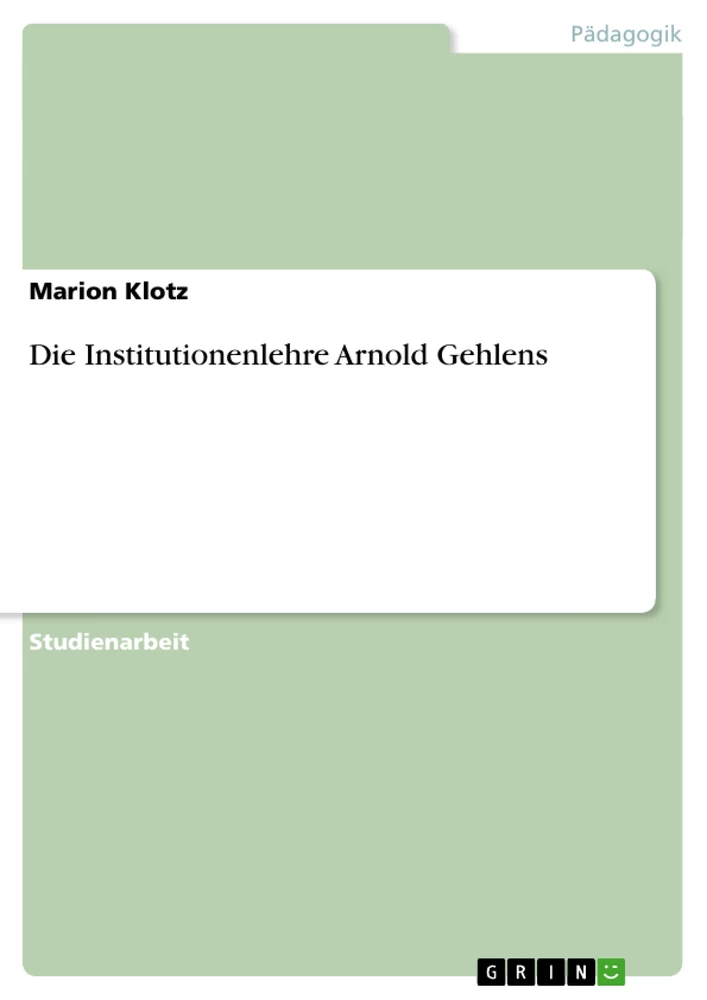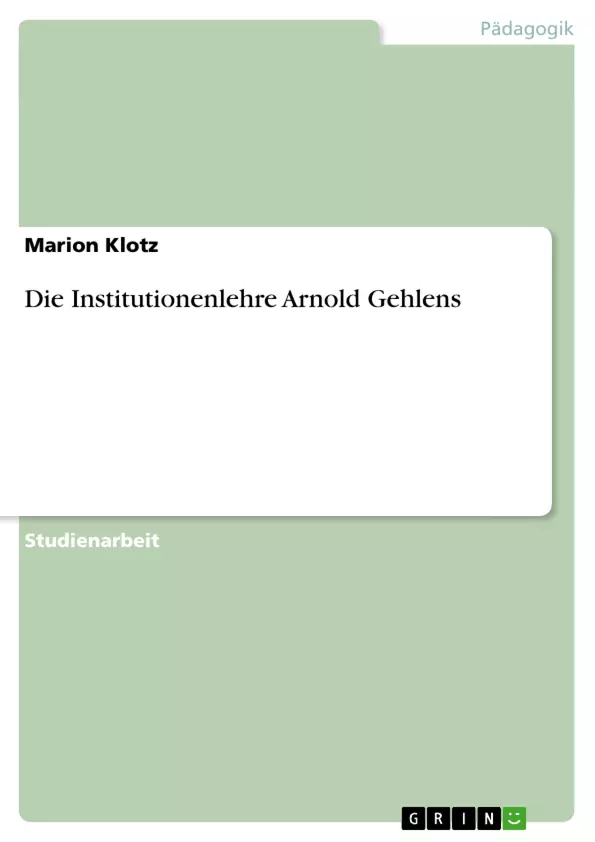„Der Mensch weiß nicht, was er ist, daher kann er sich nicht direkt verwirklichen. Er muß sich mit sich durch die Institutionen vermitteln lassen“. Diese Aussage Gehlen in seinem Spätwerk Moral und Hypermoral: Eine pluralistische Ethik sagt schon aus sich heraus viel über das Menschenbild und das Institutionenverständnis des Anthropologen aus. Scheint dieses Verständnis vom Menschen und seinem elementaren Bedürfnis nach der Ordnung und dem Schutz der Institutionen auf den ersten Blick überaus konservativ und möglicherweise nicht mehr gänzlich zeitgemäß anmaßen, so ist es doch unbedingt einer näheren Betrachtung und Reflexion wert. Beides versuche ich in der vorliegenden Arbeit zu liefern.
Die Institutionenlehre Gehlens ist tief in seinem Menschenbild verankert und lässt sich nur mit dessen Hilfe verstehen. Ich werde also in dieser Arbeit zunächst über die Hauptpunkte von Gehlens Anthropologie referieren und dabei in der Reihenfolge vorgehen, die er in seinem für dieses Thema relevantesten Werk Der Mensch: Seine Natur und Stellung in der Welt selbst gewählt hat.
In einem zweiten Teil werde ich mich dann konkret mit der Institutionenlehre Gehlen befassen. Dabei werde ich zuerst auf die Aufgaben der Institutionen im Allgemeinen eingehen und dann kurz die Folgen des von Gehlen beklagten Verfalls der Institutionen behandeln.
In einer abschließenden Zusammenfassung werde ich die Hauptargumente aus den beiden ersten Teilen zusammenbringen und eine kritische Schlussfolgerung ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Mensch
- Instinktmangel und Unspezialisiertheit
- Weltoffenheit
- Reizüberflutung
- Die Institutionen
- Die Aufgabe der Institutionen
- Vorhersehbarkeit des Handelns
- Entlastung von Grundsatzentscheidungen
- Der Verfall der Institutionen
- Das Institutionenverständnis im Wandel
- Die Folgen des Verfalls
- Die Aufgabe der Institutionen
- Zusammenfassung
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Institutionenlehre von Arnold Gehlen. Sie analysiert Gehlens Menschenbild und dessen Auswirkungen auf seine Sichtweise von Institutionen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die zentralen Argumente Gehlens zu präsentieren und sie kritisch zu reflektieren.
- Das Menschenbild von Arnold Gehlen
- Der Instinktmangel und die Unspezialisiertheit des Menschen
- Die Weltoffenheit und ihre Auswirkungen
- Die Rolle von Institutionen in der menschlichen Gesellschaft
- Der Verfall der Institutionen und seine Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Institutionenlehre Gehlens ein und stellt seine zentrale These dar: Der Mensch ist durch seinen Instinktmangel und seine Weltoffenheit auf Institutionen angewiesen, um Ordnung und Schutz zu gewährleisten.
Der Mensch
Instinktmangel und Unspezialisiertheit
Dieser Abschnitt beleuchtet Gehlens These, dass der Mensch im Gegensatz zu Tieren durch einen Mangel an Instinkten und eine Unspezialisierung gekennzeichnet ist. Er argumentiert, dass diese Merkmale den Menschen in eine Situation der „Mittellosigkeit“ bringen, die er durch kulturelle und soziale Strukturen kompensieren muss.
Weltoffenheit
Hier wird Gehlens Konzept der Weltoffenheit erläutert. Der Mensch hat keine vorgegebene Umwelt, in der er automatisch überleben kann, sondern muss sie aktiv gestalten. Die Weltoffenheit birgt sowohl Herausforderungen als auch Chancen für den Menschen.
Die Institutionen
Die Aufgabe der Institutionen
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Funktion von Institutionen. Gehlen sieht sie als Mittel zur Vorhersehbarkeit des menschlichen Handelns und zur Entlastung von Grundsatzentscheidungen. Institutionen schaffen somit Ordnung und Sicherheit in einer komplexen Welt.
Der Verfall der Institutionen
Hier beleuchtet die Arbeit Gehlens Kritik am Verfall der traditionellen Institutionen. Er argumentiert, dass dieser Verfall zu einer Zunahme von Unsicherheit und Orientierungslosigkeit in der Gesellschaft führt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Anthropologie und Soziologie, darunter der Instinktmangel des Menschen, seine Weltoffenheit, die Funktion von Institutionen in der Gesellschaft und der Verfall traditioneller Strukturen. Darüber hinaus werden Begriffe wie „Mittellosigkeit“, „Reizüberflutung“ und „Kultur“ verwendet.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der Institutionenlehre von Arnold Gehlen?
Gehlen betrachtet Institutionen als notwendige Kompensation für den menschlichen Instinktmangel. Da der Mensch ein „Mangelwesen“ ist, bieten Institutionen die nötige Ordnung, Stabilität und Entlastung von Grundsatzentscheidungen.
Warum bezeichnet Gehlen den Menschen als „Mangelwesen“?
Im Gegensatz zu Tieren fehlt dem Menschen eine spezialisierte Umweltanpassung und ein fester Instinktapparat. Diese „Mittellosigkeit“ zwingt ihn dazu, seine Umwelt aktiv durch Kultur und soziale Strukturen zu gestalten.
Was versteht Gehlen unter „Weltoffenheit“?
Weltoffenheit bedeutet, dass der Mensch nicht an eine spezifische Umwelt gebunden ist. Er ist einer Reizüberflutung ausgesetzt und muss diese Reize durch Institutionen filtern und verarbeiten, um überlebensfähig zu bleiben.
Welche Aufgaben erfüllen Institutionen laut Gehlen?
Institutionen schaffen Vorhersehbarkeit im menschlichen Handeln und entlasten das Individuum von ständigen Entscheidungen. Sie bieten Schutz und bilden das Gerüst für ein stabiles gesellschaftliches Zusammenleben.
Welche Folgen hat der Verfall von Institutionen?
Laut Gehlen führt der Verfall traditioneller Institutionen zu Orientierungslosigkeit, Unsicherheit und einer Überforderung des Einzelnen, da die stabilisierende Wirkung der sozialen Ordnung schwindet.
- Citar trabajo
- Marion Klotz (Autor), 2003, Die Institutionenlehre Arnold Gehlens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33537