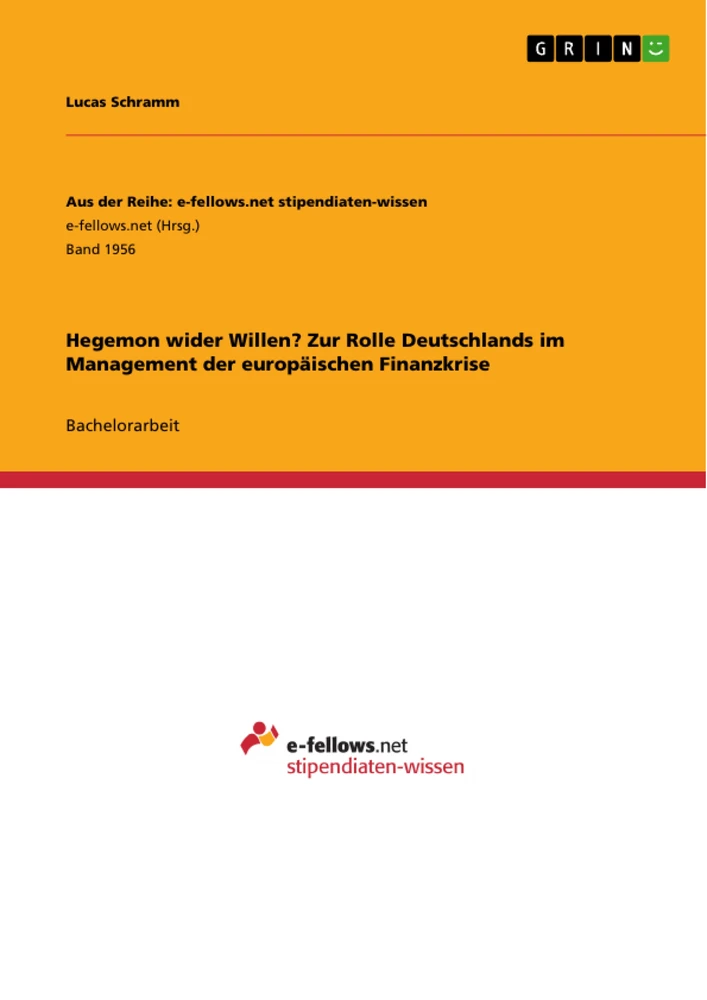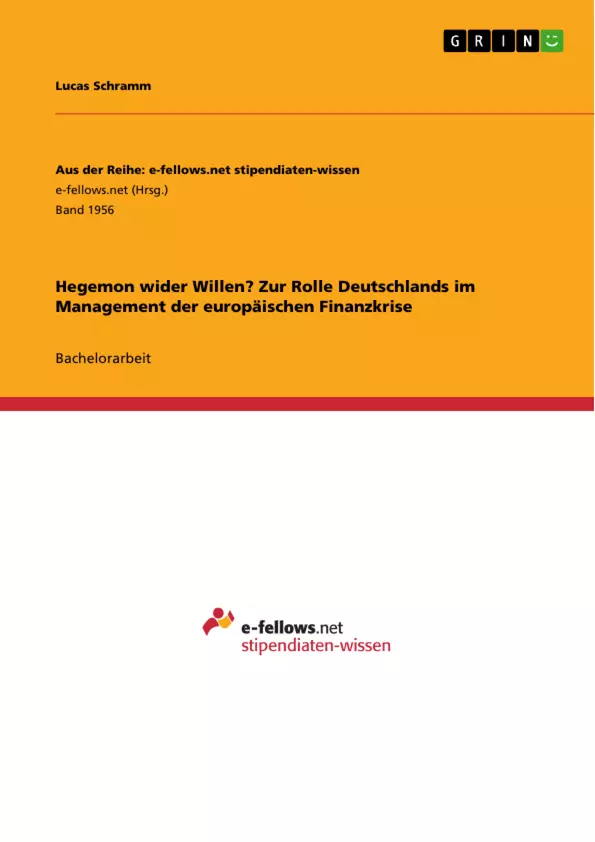Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle Deutschlands im Management der europäischen Finanzkrise. In einem ersten Schritt wird als theoretischer Rahmen der (Neo-)Realismus als eine der führenden Großtheorien der Internationalen Beziehungen gewählt, um Hypothesen über das Agieren sowohl eines mächtigen Nationalstaates als auch von weniger mächtigen Nationalstaaten abzuleiten, welche darüber hinaus vor dem Hintergrund der Besonderheiten des komplexen Mehrebenensystems der Europäischen Union (EU) und der europäischen Integrationsgeschichte kritisch hinterfragt werden können. Das Hegemoniekonzept, insbesondere das nach Heinrich Triepel, ermöglicht Aussagen über die Notwendigkeiten, Chancen und Risiken bei der Ausübung einer führenden Rolle in einem Integrationsverbund wie der EU.
Das Management der europäischen Finanzkrise hat zu einer beispiellosen Abfolge von intergouvernementalen Gipfeln auf höchster politischer Ebene und zu weitreichenden Reformen im Institutionengefüge von EU und Eurozone geführt. Medial wurde dabei oft der Eindruck vermittelt, dass Deutschland aus einer Position der wirtschaftlichen Stärke heraus agiert und die Governance-Strukturen nach seinem Willen geformt hat. Nicht selten wurde die Bundesrepublik dabei auch als Hegemon bezeichnet. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass Deutschland in der Finanzkrise nicht die politische Führungsrolle eingenommen hat, die ihm seine wirtschaftliche Vormachtstellung in Europa erlauben würde und die im Einklang mit der (neo-)realistischen Theorie und dem Konzept eines echten Hegemons stünde. Statt die Lasten einer Führerschaft zu übernehmen, standen – auch aufgrund institutioneller und mentaler Restriktionen – nicht selten eigene politische und wirtschaftliche Interessen im Vordergrund.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Theorie des (Neo-)Realismus und das Konzept der Hegemonie
- Realismus und Neorealismus
- Hegemonie
- Begründung des (neo-)realistischen Theorieansatzes
- Notwendige Modifizierung der (neo-)realistischen Theorie vor dem Hintergrund der europäischen Integrationsgeschichte
- Der wohlwollende Hegemon, oder: Worin liegt das mediale Bild einer deutschen Hegemonie begründet?
- Deutschlands materielle Machtressourcen
- Deutschlands immaterielle Machtressourcen
- Deutschlands Rolle in Europa
- Restriktionen einer deutschen Hegemonie
- Institutionelle Restriktionen: Die konsensdemokratischen politischen Systeme Deutschlands und der Europäischen Union
- Mentale Restriktionen: Die deutsche politische Kultur
- Integrationstheoretische Restriktionen: Die Einbindung Deutschlands, insbesondere durch die bilateralen Beziehungen mit Frankreich
- Entscheidungen und Reformen im Management der europäischen Finanzkrise
- Aufbau und Fallauswahl
- Durchsetzung deutscher Positionen
- Der Fiskalpakt
- Verstärkte finanz- und wirtschaftspolitische Steuerung der Eurozone
- Abwehr von Eurobonds
- Konzessionen der Bundesregierung
- Bilaterale Rettungspakete und dauerhafter Krisenfonds
- Reform der Governance-Strukturen der Eurozone
- Rolle der Europäischen Zentralbank
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle Deutschlands im Management der europäischen Finanzkrise. Sie untersucht, ob und wie Deutschland seine ökonomische Machtposition zur Ausübung einer Führungsrolle in der EU und insbesondere in der Eurozone nutzte und ob Deutschland im Sinne eines Hegemons agierte.
- Theoretischer Rahmen: (Neo-)Realismus, Hegemoniekonzept nach Heinrich Triepel
- Materielle und immaterielle Machtressourcen Deutschlands in EU und Eurozone
- Restriktionen einer deutschen Hegemonie: innenpolitische, politische Kultur, bilaterale Beziehungen mit Frankreich
- Entscheidungen und Reformen im Management der Finanzkrise: Durchsetzung deutscher Positionen und Konzessionen der Bundesregierung
- Fazit: Deutschland agierte nicht als Hegemon, sondern war „Hegemon wider Willen“.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und stellt die Forschungsfrage auf. Sie beleuchtet den theoretischen Rahmen der Arbeit, den (Neo-)Realismus, und untersucht das Konzept der Hegemonie, insbesondere nach Heinrich Triepel.
Anschließend werden die materiellen und immateriellen Machtressourcen Deutschlands analysiert, um die relative Machtposition Deutschlands in EU und Eurozone zu bestimmen.
Es werden Restriktionen einer deutschen Hegemonie herausgearbeitet, die in den politischen Systemen Deutschlands und der EU, in der deutschen politischen Kultur und in der engen bilateralen Beziehung mit Frankreich begründet sind.
Der Hauptteil der Arbeit befasst sich mit den wichtigsten Entscheidungen und Reformen im Management der Finanzkrise. Sowohl die Durchsetzung deutscher Positionen (Fiskalpakt, Reform des SWP, Abwehr von Eurobonds) als auch die Konzessionen der Bundesregierung (bilaterale Rettungspakete, dauerhafter Krisenfonds, Reform der Governance-Strukturen der Eurozone, Rolle der Europäischen Zentralbank) werden untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Hegemonie, (Neo-)Realismus, Machtressourcen, Führung, Europäische Union, Eurozone, Finanzkrise, Fiskalpakt, Stabilitäts- und Wachstumspakt, Eurobonds, Rettungsfonds, Europäische Zentralbank.
Häufig gestellte Fragen
Gilt Deutschland als Hegemon in der EU?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Deutschland trotz wirtschaftlicher Vormachtstellung eher ein "Hegemon wider Willen" ist und keine volle politische Führungsrolle übernimmt.
Welche theoretische Basis nutzt die Arbeit?
Die Analyse basiert auf dem (Neo-)Realismus und dem Hegemoniekonzept nach Heinrich Triepel.
Was verhinderte eine stärkere deutsche Führung in der Finanzkrise?
Institutionelle Restriktionen (Konsensdemokratie) sowie mentale Restriktionen in der deutschen politischen Kultur spielten eine entscheidende Rolle.
Konnte Deutschland seine Positionen beim Fiskalpakt durchsetzen?
Ja, die Arbeit zeigt auf, dass Deutschland den Fiskalpakt und die Abwehr von Eurobonds weitgehend nach seinen Vorstellungen gestalten konnte.
Welche Zugeständnisse musste die Bundesregierung machen?
Deutschland musste unter anderem bilateralen Rettungspaketen und einem dauerhaften Krisenfonds zustimmen.
- Citar trabajo
- Lucas Schramm (Autor), 2014, Hegemon wider Willen? Zur Rolle Deutschlands im Management der europäischen Finanzkrise, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335463