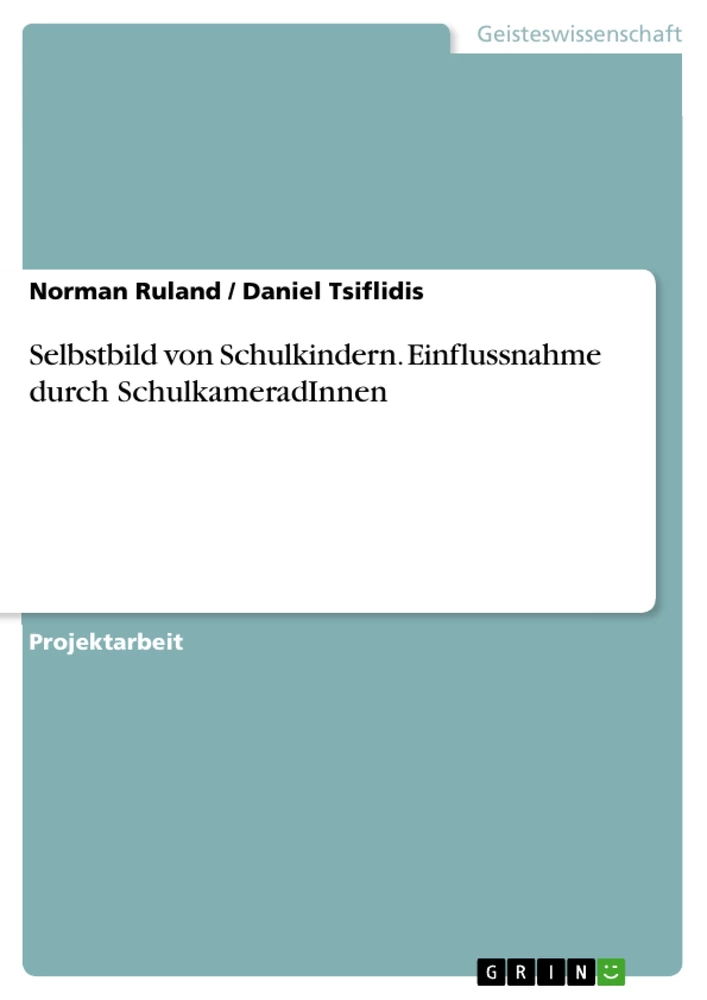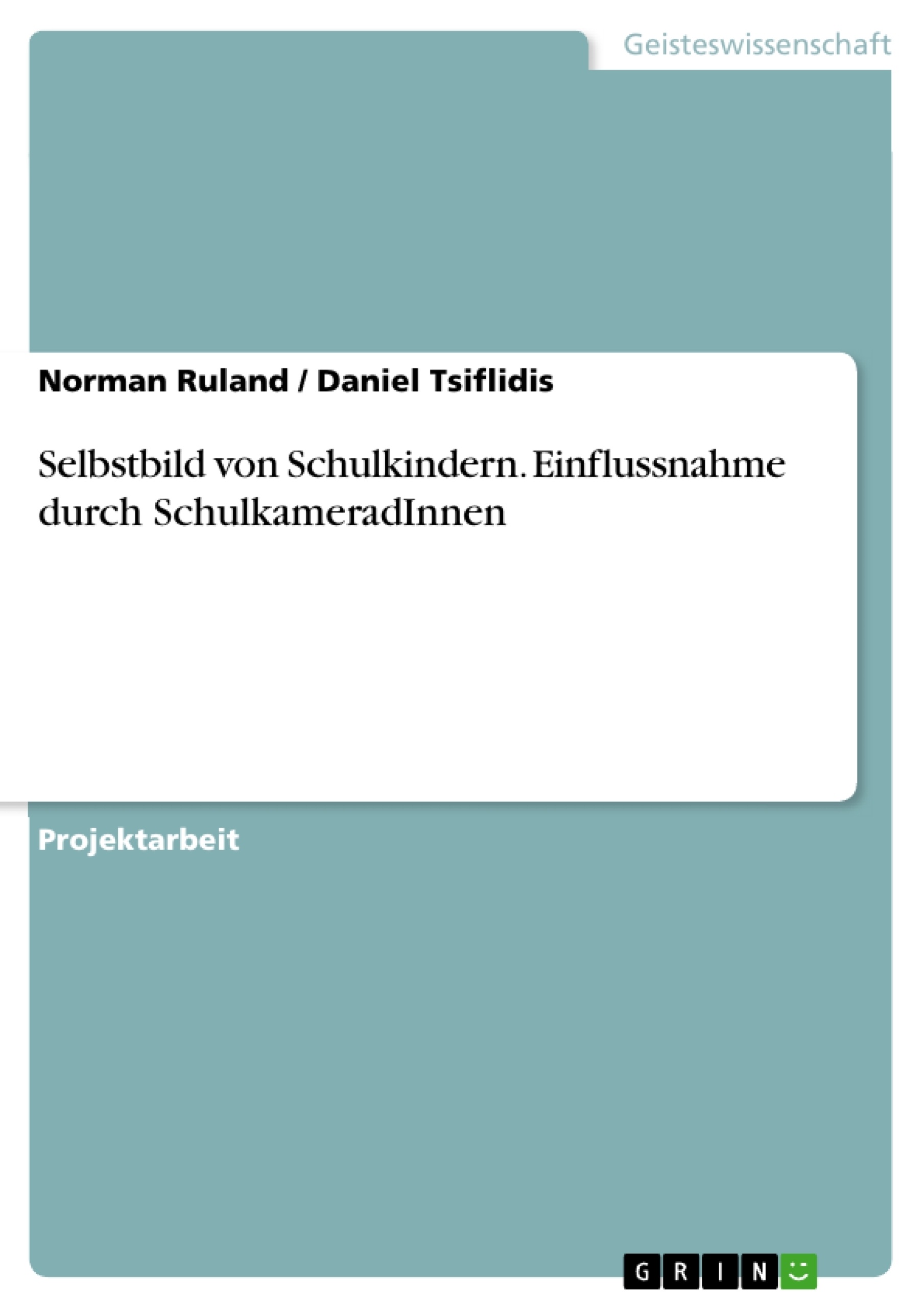Der Begriff des Selbst eines Menschen ist ein uneinheitlich verwendeter Begriff, den man sowohl in der Philosophie, Theologie, Soziologie als auch in der Psychologie findet. In diesem Forschungsbericht soll es um die letztere Betrachtungsweise des Selbst gehen. Dem Selbst aus psychologischer, vor allem psychoanalytischer bzw. tiefenpsychologischer Sicht. In all den Herangehensweisen an das Selbst lässt sich eine Konstante finden: Die Rede ist von etwas Eigenem, Individuellen, eine Art innerer Kern in einem Menschen.
Die tiefenpsychologische Sicht, vor allem die psychoanalytische Selbstpsychologie sieht in diesem Kern den Ursprung der gesunden geistigen und körperlichen Entwicklung. Die Quelle von Freiheit, Kreativität und Würde. Es lässt sich aus dieser Sicht betrachtet erahnen, dass es sich um etwas Wertvolles und Wichtiges für einen Menschen handelt. Wichtig auch um das gute Leben, von dem einige Philosophen immer wieder gesprochen haben, verwirklichen zu können. Oder auch um einfacher und flexibler mit den Höhen und Tiefen des Lebens zurechtzukommen. Man könnte ihn auch als die Quelle von würdevollem Umgang mit sich selbst und dem Leben bezeichnen. Auch in östlichen Kulturkreisen gab es schon seit Jahrhunderten Versuche sich diesem Kern, wenn er denn im Laufe des Lebens verloren gegangen sei, als Erwachsener wieder zu nähern.
Vor allem die Zen-Praxis, schrieb sich das als oberstes Ziel auf die Fahne. Auch die aus diesen östlichen Denktraditionen adaptierte Achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, die vor allem im westlichen psychotherapeutischen Alltag immer mehr an Bedeutung gewinnt, bemüht sich um die Bewusstmachung und Klärung der eigenen Innenwelt, d.h. der eigenen Gedanken, Gefühle und Stimmungen. Es geht bei all diesen Ansätzen um etwas von innen nach außen drängendes und umgekehrt auf etwas von außen nach innen Introjiziertes. Denn die Existenz eines innewohnenden eigenen Kerns impliziert natürlich auch eine Gefahr, bzw. ein Risiko für die Entwicklung des Menschen: Was geschieht, wenn dieser Kern, dieses Potenzial auf ein nicht ausreichend fruchtbares Umfeld trifft, und somit in seiner Entwicklung gehemmt wird? Dieser Frage wird in folgendem Forschungsbericht in einem Teilbereich des menschlichen Lebens, der Grundschulzeit, nachgegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- I. Bestandteile des Forschungsberichts:
- 1. Einleitung (Tsiflidis)
- 1.1 Formulieren von Zielsetzung, Erkenntnisinteresse, Vorannahmen, Annäherung an das Thema
- 1.2 Konkretisierung und klare Herausarbeitung der Forschungsfrage bzw. Hypothese
- 2. Forschungsentwurf (Ruland)
- 2.1 Forschungsrichtung
- 2.2 Vorüberlegungen aufgrund theoretischer Grundlagen
- 2.3 Beschreibung des Forschungsentwurfs
- 2.3.1 Zugang zum Forschungsfeld
- 2.3.2 Erhebungsmethode
- 2.3.3 Ethische Aspekte
- 2.3.4 Fixierung der Daten
- 2.3.5 Auswertung der Ergebnisse
- 3 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse (Ruland/Tsiflidis)
- 3.1 Überblick über die Ergebnisse (Ruland)
- 3.2 Eingrenzung und Diskussion von ausgewählten Teilaspekten in Bezugnahme zu den Ausgangsthesen (Ruland)
- 3.4.1 Auswertung der Fragebögen
- 3.4.2 Auswertung der „Ich-Bilder“ (Tsiflidis)
- 3.3 Fazit, weitere Fragestellungen (Tsiflidis)
- 3.4 Reflexion (Ruland)
- 3.3.1 Methodenreflexion
- 3.4.2 Reflexion des Forschungsprozesses
- II. Bestandteile des Anlagenbandes:
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Das Selbstbild von Schulkindern
- Einflüsse von Schulkameraden auf die Selbstentwicklung
- Potentielle Auswirkungen des schulischen Umfelds auf die seelische Gesundheit
- Der Einfluss von Anerkennung und sozialer Interaktion
- Die Rolle von Freundschaft und Peer-Pressure
- Kapitel 1 (Einleitung) gibt eine Einleitung in das Thema Selbstentwicklung und skizziert die Forschungsfrage. Der Begriff "Selbst" wird aus psychologischer Perspektive, insbesondere der tiefenpsychologie, erläutert und die Relevanz des Themas für die gesunde Entwicklung des Kindes hervorgehoben.
- Kapitel 2 (Forschungsentwurf) beschreibt die Forschungsrichtung und die theoretischen Grundlagen, auf denen die Untersuchung basiert. Es werden der Zugang zum Forschungsfeld, die angewandte Erhebungsmethode sowie ethische Aspekte und die Auswertungsmethode erläutert.
- Kapitel 3 (Darstellung und Diskussion der Ergebnisse) präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, unterteilt in einen Überblick über die Ergebnisse und eine eingehendere Diskussion von ausgewählten Teilaspekten. Die Auswertung der Fragebögen und der "Ich-Bilder" werden hier genauer beleuchtet.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Forschungsbericht befasst sich mit dem Einfluss von Schulkameraden auf die Selbstentwicklung von Schulkindern. Ziel ist es, die potenziellen Auswirkungen des schulischen Umfelds auf die seelische Entwicklung zu untersuchen und zu analysieren, ob das Selbst eines Kindes durch negative Einflüsse gehemmt werden kann.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Selbstentwicklung, Schulkind, Schulkamerad, Einfluss, Selbstbild, Sozialisation, Peer-Pressure, Schulalltag, seelische Entwicklung, Forschungsfrage, tiefenpsychologische Perspektive, Auswertungsmethode, qualitative Daten, quantitative Daten, Fragebögen, Ich-Bilder, soziale Interaktion, Anerkennung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Schulkameraden das Selbstbild eines Kindes?
Durch soziale Interaktion, Anerkennung oder Ablehnung prägen Gleichaltrige (Peers) den „inneren Kern“ und das Selbstwertgefühl des Kindes maßgeblich.
Was versteht die Tiefenpsychologie unter dem „Selbst“?
Das Selbst wird als innerer Kern gesehen, der die Quelle von Freiheit, Kreativität und gesunder geistiger Entwicklung darstellt.
Welche Rolle spielt Peer-Pressure in der Grundschule?
Druck durch Mitschüler kann die individuelle Entwicklung hemmen, wenn das Kind versucht, sich anzupassen, um Ablehnung zu vermeiden.
Was sind „Ich-Bilder“ im Kontext dieser Forschung?
„Ich-Bilder“ sind kreative Ausdrucksformen, mit denen Kinder ihre eigene Innenwelt und ihre Position in der Gruppe visualisieren und die in der Studie ausgewertet wurden.
Welche Auswirkungen hat ein unfruchtbares schulisches Umfeld?
Wenn das Potenzial des Kindes auf Ablehnung stößt, kann dies die seelische Gesundheit beeinträchtigen und die Entwicklung eines stabilen Selbstwertgefühls verhindern.
Was ist das Ziel des Forschungsberichts?
Ziel ist es, den Einfluss des schulischen Umfelds auf die seelische Entwicklung zu untersuchen und herauszufinden, wie soziale Interaktionen das Selbstbild formen.
- Citar trabajo
- Norman Ruland (Autor), Daniel Tsiflidis (Autor), 2016, Selbstbild von Schulkindern. Einflussnahme durch SchulkameradInnen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335654