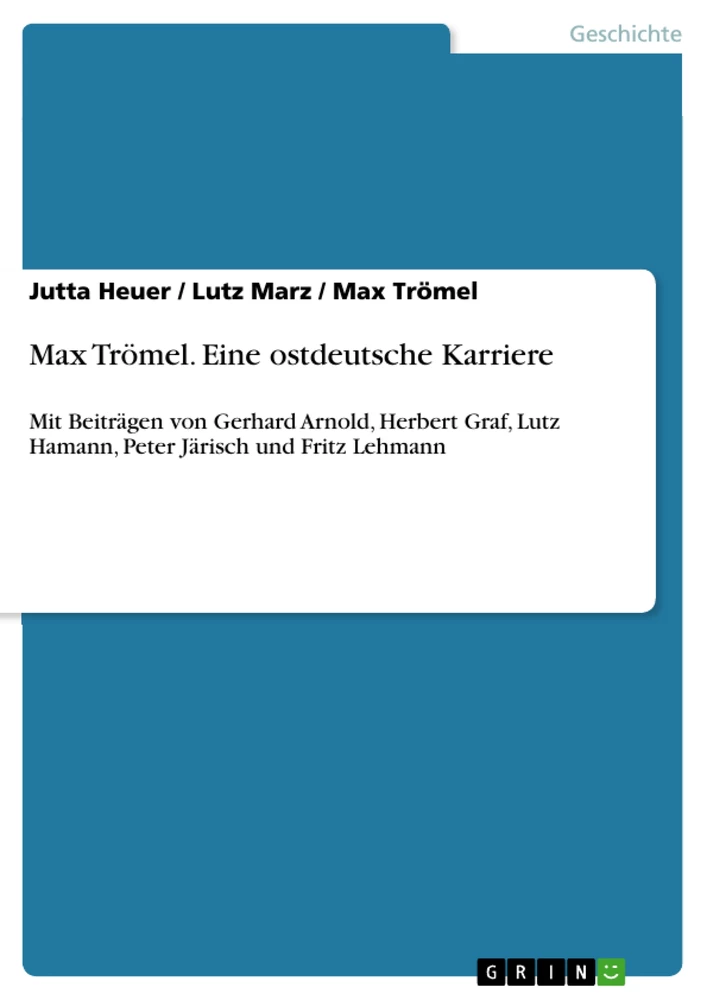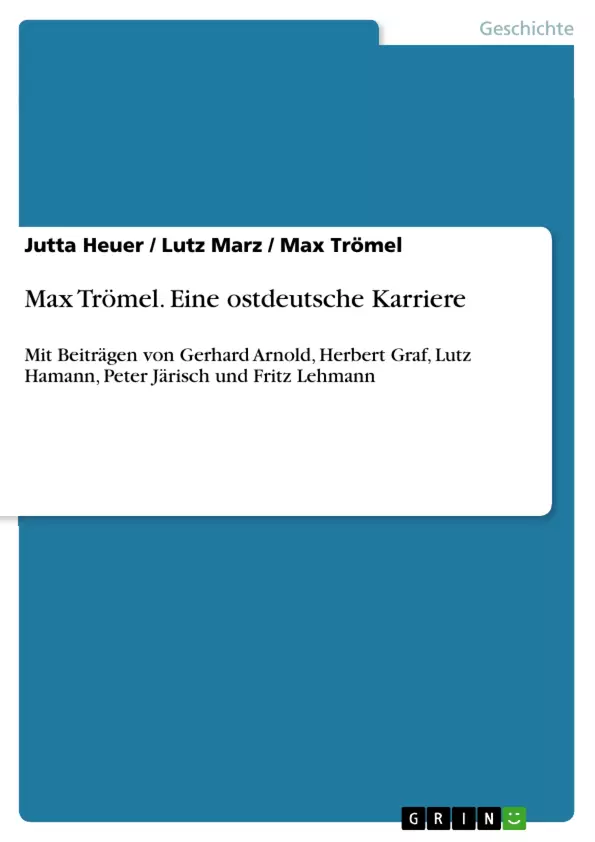Neben der Legende Dr. Georg Pohler gehört Dr. Max Trömel zum Urgestein der deutschen Kabelindustrie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er arbeitete von 1950 bis 1995 in dieser Branche, davon 40 Jahre in der ostdeutschen und 5 Jahre in der bundesdeutschen Kabelherstellung. Wie sonst nur wenige lernte er diesen Industriezweig von der Pike auf kennen. Kernstück des vorliegenden Buches bilden Gespräche, die mit Dr. Trömel im Zeitraum von April 2014 bis Januar 2015 im Monatsrhythmus geführt und transkribiert und dann vom Februar 2015 bis Juni 2016 überarbeitet wurden. Das Spektrum der Geschichten, in denen Dr. Trömel sein Leben Revue passieren lässt, ist ausgesprochen breit und vielgestaltig. Alle Geschichten stimmen nachdenklich, manche sind lustig, ja geradezu skurril, andere bedrücken und erschüttern. Dr. Trömel begann seine Karriere als Lehrling, arbeitete im Ministerium, war Werkdirektor, stellvertretender Generaldirektor und schließlich Senior-Advisor der British Insulated Callender’s Cables (BICC). Er entwickelte und praktizierte einen Führungs- und Leitungsstil, in dem sich ökonomische Effizienz, Freude an der Arbeit und Hochachtung vor anderen Menschen beispielhaft miteinander verbanden. Ein Grundfeiler dieses Leitungsstils war die enge Verknüpfung von praktischer und wissenschaftlicher Arbeit, die Dr. Trömel vom ersten bis zum letzten Tag seines 45jährigen Berufslebens praktizierte. Er genoss bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Leitungsebenen eine ganz außergewöhnliche Anerkennung, wie sie Managern in der Wirtschaft nur sehr selten entgegengebracht wird. Ergänzt werden die Gespräche durch Erinnerungen ehemaliger Kollegen sowie durch private Bilder und Dokumente von Dr. Trömel. Die in dem vorliegenden Buch dokumentierten Erinnerungen und Erfahrungen richten sich zum einen an spätere Historiker, die wissen möchten, wie die Menschen in der DDR-Planwirtschaft gearbeitet und gelebt haben. Und sie richten sich auch an jene Zeitgenossen, die nicht gedankenlos dem Mainstream folgen wollen, sondern die die Mühe des eigenen Denkens nicht scheuen und sich ihre Urteile selber bilden möchten, auch auf die Gefahr hin, dass dabei lieb gewordene Vorurteile auf der Strecke bleiben.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Vorworte
- Jutta Heuer: Der Chef
- Lutz Marz: Das „System Trömel“
- Max Trömel: 45 Jahre
- Lebenslauf
- Gespräche
- Karriere-Abschnitte
- Die Kindheit
- Die Reife
- Der Einstieg
- Der Aufstieg
- Das Tribunal
- Ein Gipfel
- Die Absetzung
- Der Neustart
- Der Wechsel
- Die Abgründe
- Der Zweite
- Die Drohung
- Die Wende
- Der Umbruch
- Karriere-Linien
- Theorie und Praxis
- Werte und Tugenden
- Planwirtschaft und Bilanzierung
- Investitionen und Parteitagsobjekte
- Familie und Freizeit
- Erinnerungen
- Gerhard Arnold
- Herbert Graf
- Max Trömel - Freund und Partner
- Die Wende – ein neuer Anfang?
- Bewegte Jahre 1990-1992
- Vertragsprobleme und ihre Bewältigung
- Lutz Hamann
- Peter Järisch
- Meine erste Begegnung mit Max Trömel und meine ersten Arbeiten im Kabelwerk Köpenick
- Der neue Führungsstil und eine neue Herausforderung
- VEB-Betriebe wurden GmbHs
- Die neue Führung
- Fritz Lehmann
- Fotos
- Dokumente
- Ausgewählte Bibliographie
- Glossar
- Lutz Marz: Nachgedanken
- Danksagung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Dieses Buch zeichnet die Karriere von Max Trömel in der ostdeutschen Wirtschaft von 1950 bis 1990 nach. Es stellt die Erfahrungen, Entscheidungen und Herausforderungen eines Wirtschaftskaders in der DDR vor.
- Verbindung von Theorie und Praxis
- Werte und Tugenden in der Arbeitswelt
- Planwirtschaft und ihre Besonderheiten
- Leitungsstrukturen und Entscheidungsprozesse
- Entwicklung der ostdeutschen Wirtschaft und die Herausforderungen der Wendezeit
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Der erste Teil des Buches widmet sich den Karriere-Abschnitten von Max Trömel und skizziert wichtige Ereignisse und Etappen seines Lebens und seiner beruflichen Entwicklung, von seiner Kindheit über seine Ausbildung bis hin zu seiner Tätigkeit in der DDR-Wirtschaft.
Im zweiten Teil werden Karriere-Linien beleuchtet und wichtige Themen wie die Verbindung von Theorie und Praxis, die Rolle von Werten und Tugenden in der Arbeitswelt sowie die Besonderheiten der DDR-Planwirtschaft und des Entscheidungsprozesses in diesem System vertieft.
Das Buch enthält außerdem Erinnerungen von ehemaligen Kollegen Max Trömels, die aus ihrer Perspektive seine Persönlichkeit und seinen Führungsstil beleuchten.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Begriffe, die das Buch durchziehen, sind: Ostdeutsche Wirtschaft, DDR-Planwirtschaft, Führungsstrukturen, Entscheidungsprozesse, Subsidiaritätsprinzip, Theorie und Praxis, Werte und Tugenden, Investitionsprojekte, Personalentwicklung, Wendezeit und Transformation.
- Quote paper
- Jutta Heuer (Author), Lutz Marz (Author), Max Trömel (Author), 2016, Max Trömel. Eine ostdeutsche Karriere, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335908