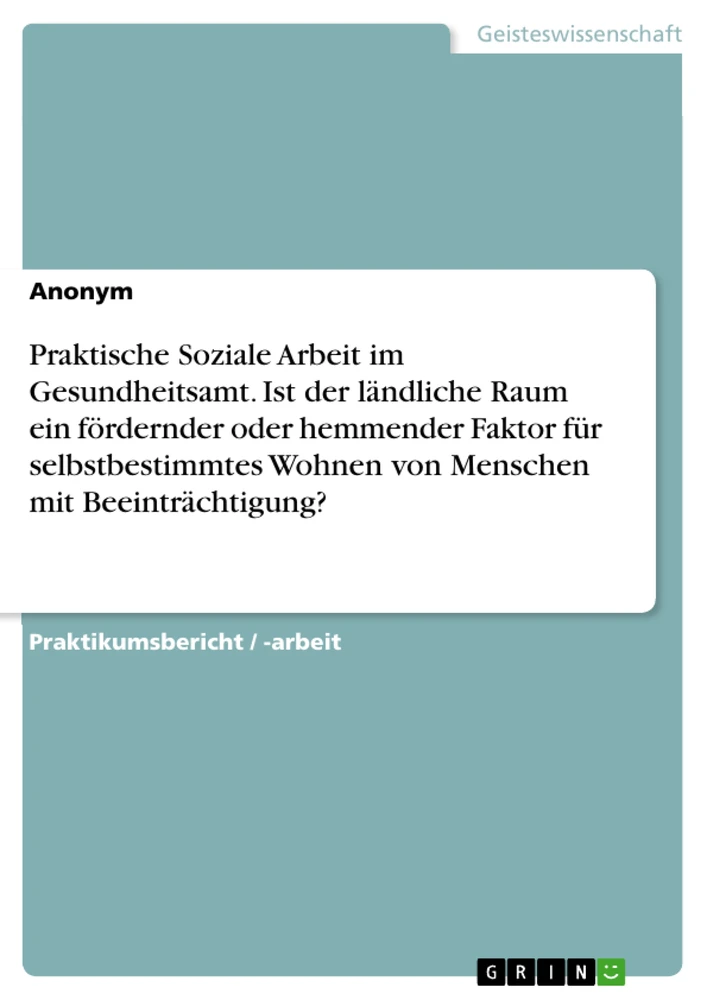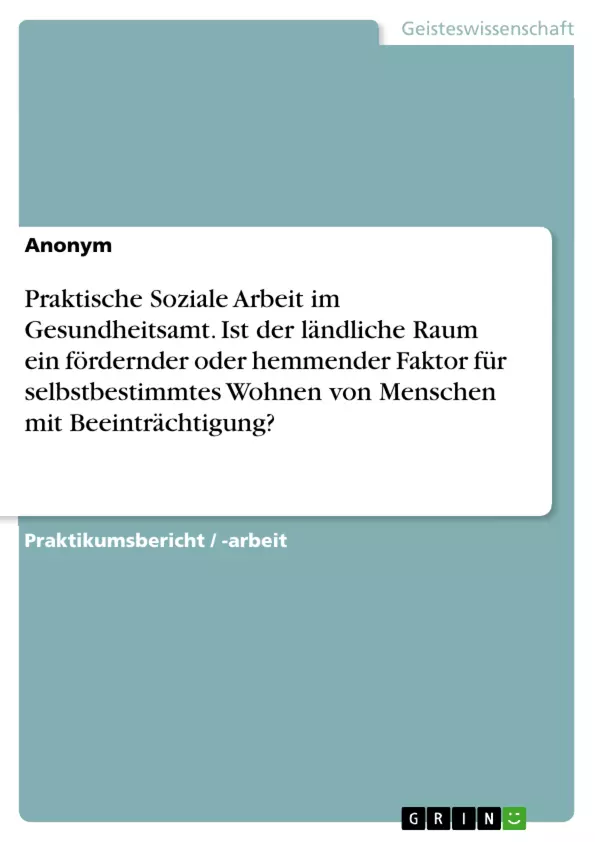Zwei Jahre lang habe ich als Pflegefachkraft in einer Einrichtung der Behindertenhilfe gearbeitet. In dieser Zeit habe ich viele Menschen mit Beeinträchtigung kennen gelernt. Besonders eingeprägt hat sich bei mir die Erkenntnis, wie sehr diese Menschen in einer „Parallelwelt“ leben. Sie leben und arbeiten in eigens für sie errichteten Einrichtungen. Und auch in der Freizeit bleiben sie eher unter sich oder zumindest innerhalb der Familie. Durch diese Erfahrungen motiviert habe ich für mich ein Praktikum im Gesundheitsamt entschieden. Ich war interessiert daran, durch welche Methoden und Verfahren und nach welchen rechtlichen Grundlagen es zu Entscheidungen kommt, die das Wohnen und die Freizeit von Menschen mit Beeinträchtigung betreffen.
Für den größeren Teil der deutschen Bevölkerung ist Selbstbestimmung heute bereits seit der Kindheit selbstverständlich. Dieser Umstand ist wohl insbesondere der stabilen Demokratie geschuldet. Menschen mit Behinderung sehen sich im Vergleich vermehrt Grenzen und Fremdbestimmungen gegenüber. Ein Großteil der Betroffenen kann seinen Arbeitsplatz nicht frei wählen, sondern muss sich mit dem arrangieren, was angeboten wird. Viele haben nicht die Möglichkeit frei zu entscheiden, wo und mit wem sie leben wollen. Sie müssen auch erleben, dass Partnerschaften und Sexualität unterbunden werden. Die Freizeit, der Tag, die Mahlzeiten werden verplant und das „Taschengeld“ wird zugewiesen. Die meisten Wohnformen beinhalten eine relativ große Abhängigkeit der Betroffenen von anderen Menschen. Aber abhängig zu sein, bedeutet fremdbestimmt zu sein. Sind in einem ländlichen Landkreis alternative, mehr selbstbestimmte, Wohnformen überhaupt umsetzbar? Hat der ländliche Raum die erforderlichen Ressourcen? In Fachzeitschriften werden vermehrt innovative Modellprojekte für selbstbestimmtes Wohnen vorgestellt. Aber der größere Teil dieser Projekte wird in urbanen Gebieten umgesetzt. Können Menschen mit Behinderung in der Stadt eher selbstbestimmt leben?
In Teil II dieser Arbeit soll die Frage geklärt werden, ob der ländliche Raum ein fördernder oder hemmender Faktor für selbstbestimmtes Wohnen von Menschen mit Beeinträchtigungen ist. Um zu klären was unter selbstbestimmtes Wohnen zu verstehen ist, wird Selbstbestimmung aus der Sicht Betroffener erklärt. Außerdem werden die aktuelle Wohnsituation und dazugehörige Unterstützungsbedarfe von Menschen mit Beeinträchtigung dargelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Teil
- 1. Institution
- 1.1. Allgemeines
- 1.2. Hierachie
- 1.3. Leitbild
- 1.4. Aufgaben nach Abteilungen
- II. Teil
- 1. Falldarstellungen
- 2. Ist der ländliche Raum ein fördernder oder hemmender Faktor für selbstbestimmtes Wohnen von Menschen mit Beeinträchtigungen?
- 2.1. Behinderung/ Beeinträchtigung
- 2.2. Der ländliche Raum
- 2.2.1. Definition und Merkmale
- 2.2.2. Soziale Ressourcen und Probleme des ländlichen Raums
- 2.3. Selbstbestimmung bei Beeinträchtigung
- 2.4. Wohnen mit Beeinträchtigung
- Fazit
- Persönliches Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob der ländliche Raum ein fördernder oder hemmender Faktor für selbstbestimmtes Wohnen von Menschen mit Beeinträchtigungen ist. Sie untersucht die Begriffsdefinition von Behinderung, die Definition, Merkmale und sozialen Gegebenheiten des ländlichen Raums sowie die Bedeutung von Selbstbestimmung bei Beeinträchtigung.
- Die Definition und Bedeutung von Behinderung und Beeinträchtigung
- Die Charakterisierung des ländlichen Raums und seiner sozialen Gegebenheiten
- Die Bedeutung und Umsetzung von Selbstbestimmung für Menschen mit Beeinträchtigung
- Die Analyse der Wohnsituation von Menschen mit Beeinträchtigung im ländlichen Raum
- Die Rolle des ländlichen Raums als fördernder oder hemmender Faktor für selbstbestimmtes Wohnen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Ausgangssituation und die Motivation für die Arbeit. Sie führt den Leser in die Problematik des selbstbestimmten Wohnens von Menschen mit Beeinträchtigung im ländlichen Raum ein.
Der erste Teil der Arbeit stellt die Institution des Gesundheitsamtes vor. Er beschreibt die allgemeine Struktur, die Hierarchie und die Aufgaben des Gesundheitsamtes im Kontext des öffentlichen Gesundheitsdienstes.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der Frage, ob der ländliche Raum ein fördernder oder hemmender Faktor für selbstbestimmtes Wohnen von Menschen mit Beeinträchtigung ist. Er analysiert die Begriffsdefinition von Behinderung, die Definition, die Merkmale und die sozialen Gegebenheiten des ländlichen Raums, sowie die Bedeutung von Selbstbestimmung aus der Sicht Betroffener.
Schlüsselwörter
Selbstbestimmtes Wohnen, ländlicher Raum, Behinderung, Beeinträchtigung, soziale Ressourcen, Gesundheitsamt, Selbstbestimmung, Wohnformen, Unterstützungsbedarf, Modellprojekte.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2014, Praktische Soziale Arbeit im Gesundheitsamt. Ist der ländliche Raum ein fördernder oder hemmender Faktor für selbstbestimmtes Wohnen von Menschen mit Beeinträchtigung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335915