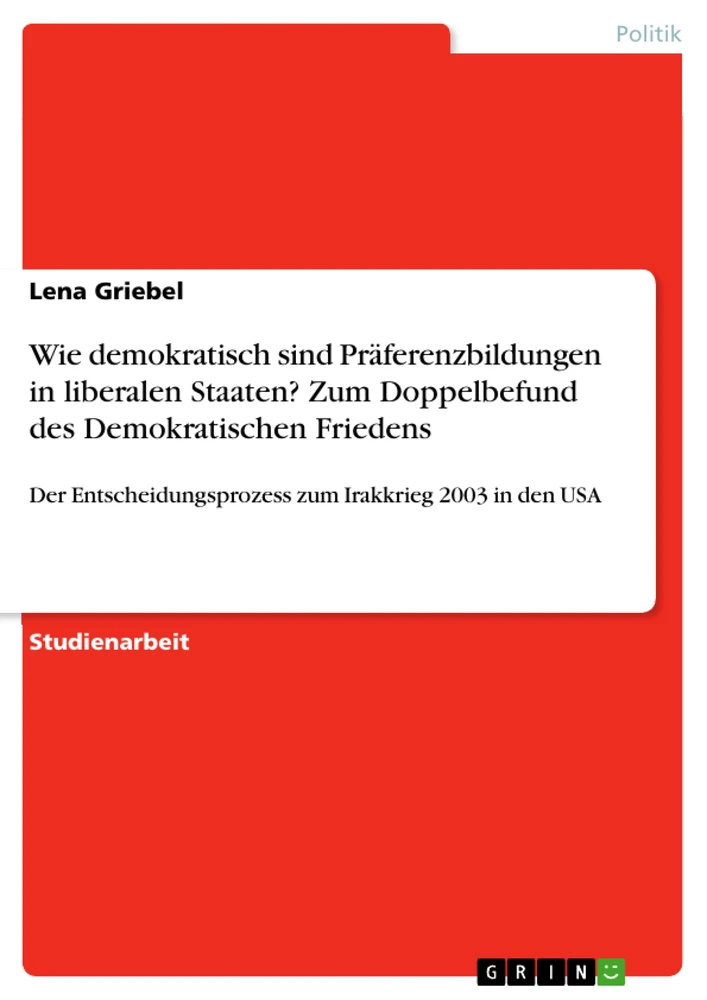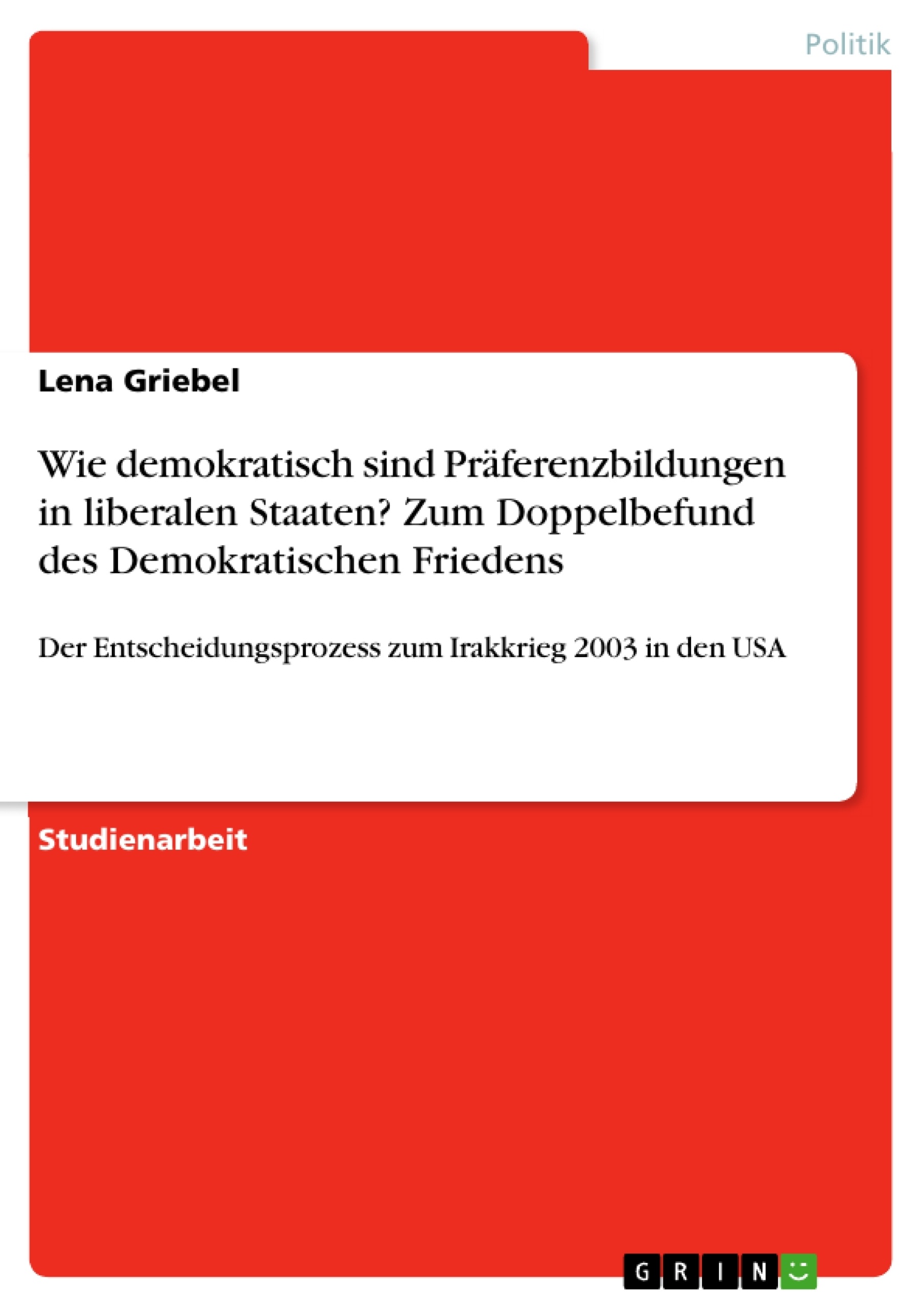Sind Demokratien tatsächlich friedliebender als Nicht-Demokratien? Wann entscheidet sich eine demokratische Gesellschaft für einen kriegerische Auseinandersetzung? Wieso sind demokratische Staaten in Kriege mit illiberalen verwickelt? Ziel dieser Arbeit soll es neben der Beantwortung dieser Fragen sein, Kants Theorem und die Theorie des Demokratischen Friedens auf ihre heutige Gültigkeit hin zu überprüfen. Dabei soll ein besonderer Blick auf den Entscheidungsprozess der Vereinigten Staaten von Amerika für den Irakkrieg 2003 geworfen werden.
Demokratien führen untereinander keine Kriege – diese Tatsache „comes as close as anything we have to an empirical law in international politics“ (Levy 1988: 662). Bereits 1795 hat „der Urvater“ des Demokratischen Friedens, Immanuel Kant, gezeigt, dass ein Unterschied zwischen den Kriegsaffinität demokratischer und nicht-demokratischer Staaten besteht. Aber erst seitdem Michael Doyle 1983 die Theorie des Demokratischen Friedens wiederentdeckt hat, ist sie im politikwissenschaftlichen Diskurs heftig umstritten. Der internationalen Forschung ist es seither gelungen, „Regelmäßigkeiten zu entdecken, die auf eine besondere Kooperationsfähigkeit zwischen Demokratien hinweisen“ (Dembinski/ Hasenclever 2010: 15).
Im Gegensatz zu illiberalen Staaten haben Demokratien häufiger das Bedürfnis, Konflikte durch Mediation anstatt durch Kriege zu beseitigen. Auch die Bildung von Allianzen und internationalen Organisationen gelingt zwischen diesen häufiger und erfolgsversprechender.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte
- Theorieentwicklung: Von Kant zu Doyle
- Kants Theorem - Mit drei Artikeln „zum Ewigen Frieden“
- Der erste Definitivartikel
- Der zweite Definitivartikel
- Der dritte Definitivartikel
- Exkurs: Der Liberalismus in den Internationalen Beziehungen
- Der Demokratische Frieden
- Kants Theorem - Mit drei Artikeln „zum Ewigen Frieden“
- Demokratien auf dem Prüfstand: Wie friedlich sind sie wirklich?
- Der empirische Doppelbefund
- Der Rational Choice-Ansatz
- Der Irakkrieg 2003 und die Präferenzbildung in den USA
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Gültigkeit des Demokratischen Friedens und Kants Theorem, insbesondere im Kontext des Irakkriegs 2003, indem sie den Entscheidungsprozess der Vereinigten Staaten von Amerika analysiert. Die Arbeit will klären, inwiefern der empirische Doppelbefund des Demokratischen Friedens und Kants Theorem den Irakkrieg erklären können.
- Theorie des Demokratischen Friedens
- Empirischer Doppelbefund
- Präferenzbildung in demokratischen Staaten
- Anwendung des Rational Choice-Ansatzes
- Der Irakkrieg 2003
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitende Worte: Die Arbeit stellt die Forschungsfrage vor und erläutert die Relevanz des Themas. Sie definiert die zentralen Begriffe Demokratie, Frieden und Krieg.
- Theorieentwicklung: Von Kant zu Doyle: Dieses Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen des Demokratischen Friedens, beginnend mit Kants "Zum Ewigen Frieden" und dem Liberalismus in den Internationalen Beziehungen. Es führt den Leser in den heutigen Forschungsstand des Demokratischen Friedens ein.
- Demokratien auf dem Prüfstand: Wie friedlich sind sie wirklich?: Dieses Kapitel analysiert den empirischen Doppelbefund des Demokratischen Friedens und erklärt den Rational Choice-Ansatz. Der Irakkrieg 2003 dient als Fallstudie für die Präferenzbildung in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des Demokratischen Friedens, dem empirischen Doppelbefund, der Präferenzbildung in demokratischen Staaten, dem Irakkrieg 2003 und dem Rational Choice-Ansatz. Die Kernaussagen des Werks konzentrieren sich auf die Beziehung zwischen Demokratie und Krieg, die Herausforderungen für die Theorie des Demokratischen Friedens sowie die Rolle des Entscheidungsprozesses in demokratischen Staaten bei der Einleitung von Kriegen.
- Quote paper
- Lena Griebel (Author), 2016, Wie demokratisch sind Präferenzbildungen in liberalen Staaten? Zum Doppelbefund des Demokratischen Friedens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335989