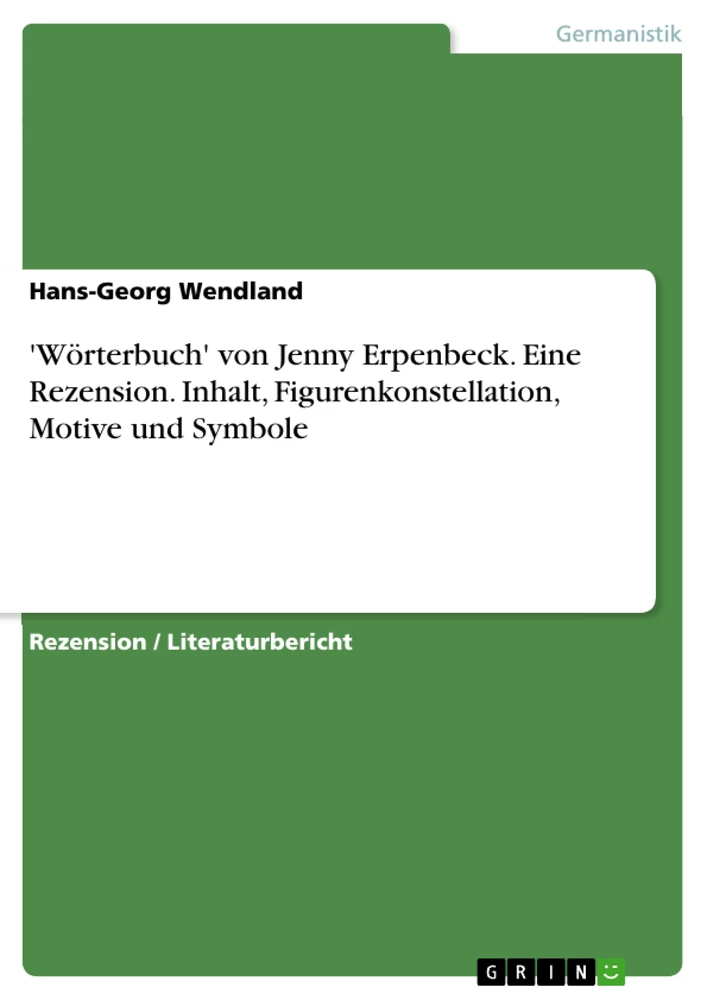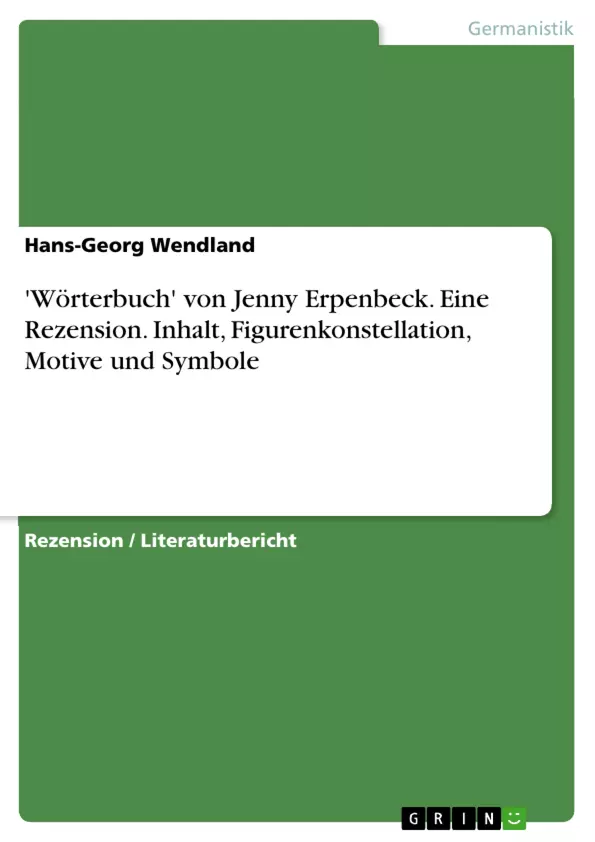Dieser Text bietet eine Literaturrezension von Jenny Erpenbecks „Wörterbuch“ und befasst sich mit der Handlung, den Figuren, Sprache und Symbolismus der Textvorlage.
Der Roman ist als Experiment der Textproduktion konzipiert worden und gleicht einer Collage mit Leerstellen, die vom Leser aufgefüllt werden müssen. Im weiteren Verlauf des Romans bildet sich ein Grundmuster ab, in dem das Bedrohliche zugespitzt und zu einem Klimax gesteigert wird, indem die Grausamkeiten des Militärregimes vom Vater als notwendig und unvermeidbar dargestellt und legitimiert werden. Die Tochter erweist sich als Ja-Sagerin, die diese Darstellungen ungefragt vom Vater übernimmt.
Jenny Erpenbecks Figurenkonzeption beruht auf der Überzeugung von der grundsätzlichen Widersprüchlichkeit der Menschen. Ihre Figuren weisen eine ausgeprägte Dynamik auf, aber sie entwickeln sich nicht weiter, sondern fallen in alte Gewohnheiten zurück. Das gilt auch für die Ich-Erzählerin, die man mit ihrem zerrissenen Innenleben als Muster einer unzuverlässigen Erzählerfigur auffassen kann. Es gilt vor allem für die Adoptivmutter und den Adoptivvater sowie für den gesamten familiären Anhang. Sie oszillieren zwischen den Polen treusorgender Beschützerfiguren und unbarmherzigen Ordnungsfetischisten bzw. Zynikern, die die von ihnen mitverantworteten Grausamkeiten zu Wohltaten bzw. unvermeidlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung umstilisieren.
Den episodenhaft aufgebauten Roman durchzieht ein Netzwerk wiederkehrender, äußerst ambivalenter Motive und Symbole. Sie gliedern das komplexe Geschehen, indem sie Alltägliches und Vertrautes mit Ungewöhnlichem und Bedrohlichem verbinden. Zu den wichtigsten Beispielen zählen die Motive der Versteinerung, des Messers, der Milch sowie eine Reihe von dialektischen Gegensatzpaaren wie Licht – Dunkelheit und Ordnung – Unordnung. Diese und andere Motive und Symbole werden im Prisma der kindlichen Wahrnehmungen gebrochen. Daher wirken sie verzerrt bzw. überdimensioniert wie groteske Wesen in Zwergen- oder Riesengestalt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Zum Inhalt des Romans
- 1.1 Die Ich-Erzählerin stellt sich vor
- 1.2 Mit den Begriffen „Mutter“, „Vater“ und „Haus“ wird ein familiärer Bezugsrahmen skizziert
- 1.3 Der bisher skizzierte räumliche Bezugsrahmen wird ausgeweitet
- 1.4 Als Kind wurde die Erzählerin von einer Amme ernährt und setzte sich gegen den Widerstand der Mutter durch
- 1.5 Die Amme und ihre Tochter Marie verkörpern einen Begriff von Reinheit und Unbeflecktheit, den die Erzählerin bei ihren Eltern und auch bei sich selbst nicht vorfindet
- 1.6 Das Bedrohliche, das vom Vater ausgeht, wird zunächst nur angedeutet oder verbirgt sich im scheinbar Harmlosen
- 1.7 Das Bedrohliche des Vaters konkretisiert und verstärkt sich, wobei es im Sprachduktus des Kindes in bildhafte Vergleiche und Metaphern gekleidet wird
- 1.8 Nicht nur Alltägliches und Banales, sondern auch Religiöses wird mit den dahinter lauernden Auswüchsen einer grausamen Realität vermischt
- 1.9 Die scheinbare Normalität des Familienlebens erweist sich als trügerisches Spiegelbild, durch das Nicht-Normales und Beängstigendes hindurchscheint
- 1.10 Am nächsten Morgen, bei Tageslicht, scheint die nächtliche Bedrohlichkeit verschwunden zu sein und die alltägliche Routine beginnt, aber dieser Eindruck ist nur vorübergehend
- 1.11 Der weitere Verlauf
- 2. Figurenkonstellation
- 2.1 Die Ich-Erzählerin
- 2.2 Vater und Mutter
- 2.3 Die Amme und ihre Tochter Marie
- 2.4 Weitere Figuren im Roman
- 2.4.1 Die Aufwartefrau: symbolische Todesfigur
- 2.4.2 Freundin Anna
- 2.4.3 Weitere Familienangehörige
- 3. Motive und Symbole
- 3.1 Versteinerung
- 3.2 Messer
- 3.3 Milch
- 3.4 Licht/Wärme - Dunkelheit/Kälte
- 3.5 Ordnung - Unordnung
- 4. Die Sprache der Gewalt: ein Vergleich mit Franz Kafkas Erzählung „In der Strafkolonie“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert Jenny Erpenbecks Roman "Wörterbuch" und untersucht dessen Inhalt, Figurenkonstellation, Motive und Symbole. Die Analyse zielt darauf ab, die komplexen Strukturen des Romans zu beleuchten und dessen literarische Mittel zu untersuchen. Ein Vergleich mit Franz Kafkas Werk soll weitere Einblicke ermöglichen.
- Analyse des Romans "Wörterbuch" im Hinblick auf seinen Inhalt und die Erzählstruktur
- Charakterisierung der wichtigsten Figuren und ihrer Beziehungen zueinander
- Interpretation der zentralen Motive und Symbole des Romans
- Untersuchung der sprachlichen Gestaltung und ihrer Wirkung
- Vergleich mit der Erzählung "In der Strafkolonie" von Franz Kafka
Zusammenfassung der Kapitel
1. Zum Inhalt des Romans: Der Roman "Wörterbuch" präsentiert sich als ein fragmentiertes, experimentelles Werk, das dem Leser viel Raum für Interpretationen lässt. Die Erzählung folgt einer Ich-Erzählerin, die ihre Kindheit und ihre Familie in einer Atmosphäre von Bedrohung und Ungewissheit beschreibt. Die scheinbar banalen Alltagssituationen werden mit beunruhigenden, oft metaphorisch dargestellten, Elementen der Gewalt und des Unbehagens vermischt. Die Analyse der Kapitel beschreibt die schrittweise Entfaltung dieser bedrohlichen Atmosphäre, die ihren Ursprung im Verhältnis der Erzählerin zu ihren Eltern und ihrer Umwelt hat. Der Text ist nicht linear und fordert den Leser aktiv zur Interpretation und zum Auffüllen der Lücken auf.
2. Figurenkonstellation: Dieser Abschnitt analysiert die zentralen Figuren des Romans und deren Beziehungen zueinander. Die Ich-Erzählerin, eine unzuverlässige Erzählerin mit einem zerrissenen Innenleben, steht im Mittelpunkt. Ihre Eltern, die Amme und ihre Tochter Marie, sowie weitere Figuren werden im Kontext ihrer Ambivalenz und Widersprüchlichkeit beleuchtet. Sie repräsentieren sowohl Fürsorge als auch Grausamkeit, Schutz und Bedrohung, und ihre Handlungen sind geprägt von einer dynamischen Unbeständigkeit. Die Analyse betont die grundsätzliche Widersprüchlichkeit der Figuren als zentrales Merkmal von Erpenbecks Figurenkonzeption.
3. Motive und Symbole: Hier werden die wiederkehrenden Motive und Symbole des Romans untersucht. Die Analyse konzentriert sich auf deren Ambivalenz und die Art und Weise, wie sie Alltägliches und Bedrohliches miteinander verbinden. Versteinerung, Messer und Milch werden als zentrale Symbole hervorgehoben, ebenso die Gegensatzpaare Licht/Dunkelheit und Ordnung/Unordnung. Der Abschnitt verdeutlicht, wie diese Motive und Symbole durch das Prisma der kindlichen Wahrnehmung gebrochen werden, wodurch sie eine verzerrte und oft überdimensionierte Wirkung entfalten.
Schlüsselwörter
Jenny Erpenbeck, Wörterbuch, Romananalyse, Figurenkonstellation, Motive, Symbole, Kindheitserinnerung, Gewalt, Ambivalenz, Unzuverlässige Erzählerin, Franz Kafka, "In der Strafkolonie", experimentelle Literatur, Sprachgewissheit, Identitätsverlust.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Jenny Erpenbecks "Wörterbuch"
Was ist der Inhalt der vorliegenden Analyse von Jenny Erpenbecks "Wörterbuch"?
Die Analyse bietet eine umfassende Übersicht über Jenny Erpenbecks Roman "Wörterbuch". Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, Zielsetzungen und thematische Schwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Inhalts, der Figurenkonstellation, der Motive und Symbole sowie einem Vergleich mit Franz Kafkas "In der Strafkolonie".
Welche Kapitel werden in der Inhaltsangabe behandelt?
Die Inhaltsangabe gliedert sich in vier Hauptkapitel: 1. Zum Inhalt des Romans (detaillierte Beschreibung der Erzählhandlung und der Atmosphäre), 2. Figurenkonstellation (Analyse der wichtigsten Figuren und ihrer Beziehungen), 3. Motive und Symbole (Interpretation zentraler Motive wie Versteinerung, Messer, Milch etc.), und 4. Die Sprache der Gewalt: ein Vergleich mit Franz Kafkas Erzählung „In der Strafkolonie“ (vergleichende Analyse der sprachlichen Gestaltung und der Darstellung von Gewalt).
Welche Zielsetzung verfolgt die Analyse?
Die Analyse zielt darauf ab, die komplexen Strukturen von Erpenbecks "Wörterbuch" zu beleuchten und dessen literarische Mittel zu untersuchen. Sie charakterisiert die Figuren, interpretiert Motive und Symbole, analysiert die sprachliche Gestaltung und vergleicht den Roman mit Franz Kafkas "In der Strafkolonie", um zusätzliche Einblicke zu gewinnen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Analyse konzentriert sich auf die Analyse des Romans im Hinblick auf seinen Inhalt und seine Erzählstruktur, die Charakterisierung der wichtigsten Figuren und ihrer Beziehungen, die Interpretation der zentralen Motive und Symbole, die Untersuchung der sprachlichen Gestaltung und ihrer Wirkung und den Vergleich mit Kafkas "In der Strafkolonie".
Wie werden die Kapitel zusammengefasst?
Jedem der vier Hauptkapitel ist eine Zusammenfassung gewidmet. Diese Zusammenfassungen fassen die wichtigsten Aspekte jedes Kapitels kurz und prägnant zusammen und geben einen Überblick über die behandelten Themen und Interpretationen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Analyse?
Die Analyse wird durch folgende Schlüsselwörter beschrieben: Jenny Erpenbeck, Wörterbuch, Romananalyse, Figurenkonstellation, Motive, Symbole, Kindheitserinnerung, Gewalt, Ambivalenz, Unzuverlässige Erzählerin, Franz Kafka, "In der Strafkolonie", experimentelle Literatur, Sprachgewissheit, Identitätsverlust.
Welche Figuren werden in der Analyse betrachtet?
Die Analyse konzentriert sich auf die Ich-Erzählerin, ihre Eltern, die Amme und deren Tochter Marie. Zusätzlich werden weitere Figuren wie die Aufwartefrau (symbolische Todesfigur), die Freundin Anna und andere Familienangehörige im Kontext ihrer Bedeutung für die Erzählung betrachtet.
Welche Motive und Symbole werden analysiert?
Die Analyse untersucht die Ambivalenz von Motiven und Symbolen wie Versteinerung, Messer, Milch, Licht/Dunkelheit und Ordnung/Unordnung. Es wird gezeigt, wie diese Motive und Symbole durch die kindliche Wahrnehmung gebrochen und überhöht werden.
Wie wird der Vergleich mit Franz Kafkas "In der Strafkolonie" durchgeführt?
Der Vergleich mit Kafkas "In der Strafkolonie" konzentriert sich auf die sprachliche Gestaltung und die Darstellung von Gewalt in beiden Werken. Es werden Parallelen und Unterschiede in der Art und Weise aufgezeigt, wie Gewalt und Bedrohung dargestellt und vermittelt werden.
- Quote paper
- Hans-Georg Wendland (Author), 2016, 'Wörterbuch' von Jenny Erpenbeck. Eine Rezension. Inhalt, Figurenkonstellation, Motive und Symbole, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336284