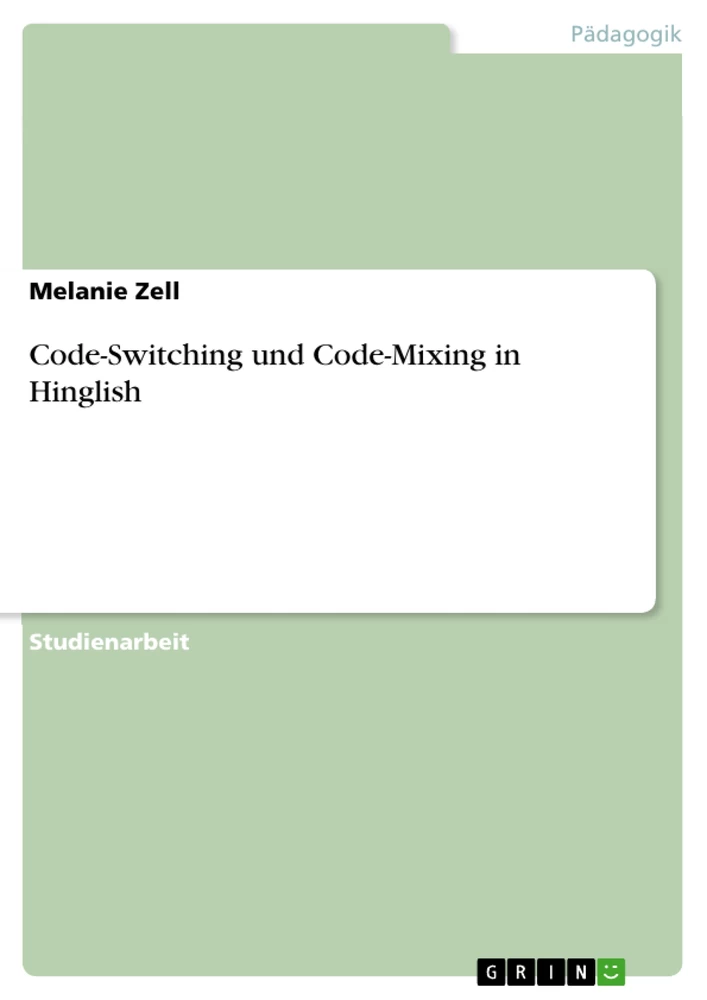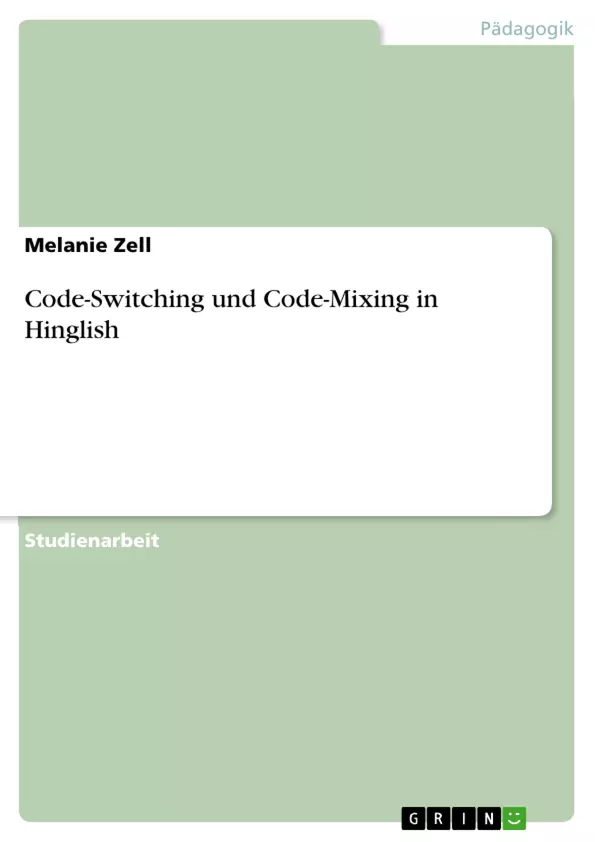Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die beiden Phänomene code-switching und code-mixing in Hinglish anhand von Beispielen aus Radioaufnahmen, Werbeslogans und einem Liedtext aus einem Bollywood-Film aufzuzeigen. Nach einer Erklärung des Begriffs Hinglish werde ich Arbeitsdefinitionen zu den beiden Phänomenen code-switching und code-mixing anführen. Diese werden jeweils mit Beispielen versehen, um sie zu veranschaulichen. Danach gehe ich auf den Aspekt der Dominanz einer Sprache ein, bevor ich konkrete Beispiele von Radioaufnahmen und den Liedtext aus einem Bollywood-Film hinsichtlich der beiden Phänomene analysiere. Schließlich fasse ich meine gewonnenen Erkenntnisse zusammen, um die Arbeit abzurunden.
Indien ist ein Land der Vielfalt: Zahlreiche Staaten, in denen Menschen mit verschiedenen Lebensgewohnheiten und Traditionen leben, religiöse Pluralität, Kleidung in kunterbunten Farben und Mustern, die je nach Staat variieren. Außerdem sind in Indien durch die geographische Lage alle klimatischen Zonen vorzufinden.
Diese, an den wenigen Beispielen aufgezeigte Vielfalt, spiegelt sich auch in der Sprache wider: Indien ist eine vielsprachige Gesellschaft. In meinem Auslandssemester im Norden Indiens, in Rajasthan habe ich mit der Mittlersprache „Englisch“ Hindi gelernt. Neben dem Vorhandensein vieler Sprachen nebeneinander habe ich dabei vor allem auch eine Vermischung der Sprachen bemerkt. Dabei wurde mir die Vermischung von Hindi und Englisch besonders bewusst, da ich die Sprachen gelernt habe. Aus diesem Grund möchte ich in meiner Arbeit das Phänomen, das die Autoren Kothari et al. „Hinglish“ nennen, näher betrachten.
Dabei werde ich mich der Methode des Sprachvergleichs bedienen. Mein Hauptaugenmerk liegt also auf der sprachwissenschaftlichen Komponente. Hintergründe wie, warum Inder in einer bestimmten Situation Hindi und in einer anderen Englisch sprechen, werden dabei am Rande behandelt.
Eine Bollywood-Schauspielerin machte im Fernsehen beispielsweise Werbung für ein Sham-poo mit den folgenden Worten „Come on girls, waqt hai shine karne ka!“ (Nordquist): Der zweite Teil des Satzes, der auf Hindi formuliert wurde, bedeutet auf Englisch „It’s time to shine!“.
Laut Nordquist, dem Verfasser der Website, die das Beispiel der oben aufgeführten Sham-poo-Werbung zeigt, sei Hinglish momentan der hippeste Slang auf den Straßen sowie an Uni-versitäten Indiens. 350 Millionen Menschen sprächen bereits Hinglish in städtischen Gebieten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Definition „Hinglish“
- 2. Kodewechsel
- 2.1 Vom Kode zum Kodewechsel
- 2.2 Code-switching vs. code-mixing
- 2.3 Die Abgrenzung zu „Denglisch“ und die dominante Sprache
- 3. Weitere Beispiele aus dem Radio, Werbeslogans und einem Bollywood-Film
- 3.1 Analysen von Beispielen aus dem Radio nach Kothari et al.
- 3.2 Eigenanalyse von Beispielen aus der Werbung
- 3.3 Analyse von einem Liedtext: Sach sach sach o dear sach sach..
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen „Hinglish“, eine Mischung aus Hindi und Englisch, in Indien. Das Hauptziel ist es, die Verwendung von Code-switching und Code-mixing in Hinglish anhand konkreter Beispiele aus verschiedenen Medien (Radio, Werbung, Bollywood-Filme) aufzuzeigen und zu analysieren. Die sprachwissenschaftliche Komponente steht dabei im Vordergrund.
- Definition und Charakteristika von Hinglish
- Unterscheidung zwischen Code-switching und Code-mixing
- Analyse von Hinglish in verschiedenen Kontexten (Radio, Werbung, Bollywood)
- Die Rolle der dominanten Sprache im Kontext von Hinglish
- Hinglish als Spiegel der kulturellen und sprachlichen Vielfalt Indiens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Hinglish ein und beschreibt den Kontext der vielsprachigen Gesellschaft Indiens. Sie begründet die Wahl des Themas und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der sprachwissenschaftlichen Betrachtung von Code-switching und Code-mixing in Hinglish, wobei soziokulturelle Hintergründe nur am Rande behandelt werden. Ein Beispiel aus der Bollywood-Werbung dient als anschauliche Einleitung und veranschaulicht die Verbreitung von Hinglish.
1. Definition „Hinglish“: Dieses Kapitel definiert den Begriff Hinglish als eine Mischung aus Hindi und Englisch, und betont, dass es sich nicht um eine eigenständige Sprache, sondern um eine Kommunikationsform handelt. Es werden die kulturellen und sprachlichen Hintergründe erläutert und der Kontrast zwischen der traditionellen Bedeutung von Hindi und der westlich orientierten Amtssprache Englisch hervorgehoben. Der Begriff der „private codes“ und „public codes“ wird in diesem Zusammenhang eingeführt, um die verschiedenen Nutzungskontexte zu differenzieren.
2. Kodewechsel: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept des Kodewechsels, beginnend mit der Definition des Begriffs „Kode“ und seiner verschiedenen Bedeutungen. Es führt dann die Unterscheidung zwischen Code-switching und Code-mixing ein und analysiert diese im Kontext von Hinglish. Die Abgrenzung zu „Denglisch“ und die Rolle der dominanten Sprache werden ebenfalls diskutiert. Die Kapitelteile 2.1 und 2.2 liefern die theoretischen Grundlagen für die folgenden Analysen von konkreten Beispielen.
3. Weitere Beispiele aus dem Radio, Werbeslogans und einem Bollywood-Film: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert konkrete Beispiele aus verschiedenen Medien. Es beinhaltet detaillierte Analysen von Radioaufnahmen, Werbeslogans und einem Liedtext aus einem Bollywood-Film, um die Anwendung von Code-switching und Code-mixing in Hinglish zu veranschaulichen und zu untersuchen. Die Analysen belegen die vielfältige und dynamische Verwendung von Hinglish in der indischen Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Hinglish, Code-switching, Code-mixing, Hindi, Englisch, Indien, Mehrsprachigkeit, Sprachkontakt, Sprachmischung, Sprachvergleich, Bollywood, Werbung, Radio.
Hinglish-Analyse: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen „Hinglish“, eine Mischung aus Hindi und Englisch, in Indien. Der Fokus liegt auf der sprachwissenschaftlichen Analyse von Code-switching und Code-mixing in Hinglish anhand von Beispielen aus verschiedenen Medien wie Radio, Werbung und Bollywood-Filmen.
Welche Ziele werden verfolgt?
Das Hauptziel ist es, die Verwendung von Code-switching und Code-mixing in Hinglish aufzuzeigen und zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Definition und Charakteristika von Hinglish, die Unterscheidung zwischen Code-switching und Code-mixing, die Analyse von Hinglish in verschiedenen Kontexten und die Rolle der dominanten Sprache (Englisch) im Kontext von Hinglish. Hinglish wird auch als Spiegel der kulturellen und sprachlichen Vielfalt Indiens betrachtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Hinglish, ein Kapitel zum Kodewechsel (Code-switching und Code-mixing), ein Kapitel mit Beispielanalysen aus Radio, Werbung und einem Bollywood-Film und eine Zusammenfassung. Die Einleitung führt in das Thema ein und begründet die gewählte Perspektive. Kapitel 1 definiert Hinglish und erläutert kulturelle und sprachliche Hintergründe. Kapitel 2 befasst sich mit theoretischen Grundlagen des Kodewechsels. Kapitel 3 analysiert konkrete Beispiele aus verschiedenen Medien. Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird Hinglish definiert?
Hinglish wird als eine Mischung aus Hindi und Englisch definiert. Es wird betont, dass es sich nicht um eine eigenständige Sprache, sondern um eine Kommunikationsform handelt. Die Arbeit erklärt die kulturellen und sprachlichen Hintergründe und den Kontrast zwischen traditionellem Hindi und dem westlich orientierten Englisch.
Was ist der Unterschied zwischen Code-switching und Code-mixing?
Die Arbeit definiert und unterscheidet klar zwischen Code-switching und Code-mixing im Kontext von Hinglish. Diese Unterscheidung bildet die Grundlage für die Analysen in Kapitel 3.
Welche Beispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert konkrete Beispiele aus dem Radio (basierend auf Arbeiten von Kothari et al.), Werbeslogans und einem Liedtext aus einem Bollywood-Film. Diese Analysen veranschaulichen die vielfältige und dynamische Verwendung von Hinglish in der indischen Gesellschaft.
Welche Rolle spielt die dominante Sprache?
Die Arbeit untersucht die Rolle der dominanten Sprache (Englisch) im Kontext von Hinglish und analysiert deren Einfluss auf die Verwendung von Code-switching und Code-mixing.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hinglish, Code-switching, Code-mixing, Hindi, Englisch, Indien, Mehrsprachigkeit, Sprachkontakt, Sprachmischung, Sprachvergleich, Bollywood, Werbung, Radio.
- Quote paper
- Melanie Zell (Author), 2013, Code-Switching und Code-Mixing in Hinglish, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336360