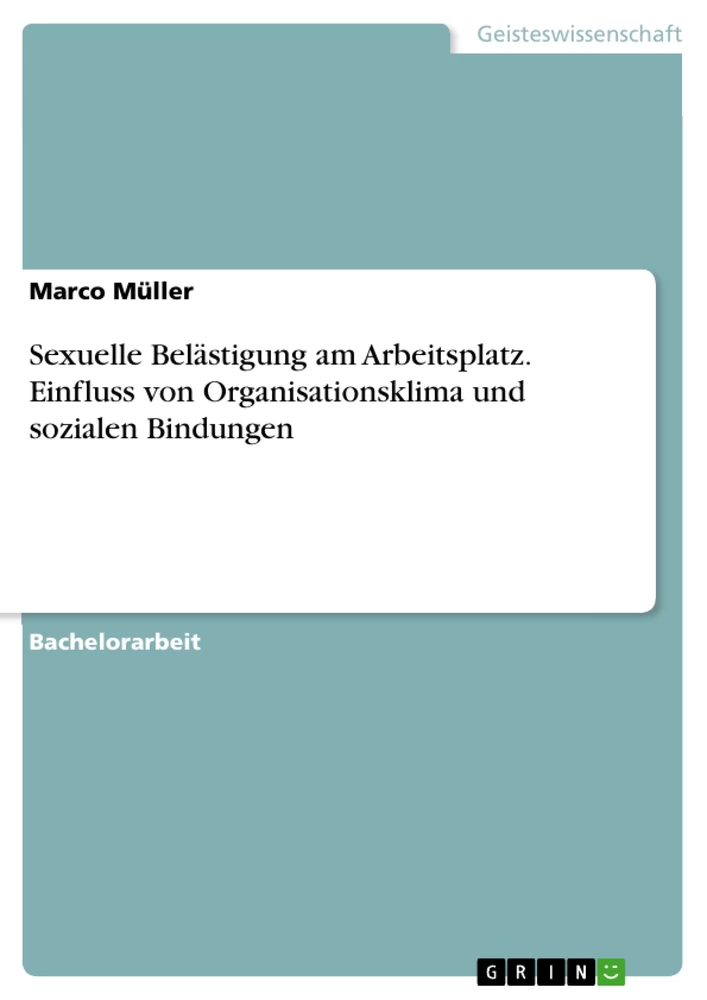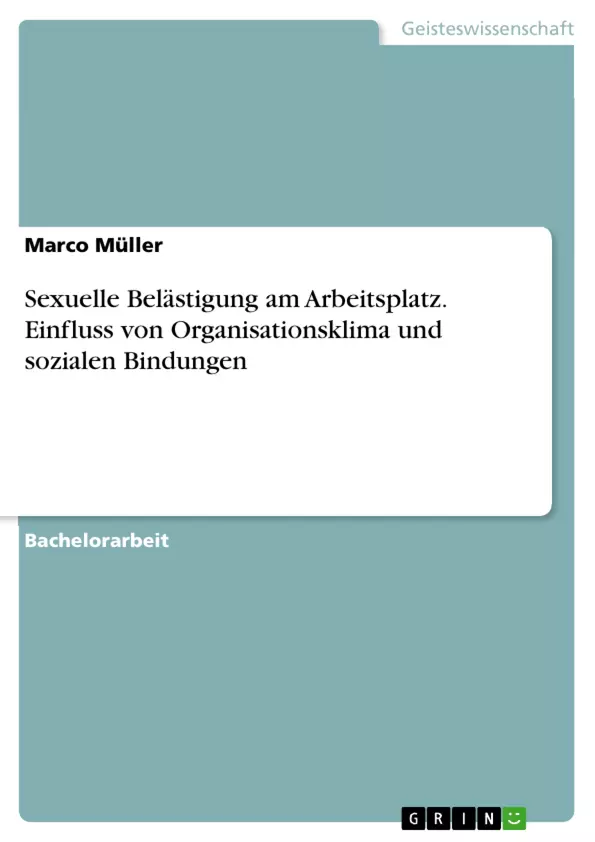Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist ein Problem für die Gesellschaft und Unternehmen sind ständig damit konfrontiert. Definitions- und Abgrenzungsschwierigkeiten und unzureichende theoretische Modelle führten bisher zu keiner nachhaltigen Lösung des Problems. Die vorliegende Bachelorarbeit ist als Literaturreview konzipiert und untersucht anhand von 20 empirischen Studien, welche organisationalen Faktoren als Ursache von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz benannt werden können und unter welchen Konstellationen Frauen Hindernisse beim beruflichen Aufstieg erleben. Dazu werden die Ergebnisse anhand der Fragestellungen chronologisch aufgestellt und diskutiert.
Das Organisationsklima und soziale Bindungen werden dabei als Hauptfaktoren herausgestellt. Frauen erfahren den meisten Widerstand in männerdominierenden Arbeitsumgebungen und wenn sie ein für sie atypisches Geschlechtsverhalten zeigen. Zur Prävention von sexueller Belästigung werden eine offenere Kommunikation innerhalb und zwischen Betrieben sowie eine klares Bekenntnis gegen sexuelle Belästigung herausgestellt. Auch die offiziellen Stellen stehen in der Pflicht direkter auf die Unternehmen zuzugehen.
Anders als in der Bevölkerung angenommen ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz keine Randerscheinung. Sie betrifft einen Großteil der Bevölkerung, möglicherweise mehr als jede andere Form von Diskriminierung und Gewalt. Nahezu alle Unternehmen sind als Teil der Gesellschaft regelmäßig mit dem Phänomen konfrontiert.
Die Equal Employment Opportunity Commission (nachfolgend: EEOC), die Bundesbehörde zur Sicherstellung von Gleichbehandlung in Beruf und Arbeit in den USA, berichtete für das Jahr 2011 von 11.364 gemeldeten Fällen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Sie beziffert den gesellschaftlichen Gesamtschaden auf 52,3 Millionen US-Dollar. Dabei ist von einer hohen Dunkelziffer an Opfern auszugehen, die aus Angst und Unwissenheit schweigen und damit erst gar nicht den Weg in die offizielle Statistik finden. In der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland gestaltet sich die Situation ähnlich.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Definition: Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
- 2.2 Prävalenz und Belästigungskonstellationen
- 2.3 Erscheinungsformen
- 2.4 Folgen für Betroffene und Unternehmen
- 2.5 Psychologische Begriffsbestimmung
- 2.6 Ursachen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz
- 2.6.1 Natürlich-biologische Perspektive
- 2.6.2 Soziokulturelle Perspektive
- 2.6.3 Organisationstheoretische Perspektive
- 2.6.4 Weitere Erklärungsansätze
- 2.7 Fragestellungen
- 3. Methodik
- 3.1 Vorgehensweise
- 3.2 Ein- und Ausschlusskriterien für Literatur
- 3.3 Einbezogene Quellen
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Einflussfaktoren des Arbeitsumfelds
- 4.2 Berufliche Hindernisse für Frauen
- 5. Diskussion
- 5.1 Präventionsmöglichkeiten für Unternehmen
- 5.3 Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit analysiert die Ursachen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Sie konzentriert sich auf die Rolle des Arbeitsumfelds und untersucht, wie organisationale Faktoren zu sexueller Belästigung beitragen und welche Konstellationen Frauen berufliche Hindernisse erleben lassen. Die Arbeit ist als Literaturreview konzipiert und basiert auf der Analyse von 20 empirischen Studien.
- Der Einfluss des Arbeitsumfelds auf sexuelle Belästigung
- Die Rolle von Organisationsklima und sozialen Bindungen
- Berufliche Hindernisse für Frauen in männerdominierten Arbeitsumgebungen
- Die Bedeutung von Geschlechtsverhalten und Kommunikation
- Präventionsmöglichkeiten für Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vor und erläutert die Relevanz des Themas. Sie skizziert die Forschungslücke und die Zielsetzung der Arbeit.
- Kapitel 2: Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über die Definition, Prävalenz, Erscheinungsformen und Folgen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Es beleuchtet verschiedene psychologische Perspektiven und untersucht die Ursachen des Phänomens, einschließlich natürlicher, soziokultureller und organisationstheoretischer Ansätze.
- Kapitel 3: Methodik: Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise der Literaturrecherche, die Ein- und Ausschlusskriterien für die Studien und die einbezogenen Quellen.
- Kapitel 4: Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Literaturanalyse und beleuchtet die Einflussfaktoren des Arbeitsumfelds auf sexuelle Belästigung sowie die beruflichen Hindernisse, die Frauen in diesem Kontext erfahren.
Schlüsselwörter
Sexuelle Belästigung, Arbeitsumfeld, Organisationstheorie, Organisationsklima, Soziale Bindungen, Geschlechtsverhalten, Berufliche Hindernisse, Frauen, Präventionsmöglichkeiten, Empirische Studien, Literaturreview.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptursachen für sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz?
Das Organisationsklima und soziale Bindungen innerhalb des Unternehmens werden als entscheidende Faktoren identifiziert.
In welchen Branchen tritt sexuelle Belästigung besonders häufig auf?
Frauen erfahren laut der Studie den meisten Widerstand und Belästigungen in männerdominierten Arbeitsumgebungen.
Welche Folgen hat sexuelle Belästigung für Unternehmen?
Neben dem Leid der Betroffenen entstehen hohe Kosten durch Fehlzeiten, Fluktuation und Produktivitätsverlust (in den USA 2011 ca. 52,3 Mio. Dollar Schaden).
Wie können Unternehmen sexuelle Belästigung verhindern?
Durch ein klares Bekenntnis gegen Belästigung, offene Kommunikation und die Etablierung präventiver Organisationsstrukturen.
Wie hoch ist die Dunkelziffer bei diesem Thema?
Es wird von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgegangen, da viele Opfer aus Angst vor beruflichen Nachteilen oder Unwissenheit schweigen.
- Arbeit zitieren
- Marco Müller (Autor:in), 2016, Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Einfluss von Organisationsklima und sozialen Bindungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337758