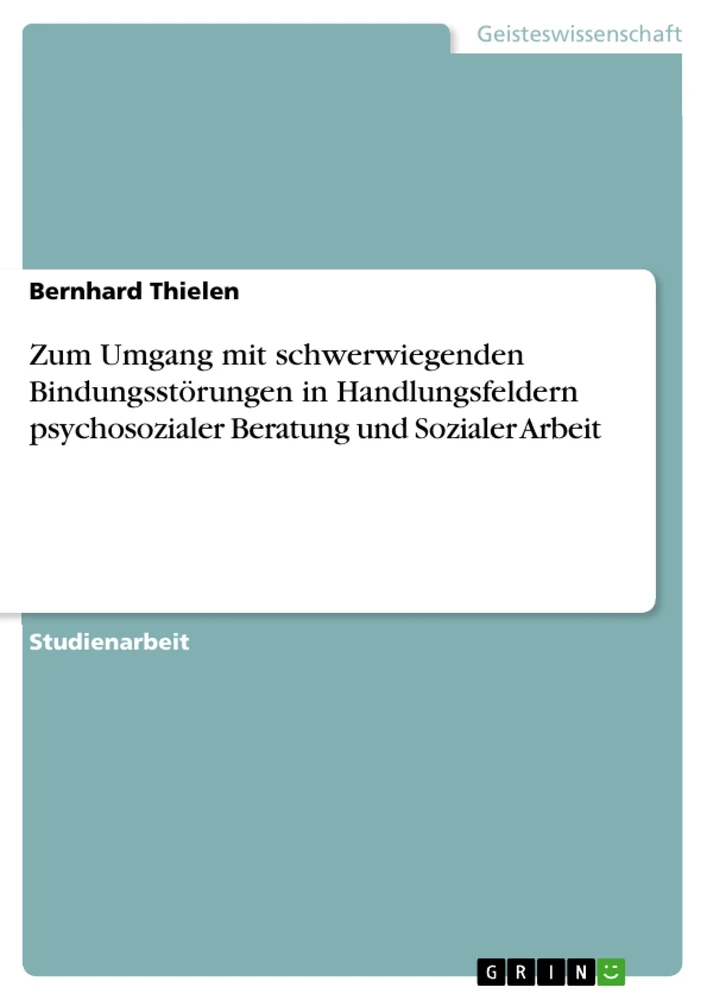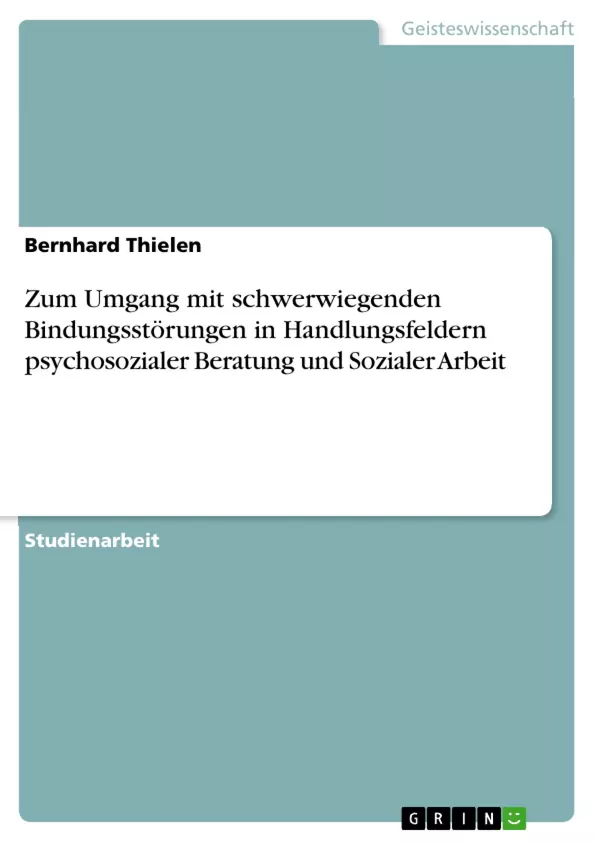Schwerwiegende Bindungsstörungen verursachen oft auch noch im Erwachsenenalter erhebliches Leiden und können zu Hindernissen in reifen Paarbeziehungen werden, selbst wenn frühe Bindungsstile kein „Schicksal“ darstellen müssen. Die Qualität der Bindungsorganisation einer Person kann dabei als einer von vielen möglichen „Schutz- bzw. Risikofaktoren“ gegenüber der Entwicklung von psychischen Störungen und abweichendem Verhalten betrachtet werden. Die Erfahrung der Eltern als einer sicheren Basis geht dabei oft mit späteren sozialen Kompetenzen, einem eher positiv realistischem Selbstbild sowie Selbstwirksamkeit und Impulskontrolle einher.
Im Umgang mit kleinen oder großen Hilfesuchenden sind Angehörige und professionelle Helfer daher oft genug mit dem Thema Bindung konfrontiert. Ganz besonders bei Klein- und Vorschulkindern ist hier nicht selten durch die Fachkräfte einzuschätzen, ob der Umgang mit den leiblichen Eltern im Sinne des Kindeswohls zumindest befristet unterbunden werden muss. Dieser wissenschaftliche Text geht dem Thema in folgenden Schritten nach. Zunächst soll in Kapitel II. „Bindung als menschliches Grundbedürfnis“ der allgemeine Forschungs- und Theoriestand skizziert werden. Im Anschluss daran folgt in Kapitel III. „Klinische Relevanz von Bindungserfahrungen“ eine allgemeine Annäherung an das pathologische Phänomen gestörte Bindung und der Versuch den Zusammenhang solcher Störungen zu psychiatrischen Störungsbildern anzudeuten. Zuletzt erfolgt unter Punkt IV. „Umgang mit Bindungsstörungen in Handlungsfeldern Sozialer Arbeit und psychosozialer Beratung“ eine Einbeziehung des „vielgestaltigen“ Hilfekontextes von Sozialer Arbeit und psychosozialer Beratung als „Querschnittsmethoden“ psychosozialen Handelns und ihrer besonderen Anforderungen, in die zuvor dargestellten Überlegungen. Hierbei wird es ganz besonders um die praxisbezogene Anwendbarkeit der zuvor vorgestellten Ansätze im Rahmen von psychosozialer Beratung gehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bindung als menschliches Grundbedürfnis
- Die vier psychischen Grundbedürfnisse nach Grawe
- Klinische Relevanz von Bindungserfahrungen
- Umgang mit Bindungsstörungen in Handlungsfeldern psychosozialer Beratung und Sozialer Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Umgang mit schwerwiegenden Bindungsstörungen und beleuchtet die Bedeutung von Bindung als psychischem Grundbedürfnis sowie die klinische Relevanz von Bindungserfahrungen. Sie analysiert die Herausforderungen im Umgang mit Bindungsstörungen in den Handlungsfeldern der psychosozialen Beratung und der Sozialen Arbeit.
- Die Bedeutung von Bindung als psychischem Grundbedürfnis
- Die klinische Relevanz von Bindungserfahrungen und ihre Auswirkungen auf die psychische Gesundheit
- Die Herausforderungen im Umgang mit Bindungsstörungen in der psychosozialen Beratung und Sozialen Arbeit
- Die Rolle von Bindungsstörungen in der Entstehung von psychischen Störungen
- Die Bedeutung frühkindlicher Bindungserfahrungen für die Entwicklung von sozialen Kompetenzen und Selbstwirksamkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz des Themas Bindungsstörungen in der heutigen Gesellschaft und zeigt auf, wie die Thematik sowohl in der wissenschaftlichen als auch in der öffentlichen Diskussion präsent ist. Sie stellt den Zusammenhang zwischen Bindungsstörungen und der psychischen Entwicklung von Kindern und Erwachsenen heraus und hebt die Bedeutung früher Bindungserfahrungen für die spätere Entwicklung hervor.
Bindung als menschliches Grundbedürfnis
Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Bindung als psychisches Grundbedürfnis und stellt das Konzept der vier psychischen Grundbedürfnisse nach Grawe vor. Es werden die zentralen Merkmale dieser Grundbedürfnisse, wie das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung, Orientierung und Kontrolle, Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung sowie Bindung, erläutert. Darüber hinaus wird die Bedeutung des Konsistenzprinzips nach Grawe und dessen Zusammenhang mit der Grundbedürfnisbefriedigung betrachtet.
Klinische Relevanz von Bindungserfahrungen
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den klinischen Auswirkungen von Bindungserfahrungen auf die psychische Entwicklung und die Entstehung von psychischen Störungen. Es werden verschiedene Formen von Bindungsstörungen und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung von sozialen Kompetenzen, Selbstwirksamkeit und Impulskontrolle beleuchtet. Darüber hinaus werden die Herausforderungen im Umgang mit Bindungsstörungen in der Praxis und die Bedeutung von frühzeitigen Interventionen betont.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen und Themen der Bindungstheorie, der Entwicklungspsychologie, der psychosozialen Beratung und der Sozialen Arbeit. Die Schwerpunktthemen sind Bindungsstörungen, psychische Grundbedürfnisse, frühkindliche Bindungserfahrungen, Konsistenzregulation, Konsistenzprinzip, psychosoziale Beratung, Soziale Arbeit, Hilfekontext und Umgang mit schwierigen Klienten.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Folgen schwerwiegender Bindungsstörungen im Erwachsenenalter?
Sie können zu erheblichem Leiden, Hindernissen in Paarbeziehungen und einem erhöhten Risiko für psychische Störungen führen.
Welche psychischen Grundbedürfnisse nennt Grawe?
Nach Grawe gibt es vier Grundbedürfnisse: Bindung, Orientierung und Kontrolle, Selbstwertschutz sowie Lustgewinn/Unlustvermeidung.
Warum ist die Erfahrung einer "sicheren Basis" für Kinder wichtig?
Eine sichere Bindung zu den Eltern fördert soziale Kompetenzen, ein realistisches Selbstbild, Selbstwirksamkeit und eine bessere Impulskontrolle.
Wie gehen Fachkräfte der Sozialen Arbeit mit Bindungsstörungen um?
Sie müssen oft einschätzen, ob der Umgang mit leiblichen Eltern dem Kindeswohl entspricht oder ob Interventionen zum Schutz des Kindes notwendig sind.
Sind frühe Bindungsstile ein unabänderliches Schicksal?
Nein, die Arbeit betont, dass Bindungsstile kein Schicksal sein müssen, auch wenn sie starke Risikofaktoren darstellen können.
- Citation du texte
- Bernhard Thielen (Auteur), 2014, Zum Umgang mit schwerwiegenden Bindungsstörungen in Handlungsfeldern psychosozialer Beratung und Sozialer Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/337973