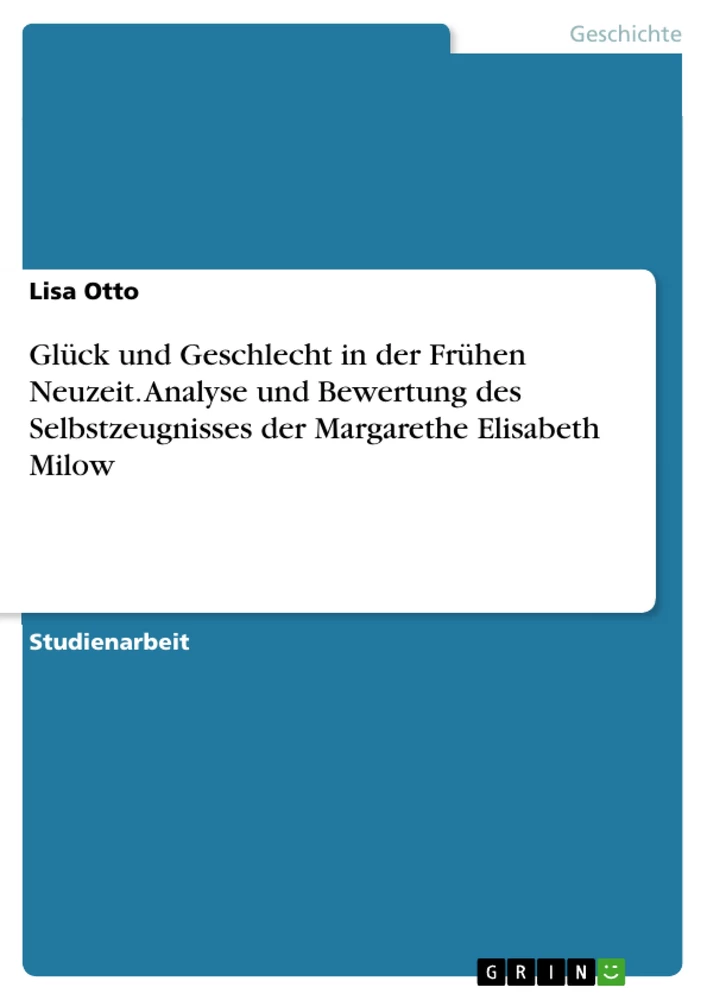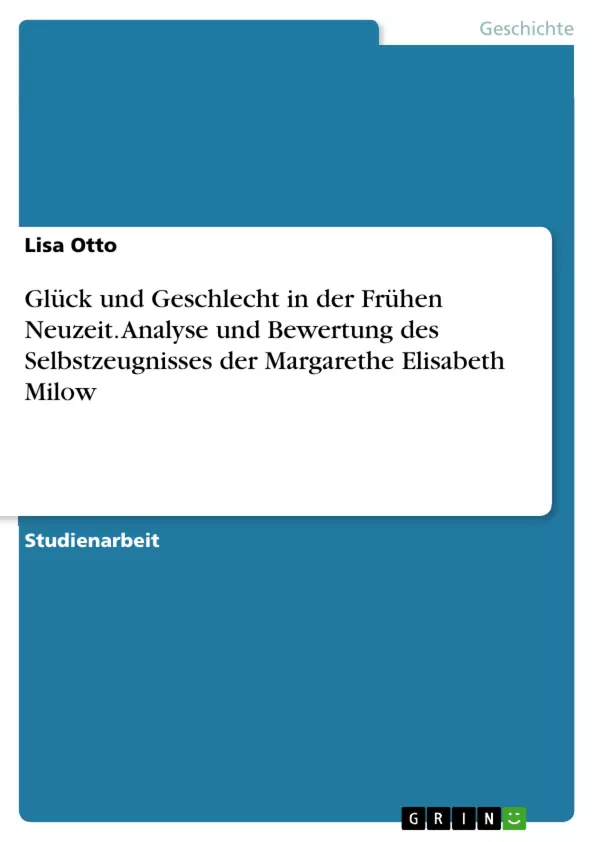Die vorliegende Hausarbeit liefert eine Analyse des Selbstzeugnisses der Margarethe Elisabeth Milow. Besonders interessant ist, dass es sich hier um ein Stück Alltagsgeschichte handelt. Bereits die einleitenden Worte legen die Intention ihres Textes dar: Sie möchte ihre eigenen Lebenserfahrungen festhalten und mit ihrer Familie teilen, denn an diese ist ihr Text adressiert. Diese Intention charakterisiert den Text somit als Selbstzeugnis, man kann sogar weiter gehen und sagen, als Autobiographie. Die inhaltliche Trennung zwischen Selbstzeugnis und Autobiographie wird im ersten Teil des Hauptteiles dieser Arbeit näher betrachtet.
Wenn Margarethe Milow von einem Geschichtsbuch schreibt, dann meint sie nicht jenes, das in der Schule oder aber im Studium zur Hand genommen wird, sondern vielmehr ein Geschichtenbuch, das ihr Leben detailliert wiedergibt. Jedoch sehen wir eben dieses Buch heute aus einer ganz anderen Sicht, als es die ursprüngliche Intention der Milow gewesen war: Wir lesen es als eines der wenigen Zeugnisse bürgerlicher Hausfrauen, von deren Leben wir bis dato nur aus Nebenerwähnungen berühmter Männer erfahren haben. Daher widmet sich ein Kapitel dieser Arbeit der Frauen- und
Geschlechtergeschichte.
Die Untersuchung des Textes soll verschiedene Aspekte berücksichtigen: Es muss geklärt werden, inwiefern sich die Lebenserinnerungen ins Genre Selbstzeugnis einordnen lassen und welche forschungsrelevanten Probleme dabei auftauchen. Werden die Themen der Geschlechterordnungen sowie des Glücksbegriffes greifbar?
Inhaltsverzeichnis
- Fragestellung
- Manuskript
- Der dritte Teil des Manuskriptes
- Schreibmotivation
- Das Selbstzeugnis als Methode
- Handlungsspielräume der bürgerlichen Frau im 18. Jahrhundert
- Einfluss der Aufklärung
- Margarethe Elisabeth Milow als Frau im Hamburg des 18. Jahrhunderts
- ,,häusliches Glück – das größte Glück dieses Lebens"
- Die Ehe der Milows und Geschlechterordnungen
- Die von Männern gemachte Geschichte
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert und bewertet das Selbstzeugnis der Margarethe Elisabeth Milow. Im Fokus steht die Betrachtung des Textes unter dem Aspekt der Geschlechterordnungen und des Glücksbegriffes der Frühen Neuzeit. Die Arbeit erforscht die Lebenserfahrungen einer bürgerlichen Frau im 18. Jahrhundert, die Rolle der Frau in der damaligen Gesellschaft sowie die Bedeutung von Glück in ihrem Leben.
- Das Selbstzeugnis als Quelle für die Erforschung der Lebenswelt bürgerlicher Frauen im 18. Jahrhundert
- Die Rolle von Geschlechterordnungen in der Frühen Neuzeit und ihre Auswirkungen auf das Leben von Frauen
- Der Glücksbegriff in der Frühen Neuzeit und seine Relevanz für Margarethe Elisabeth Milow
- Die Bedeutung von Familie und Glaube im Leben von Margarethe Elisabeth Milow
- Die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Position als bürgerliche Hausfrau im 18. Jahrhundert ergaben
Zusammenfassung der Kapitel
- Fragestellung: Dieses Kapitel stellt die Forschungsfrage der Arbeit vor und gibt einen Einblick in das Selbstzeugnis von Margarethe Elisabeth Milow. Es beleuchtet die Intention der Autorin, ihre Lebenserfahrungen festzuhalten und mit ihrer Familie zu teilen.
- Das Selbstzeugnis als Methode: Dieses Kapitel untersucht die Relevanz des Selbstzeugnisses als Forschungsmethode und beleuchtet die Handlungsspielräume bürgerlicher Frauen im 18. Jahrhundert. Es analysiert den Einfluss der Aufklärung auf die Lebenswelt von Frauen und die Bedeutung des Selbstzeugnisses für die Geschichtsschreibung.
- Margarethe Elisabeth Milow als Frau im Hamburg des 18. Jahrhunderts: Dieses Kapitel widmet sich der Einordnung von Margarethe Elisabeth Milow in die gesellschaftliche und historische Situation des 18. Jahrhunderts. Es beleuchtet die Rolle der Frau in der Hamburger Gesellschaft sowie die Herausforderungen und Chancen, die sich für Frauen im 18. Jahrhundert ergaben.
- ,,häusliches Glück – das größte Glück dieses Lebens": Dieses Kapitel untersucht den Glücksbegriff der Margarethe Elisabeth Milow und seine Bedeutung für ihr Leben. Es analysiert die Faktoren, die zu ihrem Glück führten, und beleuchtet die Bedeutung von Familie, Glaube und innerer Zufriedenheit für ihren Glücksbegriff.
- Die Ehe der Milows und Geschlechterordnungen: Dieses Kapitel untersucht die Ehe von Margarethe Elisabeth Milow und ihren Ehemann im Kontext der Geschlechterordnungen der Frühen Neuzeit. Es analysiert die Rolle des Mannes in der Ehe und die Herausforderungen, die sich für Frauen aus den bestehenden Geschlechterrollen ergaben.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den Themen Selbstzeugnis, Geschlechterordnungen, Glücksbegriff, bürgerliche Frau, Frühe Neuzeit, Hamburg, Familie, Glaube, Hausfrauenleben, Lebenserfahrungen, Lebenswelt, Aufklärung.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Margarethe Elisabeth Milow?
Margarethe Elisabeth Milow war eine bürgerliche Frau im Hamburg des 18. Jahrhunderts, die ihre Lebenserfahrungen in einem umfangreichen Selbstzeugnis festhielt.
Warum ist ihr Text für die Geschichtsforschung so bedeutend?
Es ist eines der wenigen Zeugnisse bürgerlicher Hausfrauen aus dieser Zeit und bietet einen seltenen Einblick in die Alltagsgeschichte aus weiblicher Perspektive.
Was verstand Margarethe Milow unter „häuslichem Glück“?
Für sie war das häusliche Glück das größte Glück des Lebens, basierend auf Faktoren wie Familie, Glaube und innerer Zufriedenheit.
Welche Rolle spielte die Aufklärung in ihrem Leben?
Die Arbeit analysiert, wie die Aufklärung die Handlungsspielräume und die Lebenswelt bürgerlicher Frauen im 18. Jahrhundert beeinflusste.
Wie werden die Geschlechterordnungen in ihrer Ehe dargestellt?
Die Analyse untersucht die Rollenverteilung in der Ehe der Milows im Kontext der damaligen, von Männern geprägten gesellschaftlichen Strukturen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Selbstzeugnis und einer Autobiographie?
Die Arbeit setzt sich theoretisch mit der methodischen Abgrenzung dieser beiden Begriffe innerhalb der Geschichtswissenschaft auseinander.
- Citation du texte
- Lisa Otto (Auteur), 2016, Glück und Geschlecht in der Frühen Neuzeit. Analyse und Bewertung des Selbstzeugnisses der Margarethe Elisabeth Milow, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338532