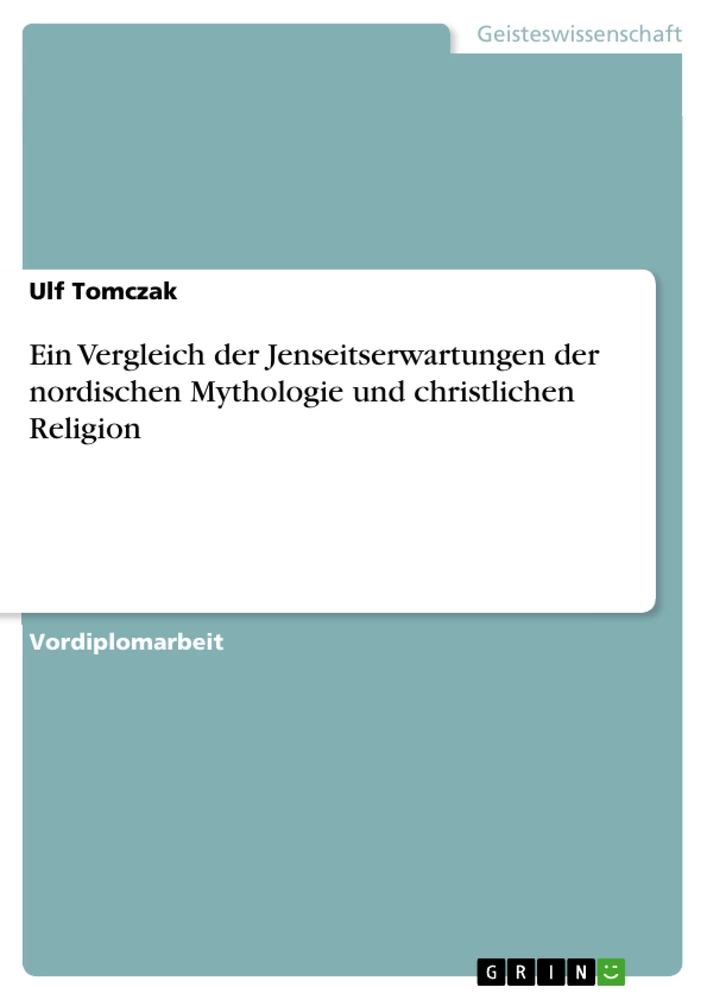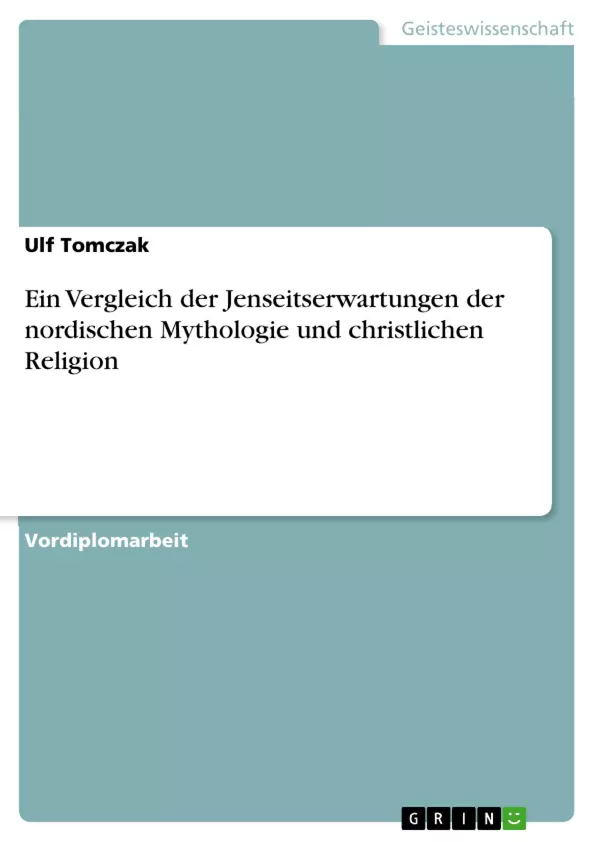Eine wichtige Frage, die sich vermutlich nahezu jeder Mensch – spätestens, wenn er einen geliebten Menschen verloren hat – stellt, ist die nach dem Leben nach dem Tod. Was kommt, wenn das irdische Leben beendet ist und wie geht es danach weiter? Steigt man auf in ein Himmelreich, stirbt auch die Seele?
Ich stelle mir ebenfalls diese Fragen. Was passiert mit Familie, Freunden und mir, wenn der Tag gekommen ist, an dem das Leben im Hier und Jetzt vorüber ist?
Auch wenn auf die Frage nach einem exakten Ablaufplan in dieser Arbeit mit hoher Wahrscheinlichkeit nur eine Annäherung erreicht werden kann, so bin ich doch daran interessiert, auszuarbeiten, an was Menschen lange Zeit vor mir, aber auch noch heute glauben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Postmortalitätsvorstellung der nordischen Mythologie
- 2.1 Götter und Jenseitsvorstellung
- 2.2 Das Diesseits
- 2.3 Opferkult und Totenbeisetzung
- 2.4 Weltende
- 3. Die Postmortalitätsvorstellung im Christentum
- 3.1 Gott und Jenseitsvorstellung
- 3.2 Das Diesseits
- 3.3 Opferkult und Totenbeisetzung
- 3.4 Weltende
- 4. Ein Vergleich der Jenseitsvorstellungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Vorstellungen vom Jenseits in der nordischen Mythologie und im Christentum zu vergleichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herauszuarbeiten. Der Fokus liegt auf den jeweiligen Konzepten von Tod, Leben nach dem Tod, Gottesvorstellungen und der Bedeutung von Opferkult und Totenriten.
- Vorstellungen vom Jenseits in der nordischen Mythologie
- Vorstellungen vom Jenseits im Christentum
- Vergleich der Konzepte von Tod und Leben nach dem Tod
- Rollen der Götter/Gottes im jeweiligen Kontext
- Bedeutung von Opferkult und Totenbeisetzung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel dient als Einführung in die Thematik des Vergleichs der Jenseitsvorstellungen der nordischen Mythologie und des Christentums. Es skizziert die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise der Arbeit, legt die Bedeutung des Themas dar und bietet eine kurze Übersicht über die folgenden Kapitel.
2. Die Postmortalitätsvorstellung der nordischen Mythologie: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit den Vorstellungen vom Leben nach dem Tod in der nordischen Mythologie. Es analysiert die Rollen der Götter im Kontext des Jenseits, beleuchtet die Konzepte des Diesseits und ihre Verbindung zum Jenseits, untersucht die Praktiken des Opferkults und der Totenbeisetzung und betrachtet schließlich die nordischen Vorstellungen vom Weltende und der damit verbundenen Jenseitsvorstellungen. Die verschiedenen Aspekte werden im Detail analysiert und in ihren Zusammenhängen dargestellt, um ein umfassendes Bild der nordischen Jenseitsvorstellungen zu liefern.
3. Die Postmortalitätsvorstellung im Christentum: Ähnlich wie Kapitel 2, konzentriert sich dieses Kapitel auf die christlichen Vorstellungen vom Jenseits. Es analysiert die Rolle Gottes, die Konzepte des Diesseits und ihre Beziehung zum Jenseits, untersucht den Opferkult und die Riten der christlichen Totenbeisetzung, sowie die eschatologischen Vorstellungen vom Weltende im christlichen Kontext. Die Analyse beleuchtet die spezifischen theologischen Konzepte und ihre Ausprägungen in verschiedenen Strömungen des Christentums.
4. Ein Vergleich der Jenseitsvorstellungen: In diesem Kapitel werden die in den vorherigen Kapiteln dargestellten Jenseitsvorstellungen der nordischen Mythologie und des Christentums systematisch miteinander verglichen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Konzepten werden herausgearbeitet und analysiert, um ein differenziertes Verständnis der beiden Weltsichten zu ermöglichen. Der Vergleich fokussiert auf die zentralen Themen und ihre jeweiligen Ausprägungen.
Schlüsselwörter
Nordische Mythologie, Christentum, Jenseitsvorstellung, Postmortalität, Tod, Leben nach dem Tod, Götter, Gott, Opferkult, Totenbeisetzung, Weltende, Vergleichende Religionswissenschaft, Eschatologie.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Vergleich der Jenseitsvorstellungen in der nordischen Mythologie und im Christentum
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit vergleicht die Vorstellungen vom Jenseits in der nordischen Mythologie und im Christentum. Sie untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den jeweiligen Konzepten von Tod, Leben nach dem Tod, Gottesvorstellungen und der Bedeutung von Opferkult und Totenriten.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit analysiert die Jenseitsvorstellungen beider Religionen, indem sie die Rollen der Götter/Gottes, die Konzepte des Diesseits und Jenseits, Opferkulte, Totenrituale und die eschatologischen Vorstellungen (Weltende) untersucht. Der Vergleich umfasst auch die Konzepte von Tod und Leben nach dem Tod in beiden Systemen.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, die Postmortalitätsvorstellung der nordischen Mythologie, die Postmortalitätsvorstellung im Christentum und ein Vergleich beider Jenseitsvorstellungen. Die Einleitung beschreibt die Forschungsfrage und Methodik. Die Kapitel 2 und 3 analysieren jeweils detailliert die Jenseitsvorstellungen der jeweiligen Religion. Kapitel 4 bietet einen systematischen Vergleich der Ergebnisse.
Welche konkreten Aspekte der nordischen Mythologie werden untersucht?
Im zweiten Kapitel werden die Rollen der Götter im Kontext des Jenseits, die Konzepte des Diesseits und ihre Verbindung zum Jenseits, die Praktiken des Opferkults und der Totenbeisetzung sowie die nordischen Vorstellungen vom Weltende analysiert. Das Ziel ist es, ein umfassendes Bild der nordischen Jenseitsvorstellungen zu erstellen.
Welche Aspekte des Christentums werden betrachtet?
Kapitel 3 konzentriert sich auf die Rolle Gottes im christlichen Jenseitsverständnis, die Konzepte des Diesseits und ihre Beziehung zum Jenseits, den christlichen Opferkult und die Riten der Totenbeisetzung sowie die eschatologischen Vorstellungen (Weltende). Die Analyse berücksichtigt dabei unterschiedliche Strömungen innerhalb des Christentums.
Wie wird der Vergleich der Jenseitsvorstellungen durchgeführt?
Im vierten Kapitel werden die in den vorherigen Kapiteln dargestellten Jenseitsvorstellungen systematisch miteinander verglichen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Konzepten werden herausgearbeitet und analysiert, um ein differenziertes Verständnis der beiden Weltsichten zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf den zentralen Themen und deren Ausprägungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die Arbeit wird durch folgende Schlüsselwörter charakterisiert: Nordische Mythologie, Christentum, Jenseitsvorstellung, Postmortalität, Tod, Leben nach dem Tod, Götter, Gott, Opferkult, Totenbeisetzung, Weltende, Vergleichende Religionswissenschaft, Eschatologie.
- Quote paper
- Ulf Tomczak (Author), 2015, Ein Vergleich der Jenseitserwartungen der nordischen Mythologie und christlichen Religion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338614