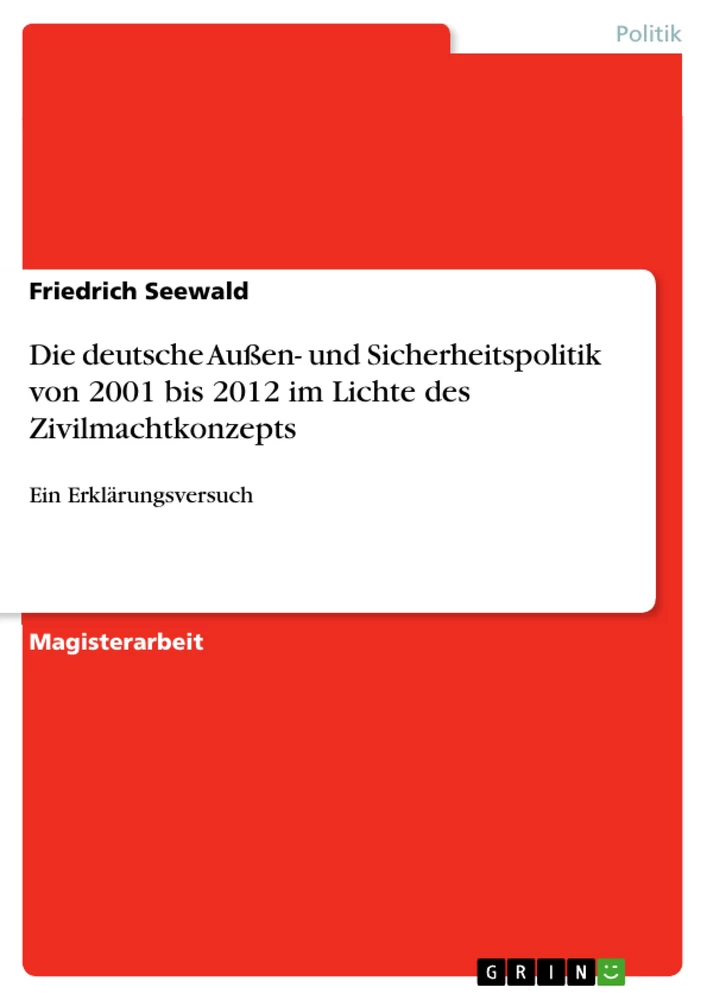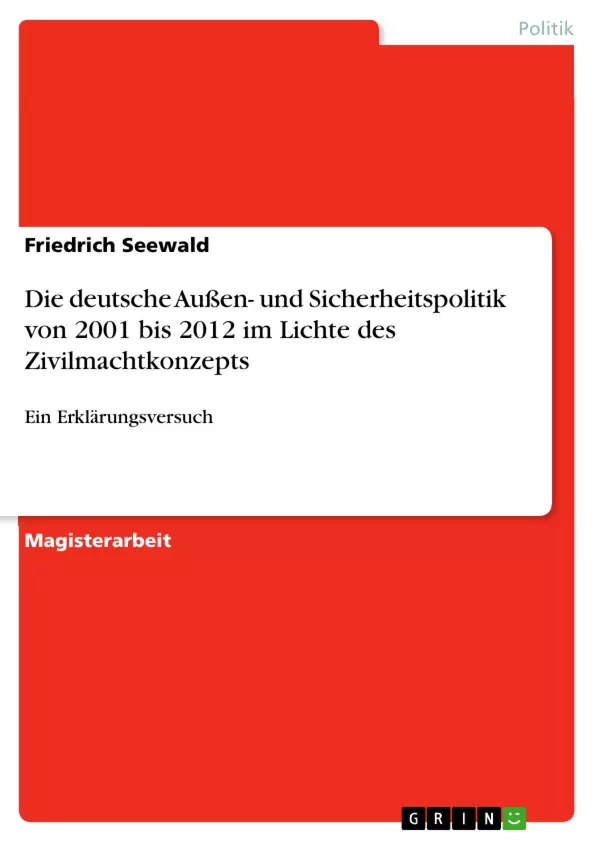Mit dieser Arbeit soll die Rhetorik und das Verhalten der für die deutsche Sicherheitspolitik von 2001 bis 2012 relevanten Akteure aufbereitet und die deutsche Sicherheitspolitik erklärt werden. Als Grundlage hierzu dient der rollentheoretische Zivilmachtsansatz von Maull und Kirste. Dabei ist von Interesse, ob und ggf. inwieweit das deutsche Verhalten nach 9/11 noch einer idealtypischen Zivilmacht entspricht. Es wird auch untersucht, welche Kategorien oder Normen die deutsche Sicherheitspolitik seit 2001 bis heute prägen. Weiterhin soll überprüft werden, wo das außenpolitische Selbstverständnis, welches in der politischen Rhetorik der Entscheidungsträger zum Ausdruck kommt, vom Idealtypus abweicht. Damit zusammenhängend wird der Frage nachgegangen, wie sich das tatsächliche Verhalten von der Rhetorik und vom Idealtypus unterscheidet.
Das unilaterale Handeln des nationalsozialistischen Deutschlands hatte die Welt in den verlustreichsten Krieg der Menschheitsgeschichte und einen Völkermord gigantischen Ausmaßes geführt. Diese historischen Erfahrungen führten zur Etablierung einer politischen Kultur in Deutschland, die sich mit
den Begriffen Multilateralismus, Supranationalismus und Antimilitarismus umreißen lässt. Das deutsche außenpolitische Nachkriegsselbstverständnis schlägt sich in den außenpolitischen Grundprinzipien Kein deutscher Sonderweg, einer Kultur der Zurückhaltung, Nie wieder allein, Nie wieder
Auschwitz und Nie wieder Krieg nieder. Diese tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannten Normen und Werte haben die politisch Verantwortlichen nach 1945 enorm beeinflusst. Betrachtet man allerdings die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik nach der Wiedervereinigung, so ergibt sich auf den ersten Blick ein widersprüchliches Bild. Besonders das militärische Out-of-area-Engagement steht scheinbar konträr zum deutschen Zivilmachtsanspruch. Um diesen Widerspruch zu untersuchen und das Rollenkonzept sowie die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik auf den Zivilmachtsanspruch hin zu
überprüfen, müssen Beispiele gefunden werden, in denen der ideale Zivilmachtsanspruch und die reale deutsche Außen- und Sicherheitspolitik gegenübergestellt werden, um Übereinstimmungen oder auch Abweichungen sichtbar machen zu können. Um die Arbeit im vorgeschriebenen Umfang halten zu können, erfolgt hierbei eine Beschränkung auf lediglich zwei exemplarische Fallbeispiele. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlegende Gedanken
- Die erkenntnisleitende Fragestellung
- Der Aufbau und die Methodik der Arbeit
- Anmerkungen zum Forschungsstand
- Konzeption und Historie des Zivilmachtmodells
- Theoretischer Rahmen: Rollentheorie und Zivilmacht
- Die Rollenkonzeption von Zivilmächten
- Die historische Entwicklung des Zivilisierungskonzeptes
- Zivilmachtsprinzipien
- Wo Licht ist ist auch Schatten - der Zivilmachtsansatz in der Kritik
- Die sicherheitspolitischen Definitionsmerkmale einer Zivilmacht
- Die Ziele von Zivilmächten
- Gewollte Reduzierung der nationalen Autonomie
- Normdurchsetzung im Spannungsfeld der nationalen Eigeninteressen
- Ein Blick zurück: Die Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 bis zum 11. September 2001
- Deutschlands Einfluss auf die Europäische Union (EU)
- Deutschlands Einfluss auf die North Atlantic Treaty Organization (NATO)
- Deutschlands Einfluss auf die United Nations Organization (UNO)
- Deutschland bis zum 11. September 2001 im Lichte des Zivilmachtskonzepts - eine erste Zwischenbilanz
- Die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik nach 9/11 in concreto
- 9/11 und der plötzliche Beginn des Anti-Terrorkampfes
- Die Erwartungen des US-amerikanischen Alter-Parts
- Die deutsche Rhetorik anlässlich 9/11
- Die öffentliche Meinung in Deutschland nach 9/11
- Das deutsche Verhalten in global relevanten Institutionen
- Deutschland nach 9/11 im Anti-Terrorkampf im Lichte des Zivilmachtskonzepts - eine weitere Zwischenbilanz
- Fallbeispiel Afghanistan und der Krieg am Hindukusch
- Die Erwartungen des US-amerikanischen Alter-Parts
- Die deutsche Rhetorik anlässlich des bevorstehenden Afghanistan-Krieges
- Die öffentliche Meinung in Deutschland zum Afghanistan-Einsatz
- Das deutsche Verhalten in verschiedenen Einsatzphasen
- Der deutsche ISAF-Einsatz im Zangengriff internationaler Verplichtungen und nationaler Vorbehalte
- Die Bundeswehr zwischen Anspruch und Wirklichkeit
- Erkenntnisse aus dem deutschen Afghanistaneinsatz bezüglich des Zivilmachtsanspruchs
- Fallbeispiel Irak und die Achse des Bösen
- Die Erwartungen des US-amerikanischen Alter-Parts
- Die deutsche Rhetorik zur Frage eines Kriegseinsatzes im Irak
- Die öffentliche Meinung in Deutschland zum Irak-Einsatz
- Das deutsche Verhalten in verschiedenen Phasen des Irak-Konflikts
- Erkenntnisse aus dem deutschen Verhalten im Irak-Konflikt bezüglich des Zivilmachtsanspruchs
- Fallbeispiel Afghanistan und der Krieg am Hindukusch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit analysiert die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik im Zeitraum von 2001 bis 2012. Sie untersucht, inwieweit das deutsche Verhalten nach den Anschlägen vom 11. September 2001 (9/11) noch dem Idealbild einer Zivilmacht entspricht. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf den rollentheoretischen Zivilmachtsansatz von Maull und Kirste. Sie beleuchtet den Einfluss historischer Erfahrungen, die Rolle Deutschlands in internationalen Institutionen sowie die öffentlichen Debatten und politischen Entscheidungen im Kontext von Afghanistan und Irak.
- Die Entwicklung und Anwendung des Zivilmachtskonzepts im Kontext der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik
- Die Auswirkungen der Anschläge vom 11. September 2001 auf die deutsche Sicherheitspolitik
- Die Rolle Deutschlands in internationalen Institutionen wie NATO und UNO
- Die Relevanz der öffentlichen Meinung für die Gestaltung deutscher Sicherheitspolitik
- Die Analyse des deutschen Einsatzes in Afghanistan und Irak im Lichte des Zivilmachtsanspruchs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit legt die grundlegenden Gedanken und die Fragestellung der Arbeit dar. Sie erläutert den Aufbau und die Methodik der Arbeit sowie den aktuellen Forschungsstand zum Thema. Kapitel 2 befasst sich mit der Konzeption und Historie des Zivilmachtmodells. Es analysiert die theoretischen Grundlagen, die Rollenkonzeption von Zivilmächten sowie die sicherheitspolitischen Definitionsmerkmale einer Zivilmacht. Kapitel 3 beleuchtet die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik von 1949 bis zum 11. September 2001. Es untersucht den Einfluss Deutschlands auf die Europäische Union, die NATO und die UNO sowie die Bedeutung des Zivilmachtskonzepts für diese Periode. Kapitel 4 widmet sich der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Es analysiert die deutschen Reaktionen auf 9/11, die Rolle Deutschlands im Anti-Terrorkampf und die Auswirkungen auf die deutsche Sicherheitspolitik. Die Arbeit beleuchtet anhand von Fallbeispielen die deutsche Rolle im Afghanistan-Krieg und im Irak-Konflikt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik, das Zivilmachtskonzept, den Anti-Terrorkampf, die Rolle Deutschlands in internationalen Institutionen, die öffentliche Meinung und die deutschen Einsätze in Afghanistan und Irak. Wichtige Konzepte sind Multilateralismus, Supranationalismus, Antimilitarismus, Rollentheorie und die historische Entwicklung der deutschen Sicherheitspolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt das Zivilmachtkonzept in der Außenpolitik?
Es beschreibt einen Staat, der auf Multilateralismus, Supranationalismus und die Zivilisierung internationaler Beziehungen setzt und militärische Gewalt weitgehend ablehnt.
Wie veränderte 9/11 die deutsche Sicherheitspolitik?
Die Anschläge führten zu einem verstärkten militärischen Engagement (z. B. in Afghanistan), was eine Debatte über die Abkehr vom Idealbild der Zivilmacht auslöste.
Welche Rolle spielt die öffentliche Meinung für die deutsche Außenpolitik?
Die Arbeit analysiert, wie stark die deutsche Bevölkerung militärische Einsätze ablehnt und wie dieser Druck die Entscheidungen der Politik beeinflusst.
Was war der Unterschied zwischen der deutschen Haltung zum Afghanistan- und zum Irak-Krieg?
Während Deutschland den Einsatz in Afghanistan (ISAF) unterstützte, lehnte die Regierung Schröder eine Beteiligung am Irak-Krieg 2003 strikt ab.
Ist Deutschland noch eine Zivilmacht?
Die Untersuchung zeigt Abweichungen zwischen politischer Rhetorik und tatsächlichem Verhalten auf, um zu klären, inwieweit das Zivilmacht-Selbstverständnis noch Bestand hat.
- 9/11 und der plötzliche Beginn des Anti-Terrorkampfes
- Quote paper
- Friedrich Seewald (Author), 2013, Die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik von 2001 bis 2012 im Lichte des Zivilmachtkonzepts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338704