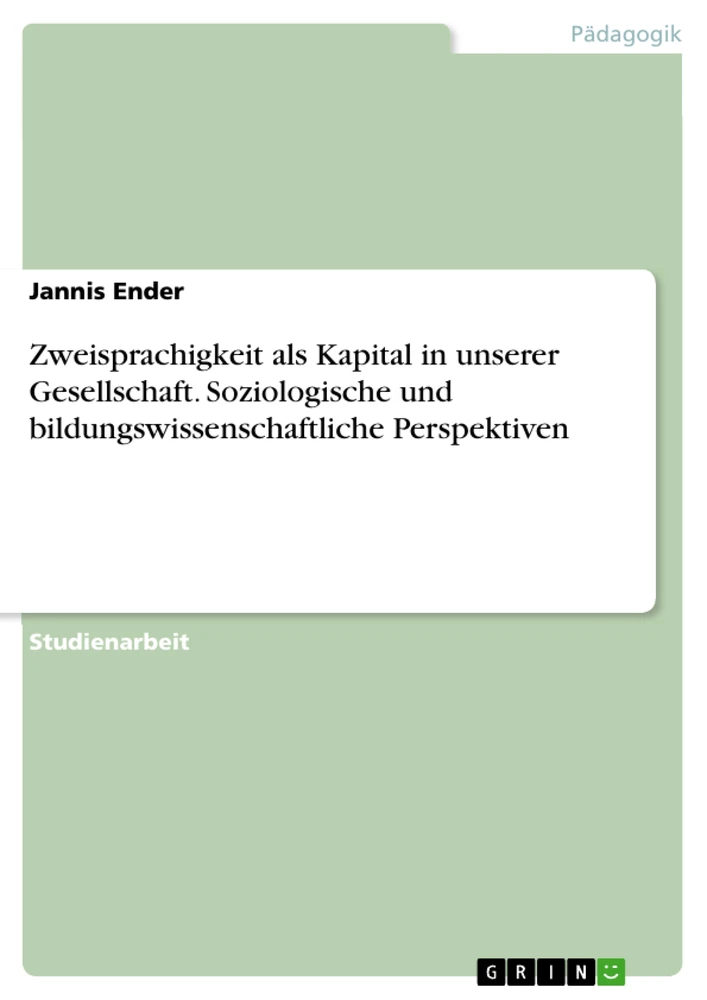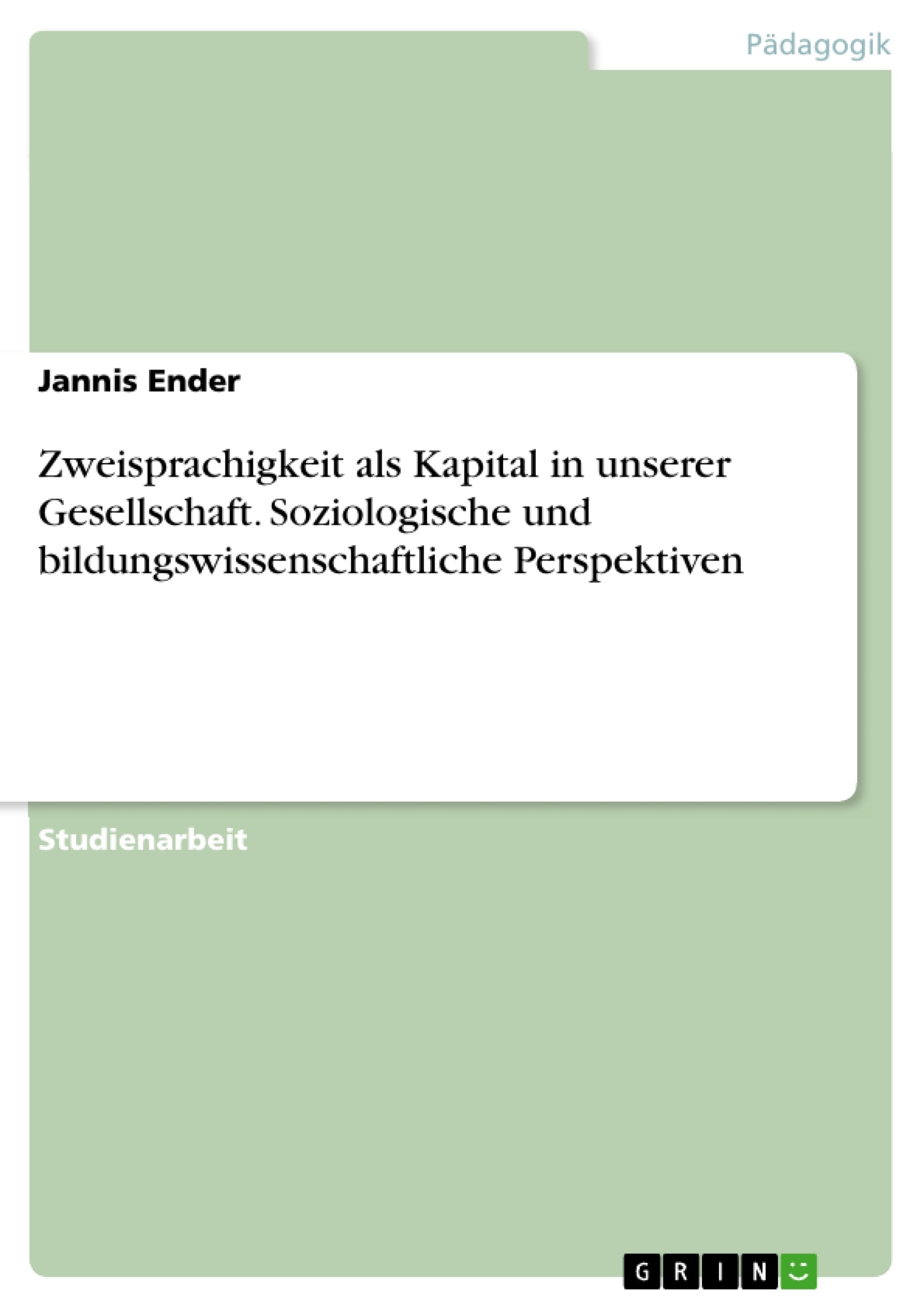In Deutschland wachsen immer mehr Kinder zweisprachig oder binational auf. Dabei steht auch heutzutage oft noch das Vorurteil, dass Mehrsprachigkeit Kinder überfordere und so keine von beiden Sprachen richtig gelernt werde, im Raum. Doch aktuelle Forschungen belegen: Kinder, die in jungen Jahren zweisprachig aufwachsen, sind geistig flexibler und leistungsfähiger in ihrer Wahrnehmung.
Doch leider sind im Bildungssystem nur die Sprachen, denen ein hohes Prestige zugesprochen wird, stark vertreten. Dies sind zumeist Englisch, Französisch, Latein oder Spanisch. Die Mehrheit der Kinder in Deutschland, die aus Migrationsgründen zweisprachig aufwächst, spricht aber neben Deutsch u.a. Türkisch, Russisch oder Polnisch. Es drängen sich Fragen auf: Geht unsere Gesellschaft mit Kindern, die in einer prestigeträchtigen Sprache und Deutsch aufwachsen anders um, als mit Kindern die migrationsbedingt mit einer anderen Sprache und Deutsch aufwachsen? Und haben Kinder, die mit einer dieser angeseheneren Sprachen aufwachsen, mehr Bildungschancen und damit später bessere Berufsmöglichkeiten als zweisprachige Kinder mit Migrationshintergrund?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Unterschiedliche Arten von Mehrsprachigkeit
- Ingrid Gogolin zum Thema Mehrsprachigkeit
- Von der Einsprachigkeit zur Mehrsprachigkeit
- Bildungssprache
- Pierre Bourdieus Kapitaltheorie in Bezug zur Mehrsprachigkeit
- Die Theorie
- Mehrsprachigkeit als Kapital
- Bildungswissenschaftliche Perspektive
- Aktueller Stand und Chancen
- Die Didaktik der Mehrsprachigkeit
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern es im Bildungsbereich Unterschiede zwischen Kindern gibt, die aufgrund ihrer Herkunft zweisprachig aufwachsen und Kindern, die durch Förderung zweisprachig aufwachsen. Darüber hinaus wird untersucht, wie diese Unterschiede in unserer Gesellschaft wahrgenommen und behandelt werden. Die Arbeit will die verschiedenen Perspektiven auf Mehrsprachigkeit beleuchten und wissenschaftliche Theorien zur Erklärung der komplexen Thematik heranziehen.
- Die verschiedenen Arten von Mehrsprachigkeit und ihre Bedeutung im Bildungskontext
- Die Analyse von Ingrid Gogolins Sichtweise auf Mehrsprachigkeit und ihre Erkenntnisse zur Entwicklung von Bildungssprachen
- Die Anwendung der Kapitaltheorie von Pierre Bourdieu auf das Phänomen der Mehrsprachigkeit und die Interpretation von Mehrsprachigkeit als Kapital
- Die Analyse des aktuellen Standes und der Chancen von Mehrsprachigkeit im deutschen Bildungssystem
- Die Darstellung und kritische Reflexion der Didaktik der Mehrsprachigkeit als Lösungsansatz für Herausforderungen im Bildungsbereich
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Mehrsprachigkeit in Deutschland ein und beleuchtet die kontroversen Diskussionen und unterschiedlichen Perspektiven in der Gesellschaft. Das Kapitel 2 erläutert verschiedene Arten von Mehrsprachigkeit und ihre Bedeutung für die vorliegende Arbeit. Kapitel 3 widmet sich den Arbeiten von Ingrid Gogolin zum Thema Mehrsprachigkeit und beleuchtet ihre Erkenntnisse zur Entwicklung von Mehrsprachigkeit und Bildungssprachen. Kapitel 4 analysiert Pierre Bourdieus Kapitaltheorie in Bezug zur Mehrsprachigkeit und untersucht, wie Mehrsprachigkeit als Kapital betrachtet werden kann. Kapitel 5 befasst sich mit der bildungswissenschaftlichen Perspektive auf Mehrsprachigkeit und analysiert den aktuellen Stand und die Chancen von Mehrsprachigkeit im deutschen Bildungssystem. Außerdem werden die Bildungs- und Berufschancen für bilingual aufwachsende Kinder betrachtet.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Bildung, Kapital, Pierre Bourdieu, Ingrid Gogolin, Didaktik, Integration, Migranten, Bildungssprache, Gesellschaft, Unterschiede, Chancen, Bildungschancen, Berufschancen, Zweitsprache, Familiensprache, Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache, bilinguale Bildung.
Häufig gestellte Fragen
Ist Mehrsprachigkeit eine Überforderung für Kinder?
Aktuelle Forschungen widerlegen dieses Vorurteil: Zweisprachig aufwachsende Kinder sind oft geistig flexibler und leistungsfähiger in ihrer Wahrnehmung.
Was versteht Pierre Bourdieu unter Mehrsprachigkeit als Kapital?
Sprache wird als Ressource gesehen, die je nach gesellschaftlichem Prestige (z.B. Englisch vs. Türkisch) unterschiedliche Bildungs- und Berufschancen eröffnet.
Welche Sprachen haben im deutschen Bildungssystem ein hohes Prestige?
Vor allem westliche Fremdsprachen wie Englisch, Französisch und Spanisch genießen hohes Ansehen, während Migrationssprachen oft vernachlässigt werden.
Was sind die Thesen von Ingrid Gogolin zur Ein- und Mehrsprachigkeit?
Gogolin kritisiert den „monolingualen Habitus“ deutscher Schulen und fordert eine Anerkennung der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit als Bildungsvoraussetzung.
Wie kann die Didaktik der Mehrsprachigkeit helfen?
Sie bietet Ansätze, um alle vorhandenen Sprachkenntnisse der Kinder aktiv in den Unterricht einzubinden und so die Bildungschancen zu verbessern.
- Quote paper
- Jannis Ender (Author), 2015, Zweisprachigkeit als Kapital in unserer Gesellschaft. Soziologische und bildungswissenschaftliche Perspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339069