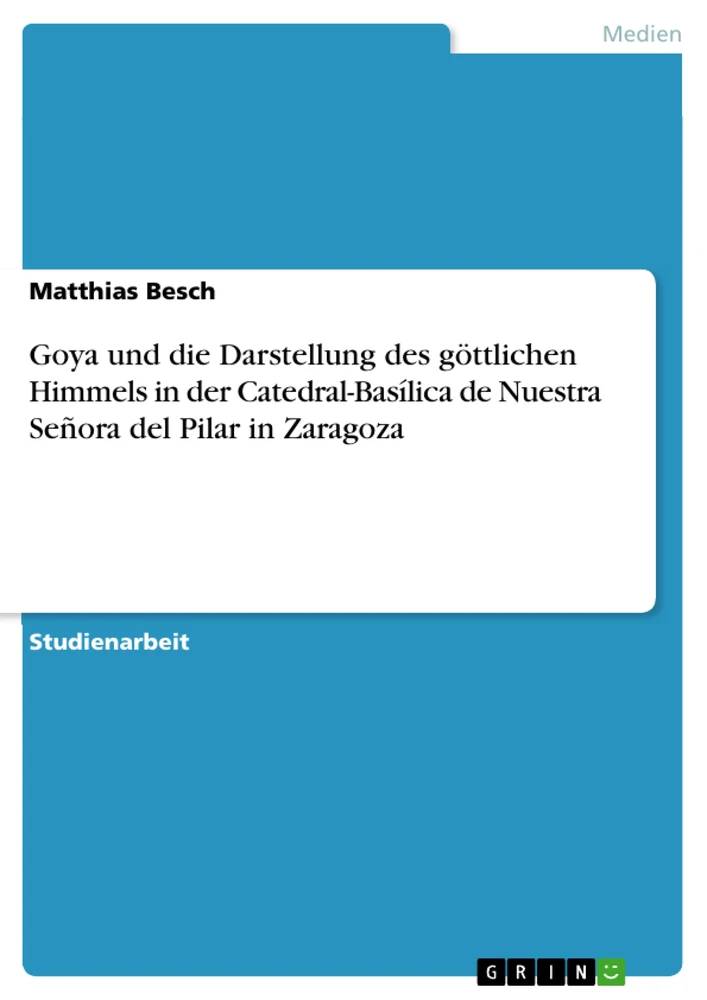Die sinnbildliche Erscheinung göttlicher Präsenz auf der Iberischen Halbinsel ist in dem Gnadenbild der Virgen del Pilar manifestiert. Auf einer Säule soll die Heilige Jungfrau dem Apostel Jakobus dem Älteren erschienen sein. Dieses Patrozinium bestimmt das Deckenbildprogramm der an der legendären Stelle erbauten Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar in Zaragoza.
Mit der Darstellung des visionären Erlebnisses wurde nicht zuletzt Francisco José de Goya y Lucientes aus der naheliegenden Stadt Fuendetodos in Aragón beauftragt – herausragend sind hierbei Die Gloria, auch als Die Anbetung des Namens Gottes betitelt, aus dem Jahre 1772 und Maria, Königin der Märtyrer aus dem Jahre 1781. Der programmatischen Darstellung der himmlischen Bezirke entsprechend, sind die Bilder an die etwa vierzig Meter hohen Decken der größten Barockkirche Spaniens freskiert, so dass der von unten hinauf schauende Betrachter die Pole der christlichen Weltordnung anschaulich wahrnehmen kann.
Das Wechselspiel der Gegensätze zwischen oben und unten, zwischen Himmlischem und Irdischem soll im Weiteren im Hinblick auf gestalterische Bildmuster im architektonischen Raum erörtert werden. Der strukturanalytische Zugriff auf Goyas frühe Deckenbilder bewährt sich im Vergleich mit der italienischen Tradition der Deckenmalerei der Frühen Neuzeit und ihrer „spanischen“ Transformation.
Inhaltsverzeichnis
- Goya und die Tradition des religiösen Deckenbildes
- Zur räumlichen Ordnung der Basílica del Pilar
- Die gestalterische Betrachtung der Deckenfresken
- Gloria
- Regina Martyrum
- Die Darstellung des göttlichen Himmels im architektonischen Raum
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Goyas Deckenfresken in der Basílica del Pilar in Zaragoza. Ziel ist es, die gestalterischen Besonderheiten seiner Werke im Kontext der Tradition religiöser Deckenmalerei zu analysieren und die Darstellung des göttlichen Himmels im architektonischen Raum zu beleuchten. Die Wechselwirkung zwischen himmlischer und irdischer Sphäre, sowie Goyas künstlerische Entwicklung im Vergleich zu seinen Zeitgenossen werden ebenfalls betrachtet.
- Goyas künstlerische Auseinandersetzung mit der Tradition religiöser Deckenmalerei.
- Die räumliche Gestaltung und die Darstellung des göttlichen Himmels in Goyas Fresken.
- Der Vergleich Goyas mit der italienischen Tradition der Deckenmalerei.
- Die Interpretation von Goyas Werken im Kontext der aufgeklärten Idee der „Freiheit des Geistes“.
- Die Rolle der kirchlichen Kommission bei der Gestaltung der Basílica del Pilar.
Zusammenfassung der Kapitel
Goya und die Tradition des religiösen Deckenbildes: Dieses Kapitel untersucht Goyas „Gloria“ (1772) und „Maria, Königin der Märtyrer“ (1781) im Kontext der Tradition religiöser Deckenmalerei auf der Iberischen Halbinsel. Es analysiert die ikonographische Bedeutung der Virgen del Pilar und deren Einfluss auf das Deckenbildprogramm der Basílica del Pilar. Der Fokus liegt auf dem Wechselspiel zwischen himmlischem und irdischem Bereich und der anschaulichen Darstellung der christlichen Weltordnung für den Betrachter. Goyas Werk wird im Vergleich zur italienischen Tradition der Deckenmalerei der Frühen Neuzeit und ihrer „spanischen“ Transformation betrachtet. Die Diskussion der „Freiheit des Geistes“ in Goyas Schaffen und die Rolle der kirchlichen Kommission bei der Auftragsvergabe werden ebenfalls angesprochen.
Zur räumlichen Ordnung der Basílica del Pilar: Dieses Kapitel analysiert die architektonische Struktur der Basílica del Pilar und ihren Einfluss auf die Gestaltung und Wahrnehmung von Goyas Deckenfresken. Die Beschaffenheit des Raumes und seine Auswirkung auf die künstlerische Umsetzung der religiösen Themen werden erörtert. Der Text beschreibt die enorme Höhe der Decken und wie dies die Perspektive des Betrachters beeinflusst und die Darstellung der himmlischen und irdischen Sphären prägt. Die Bedeutung der räumlichen Ordnung für das Verständnis der gesamten Bildkomposition wird hervorgehoben.
Die gestalterische Betrachtung der Deckenfresken: Dieser Abschnitt befasst sich detailliert mit der Gestaltung der beiden Hauptwerke Goyas in der Basílica del Pilar: „Gloria“ und „Regina Martyrum“. Es wird auf die kompositorischen Elemente, die Farbgebung und die symbolische Bedeutung der dargestellten Figuren eingegangen. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Fresken werden analysiert und in Beziehung zu Goyas Gesamtschaffen gesetzt. Die Analyse beleuchtet die künstlerische Umsetzung der religiösen Themen und deren Wirkung auf den Betrachter. Die Kapitel 3.1 und 3.2 bieten tiefgehende Einzelanalysen der jeweiligen Fresken, wobei die Synthese dieser Analysen auf die Gesamtaussage des Kapitels fokussiert.
Die Darstellung des göttlichen Himmels im architektonischen Raum: Dieses Kapitel untersucht, wie Goya den göttlichen Himmel in den architektonischen Raum der Basílica del Pilar integriert hat. Es wird die Interaktion zwischen Bild und Architektur, und der Einfluss der Raumgestaltung auf die Darstellung des Himmlischen und Irdischen erörtert. Die Kapitel untersucht den Unterschied zu traditionelleren barocken Deckenmalereien, in denen die illusionistische Darstellung des Himmels im Vordergrund steht. Der Vergleich mit anderen Werken Goyas, insbesondere mit den Fresken in der Kapelle San Antonio de la Florida, wird zur Veranschaulichung herangezogen.
Schlüsselwörter
Goya, Deckenfresken, Basílica del Pilar, Zaragoza, religiöse Malerei, Barock, Himmelsdarstellung, architektonischer Raum, „Gloria“, „Regina Martyrum“, italienische Tradition, „Freiheit des Geistes“, kirchliche Kommission, räumliche Ordnung, Bildkomposition.
Häufig gestellte Fragen zu: Goya und die Deckenfresken der Basílica del Pilar
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Goyas Deckenfresken „Gloria“ (1772) und „Regina Martyrum“ (1781) in der Basílica del Pilar in Zaragoza. Sie untersucht Goyas gestalterische Besonderheiten im Kontext der Tradition religiöser Deckenmalerei und beleuchtet die Darstellung des göttlichen Himmels im architektonischen Raum. Die Wechselwirkung zwischen himmlischer und irdischer Sphäre und Goyas künstlerische Entwicklung im Vergleich zu seinen Zeitgenossen werden ebenfalls betrachtet.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt Goyas Auseinandersetzung mit der Tradition religiöser Deckenmalerei, die räumliche Gestaltung und Darstellung des göttlichen Himmels in seinen Fresken, einen Vergleich mit der italienischen Tradition, die Interpretation seiner Werke im Kontext der „Freiheit des Geistes“, die Rolle der kirchlichen Kommission und die architektonische Struktur der Basílica del Pilar und deren Einfluss auf die Fresken.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: 1. Goya und die Tradition des religiösen Deckenbildes; 2. Zur räumlichen Ordnung der Basílica del Pilar; 3. Die gestalterische Betrachtung der Deckenfresken (mit Unterkapiteln zu „Gloria“ und „Regina Martyrum“); 4. Die Darstellung des göttlichen Himmels im architektonischen Raum.
Was wird im Kapitel "Goya und die Tradition des religiösen Deckenbildes" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht Goyas „Gloria“ und „Regina Martyrum“ im Kontext der Tradition religiöser Deckenmalerei auf der Iberischen Halbinsel, analysiert die ikonographische Bedeutung der Virgen del Pilar und deren Einfluss auf das Deckenbildprogramm, das Wechselspiel zwischen himmlischem und irdischem Bereich, und vergleicht Goyas Werk mit der italienischen Tradition und der „spanischen“ Transformation. Die „Freiheit des Geistes“ und die Rolle der kirchlichen Kommission werden ebenfalls diskutiert.
Was ist der Fokus des Kapitels "Zur räumlichen Ordnung der Basílica del Pilar"?
Dieses Kapitel analysiert die architektonische Struktur der Basílica del Pilar und deren Einfluss auf die Gestaltung und Wahrnehmung von Goyas Fresken. Es erörtert die Raumgestaltung, die Höhe der Decken und deren Einfluss auf die Perspektive des Betrachters und die Darstellung der himmlischen und irdischen Sphären. Die Bedeutung der räumlichen Ordnung für das Verständnis der Bildkomposition wird hervorgehoben.
Worüber handelt das Kapitel "Die gestalterische Betrachtung der Deckenfresken"?
Dieses Kapitel befasst sich detailliert mit der Gestaltung von „Gloria“ und „Regina Martyrum“, analysiert kompositorische Elemente, Farbgebung und die symbolische Bedeutung der Figuren. Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Fresken werden analysiert und in Beziehung zu Goyas Gesamtschaffen gesetzt. Die künstlerische Umsetzung der religiösen Themen und deren Wirkung auf den Betrachter werden beleuchtet.
Was wird im Kapitel "Die Darstellung des göttlichen Himmels im architektonischen Raum" untersucht?
Dieses Kapitel untersucht die Integration des göttlichen Himmels in den architektonischen Raum der Basílica del Pilar, die Interaktion zwischen Bild und Architektur und den Einfluss der Raumgestaltung auf die Darstellung des Himmlischen und Irdischen. Es vergleicht Goyas Ansatz mit traditionelleren barocken Deckenmalereien und zieht Vergleiche mit anderen Werken Goyas heran.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goya, Deckenfresken, Basílica del Pilar, Zaragoza, religiöse Malerei, Barock, Himmelsdarstellung, architektonischer Raum, „Gloria“, „Regina Martyrum“, italienische Tradition, „Freiheit des Geistes“, kirchliche Kommission, räumliche Ordnung, Bildkomposition.
- Citation du texte
- Matthias Besch (Auteur), 2015, Goya und die Darstellung des göttlichen Himmels in der Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar in Zaragoza, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339813