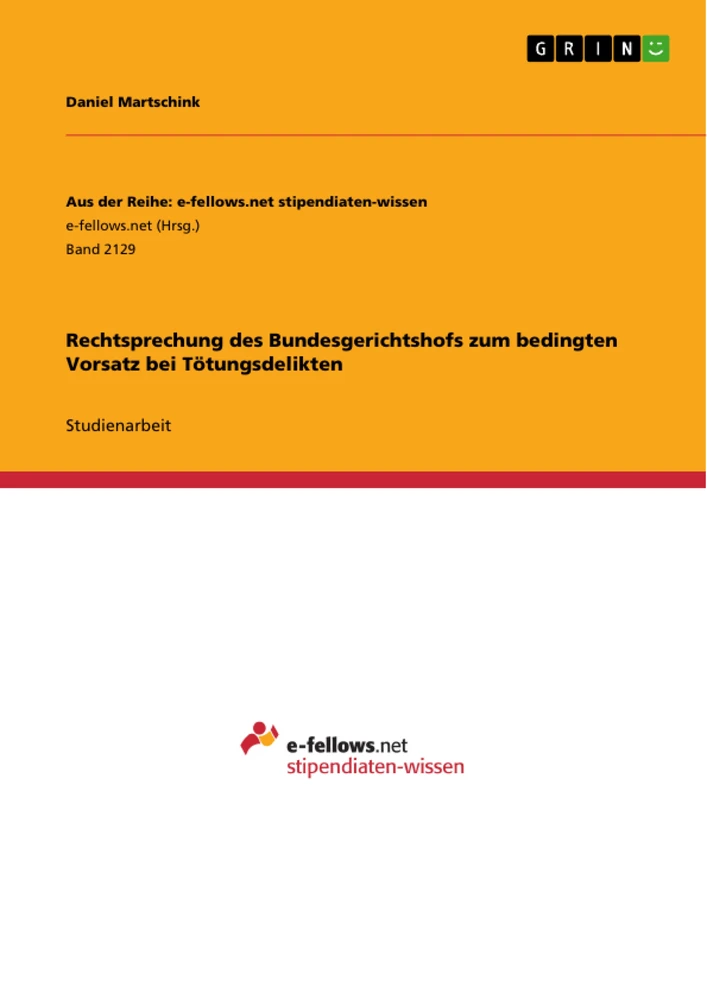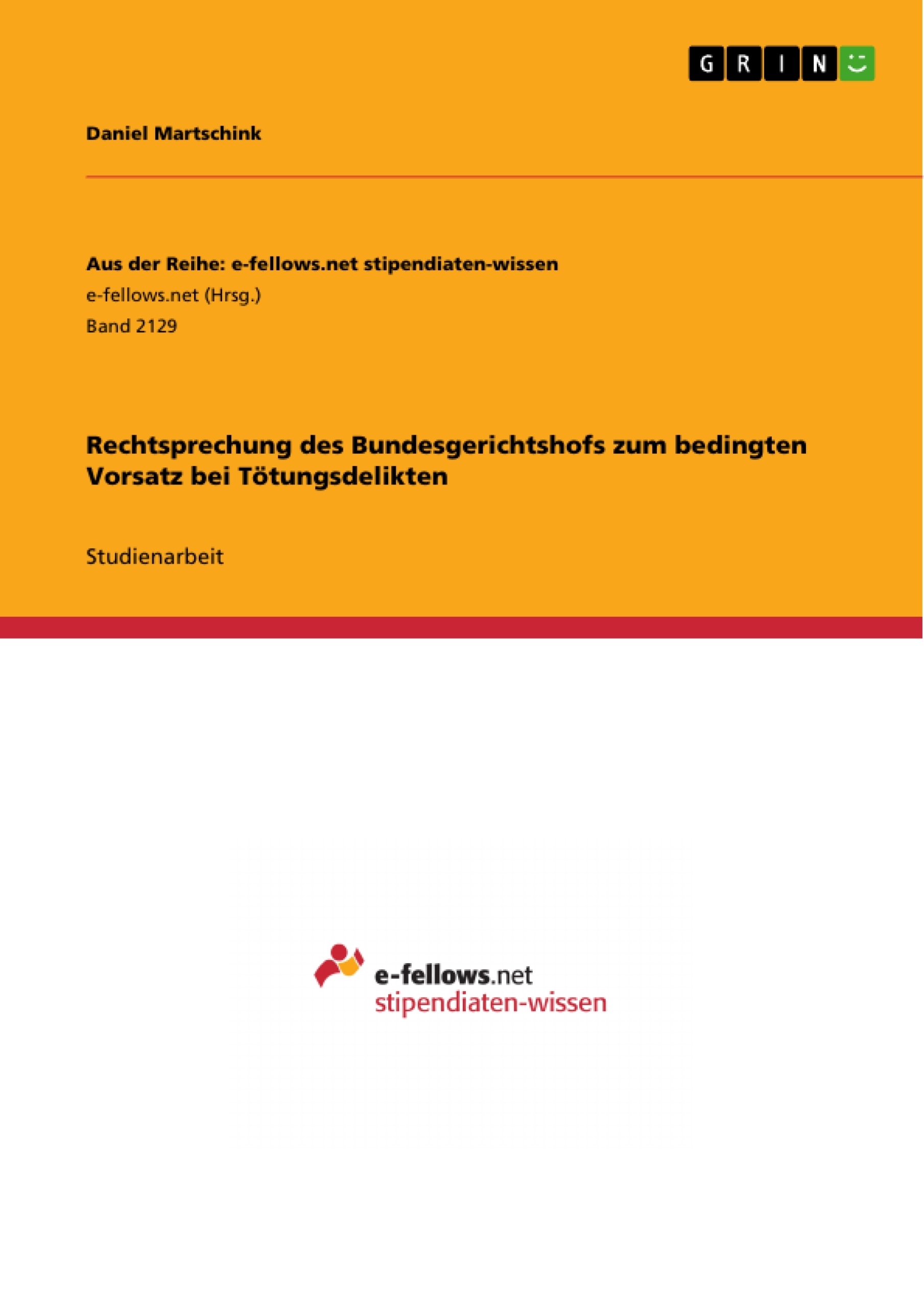Welche Anforderungen werden an den Nachweis bedingten Tötungsvorsatzes gestellt?
Die Rechtsprechung des BGH verirrt sich bei der Umschreibung des bedingten Tötungsvorsatzes in unklaren Begrifflichkeiten und führt mitunter bei – auf den ersten Blick – vergleichbaren Sachverhalten in einer Gesamtschau zu schwer nachvollziehbaren und teils konträren Ergebnissen. Die materiell-rechtliche Grenze zwischen dolus eventualis und bewusster Fahrlässigkeit ist trotz der Fülle an scheinbar unterschiedlichen „Theorien“ dabei weniger unklar als vielmehr die Anforderungen, die an den Nachweis bedingt vorsätzlichen Handelns bei Tötungsdelikten gestellt werden. Der BGH bedient sich einer Fülle metaphorischer Umschreibungen und Formeln ohne näher zu erklären, was er darunter verstanden wissen will. Dass es noch zu keiner tauglichen Zusammenstellung von Anforderungen an den Nachweis bedingten Tötungsvorsatzes gekommen ist, stellt die Tatgerichte vor das Problem, dass der BGH unvorhersehbar Urteile kassiert.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass zumindest das voluntative Element des Vorsatzes nicht als solches feststellbar ist. Es muss stattdessen von einem äußeren Geschehensablauf auf die innere Einstellung des Täters zur Tat geschlossen werden. Dabei geht es im Kern um ein Plausibilitätsurteil. Nämlich darum, ob die Alternativhypothese, dass der Täter nicht vorsätzlich handelte möglich und logisch schlüssig ist oder nicht.
Nach Darstellung dessen, was der BGH unter bedingtem Tötungsvorsatz versteht, wird untersucht, welche Anforderungen an die Feststellung gestellt werden, da das entscheidende Problem der praktischen Rechtsanwendung bei diesem strafprozessualen Nachweis liegt. In der Praxis ist der bedingte Tötungsvorsatz mehr Tat- als Rechtsfrage. Es wird sich zeigen, dass trotz aller Kritik und der scheinbaren Beliebigkeit der Rechtsprechung, mit den von den Strafsenaten formulierten Ausführungen eine Lösung besteht, die den Tatgerichten, ohne von der facettenreichen höchstrichterlichen Rechtsprechung abzuweichen, eine revisionsfeste Vorsatzprüfung ermöglicht.
Dabei wird keine fallgruppenorientierte Lösung präsentiert, sondern unabhängig davon eine generell anwendbare wissenschaftliche Methode dargestellt, die zu einer einheitlichen Behandlung von Grenzfällen des bedingten Tötungsvorsatzes führt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einführung und Problemstellung
- II. Definition von bedingtem Tötungsvorsatz in der Rechtsprechung des BGH
- 1. Tatbestandsvorsatz (dolus directus) als Ausgangspunkt des bedingten Vorsatzes
- 2. Elemente des bedingten Tötungsvorsatzes
- a) Möglichen Todeseintritt erkennen (kognitives Element)
- b) Billigung des Todes (voluntatives Element)
- III. Anforderungen an die tatgerichtliche Feststellung des bedingten Vorsatzes
- 1. Objektive (Lebens-)Gefährlichkeit der Tathandlung
- 2. Gesamtschau aller Tatumstände („Gesamtbetrachtungsmodell“)
- a) Konkrete Angriffsweise
- b) Psychischer Zustand des Täters zum Tatzeitpunkt
- c) Motivationslage des Täters
- d) Persönlichkeit des Täters/Einstellung des Täters zu Gewalt
- e) Weitere Indizien
- IV. Einzelne Kritikpunkte an der Rechtsprechung des BGH
- 1. Sog. „Hemmschwelle“ vor der Tötung eines Menschen
- 2. Berücksichtigung von Strafzumessungsaspekten auf der Vorsatzebene
- a) Nachtatverhalten
- b) „Ausländerhass“ und „Persönlichkeit“
- 3. Systembruch durch Vorsatz-Einschränkungen in psychophysischen Ausnahmesituationen
- V. Zusammenfassung und Lösungsvorschlag
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zum bedingten Vorsatz bei Tötungsdelikten. Ziel ist es, die Definition des bedingten Tötungsvorsatzes nach der BGH-Rechtsprechung zu analysieren, die Anforderungen an dessen tatgerichtliche Feststellung zu beleuchten und kritische Punkte zu diskutieren. Ein Lösungsvorschlag soll abschließend präsentiert werden.
- Definition des bedingten Tötungsvorsatzes nach BGH-Rechtsprechung
- Anforderungen an die tatgerichtliche Feststellung des bedingten Vorsatzes
- Kritische Auseinandersetzung mit der BGH-Rechtsprechung
- Gesamtschau der Tatumstände und deren Bedeutung
- Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Rechtsprechung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einführung und Problemstellung: Dieses Kapitel führt in die Thematik des bedingten Tötungsvorsatzes ein und skizziert die Problemstellung der Arbeit. Es wird die Bedeutung der klaren Abgrenzung zwischen bedingtem Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit hervorgehoben und die Notwendigkeit einer präzisen Rechtsprechung in diesem Bereich betont. Die Arbeit kündigt eine detaillierte Analyse der Rechtsprechung des BGH an und deutet die Herausforderungen bei der Feststellung des bedingten Vorsatzes an. Der Fokus liegt auf der Schwierigkeit, die subjektive Einstellung des Täters zu rekonstruieren und die objektive Gefährlichkeit der Handlung zu bewerten.
II. Definition von bedingtem Tötungsvorsatz in der Rechtsprechung des BGH: Dieses Kapitel definiert den bedingten Tötungsvorsatz auf Basis der BGH-Rechtsprechung. Es wird der Tatbestandsvorsatz (dolus directus) als Ausgangspunkt erläutert und die beiden zentralen Elemente des bedingten Vorsatzes – das Erkennen des möglichen Todeseintritts (kognitives Element) und die Billigung des Todes (voluntatives Element) – detailliert beschrieben. Die Komplexität der Abgrenzung zum bewussten Fahrlässigkeitsvorsatz wird herausgestellt, wobei die Bedeutung der subjektiven Einstellung des Täters im Mittelpunkt steht.
III. Anforderungen an die tatgerichtliche Feststellung des bedingten Vorsatzes: Dieses Kapitel analysiert die Anforderungen an die gerichtliche Feststellung des bedingten Tötungsvorsatzes. Es werden die Kriterien der objektiven Lebensgefährlichkeit der Tathandlung und die Notwendigkeit einer Gesamtschau aller Tatumstände im Rahmen des „Gesamtbetrachtungsmodells“ erläutert. Die einzelnen Aspekte dieser Gesamtschau, wie die konkrete Angriffsweise, der psychische Zustand des Täters, die Motivationslage und die Persönlichkeit des Täters, werden im Detail untersucht. Die Bedeutung von Indizienbeweisen wird hervorgehoben.
IV. Einzelne Kritikpunkte an der Rechtsprechung des BGH: Hier werden kritische Anmerkungen zur Rechtsprechung des BGH formuliert. Die Arbeit diskutiert die Rolle der „Hemmschwelle“ bei der Tötung eines Menschen, die Berücksichtigung von Strafzumessungsaspekten auf der Vorsatzebene (wie Nachtatverhalten und Ausländerhass) und den möglichen Systembruch durch Vorsatz-Einschränkungen in psychophysischen Ausnahmesituationen. Es wird auf die Schwierigkeiten und Unschärfen der bestehenden Rechtsprechung hingewiesen und die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung der Rechtsprechung angedeutet.
Schlüsselwörter
Bedingter Tötungsvorsatz, Bundesgerichtshof (BGH), Rechtsprechung, Tötungsdelikte, Dolus eventualis, Gesamtschau, Objektive Gefährlichkeit, Subjektive Einstellung, Hemmschwelle, Strafzumessung, Motivationslage, Psychischer Zustand, Kritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Bedingter Tötungsvorsatz in der Rechtsprechung des BGH
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zum bedingten Vorsatz bei Tötungsdelikten. Sie untersucht die Definition des bedingten Tötungsvorsatzes, die Anforderungen an seine tatgerichtliche Feststellung und kritische Punkte der bestehenden Rechtsprechung.
Was ist der bedingte Tötungsvorsatz nach der BGH-Rechtsprechung?
Der bedingte Tötungsvorsatz (Dolus eventualis) setzt sich aus zwei Elementen zusammen: 1. dem Erkennen des möglichen Todeseintritts (kognitives Element) und 2. der Billigung dieses Todes (voluntatives Element). Die Arbeit erläutert diese Elemente detailliert und beleuchtet die Abgrenzung zum bewussten Fahrlässigkeitsvorsatz.
Welche Anforderungen stellt die Rechtsprechung an die tatgerichtliche Feststellung des bedingten Tötungsvorsatzes?
Die tatgerichtliche Feststellung des bedingten Tötungsvorsatzes erfordert eine Gesamtschau aller Tatumstände (Gesamtbetrachtungsmodell). Dies umfasst die objektive Lebensgefährlichkeit der Handlung, die konkrete Angriffsweise, den psychischen Zustand des Täters, seine Motivationslage, seine Persönlichkeit und weitere Indizien.
Welche Kritikpunkte werden an der BGH-Rechtsprechung geübt?
Die Arbeit kritisiert u.a. die Rolle der „Hemmschwelle“ vor der Tötung, die Berücksichtigung von Strafzumessungsaspekten (wie Nachtatverhalten und Ausländerhass) auf der Vorsatzebene und mögliche Systembrüche durch Vorsatz-Einschränkungen in psychophysischen Ausnahmesituationen. Die Unschärfen und Schwierigkeiten der bestehenden Rechtsprechung werden hervorgehoben.
Welche Lösungsvorschläge werden präsentiert?
Die Arbeit enthält einen abschließenden Lösungsvorschlag zur Verbesserung der Rechtsprechung, der sich aus der detaillierten Analyse der Definition, der Anforderungen an die Feststellung und der Kritikpunkte ergibt. Der genaue Inhalt des Lösungsvorschlags ist in der vollständigen Arbeit zu finden.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einführung und Problemstellung, Definition des bedingten Tötungsvorsatzes, Anforderungen an dessen Feststellung, Kritikpunkte an der BGH-Rechtsprechung und Zusammenfassung mit Lösungsvorschlag.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bedingter Tötungsvorsatz, Bundesgerichtshof (BGH), Rechtsprechung, Tötungsdelikte, Dolus eventualis, Gesamtschau, Objektive Gefährlichkeit, Subjektive Einstellung, Hemmschwelle, Strafzumessung, Motivationslage, Psychischer Zustand, Kritik.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für Juristen, Rechtswissenschaftler und alle anderen Personen bestimmt, die sich mit dem Thema des bedingten Tötungsvorsatzes und der Rechtsprechung des BGH auseinandersetzen möchten. Sie dient der akademischen Forschung und Analyse.
- Citation du texte
- Daniel Martschink (Auteur), 2016, Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum bedingten Vorsatz bei Tötungsdelikten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340691