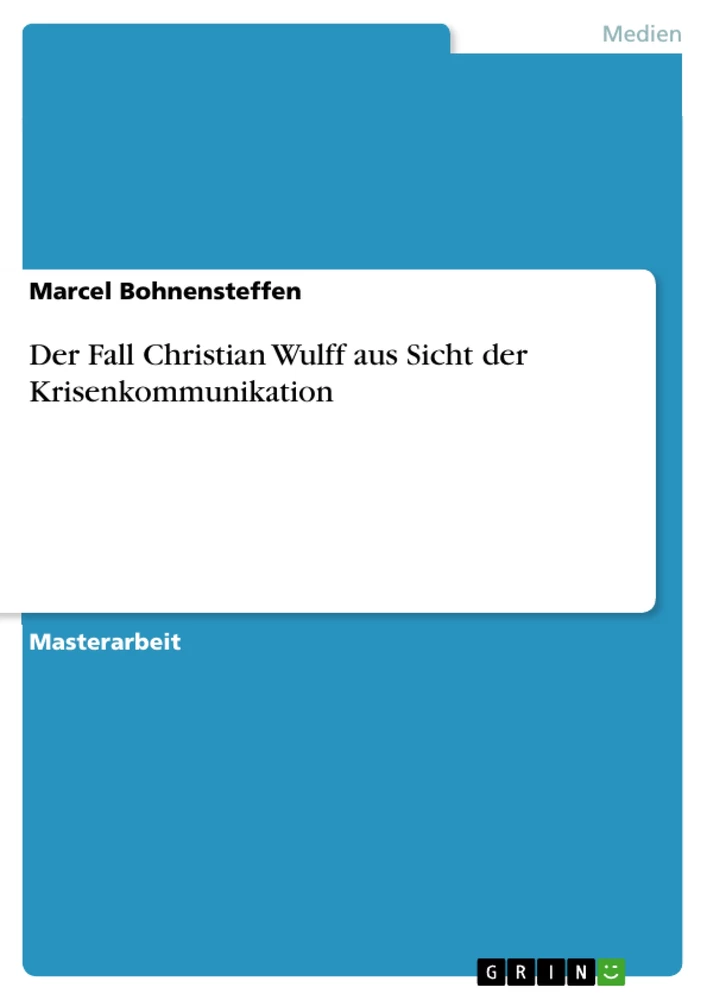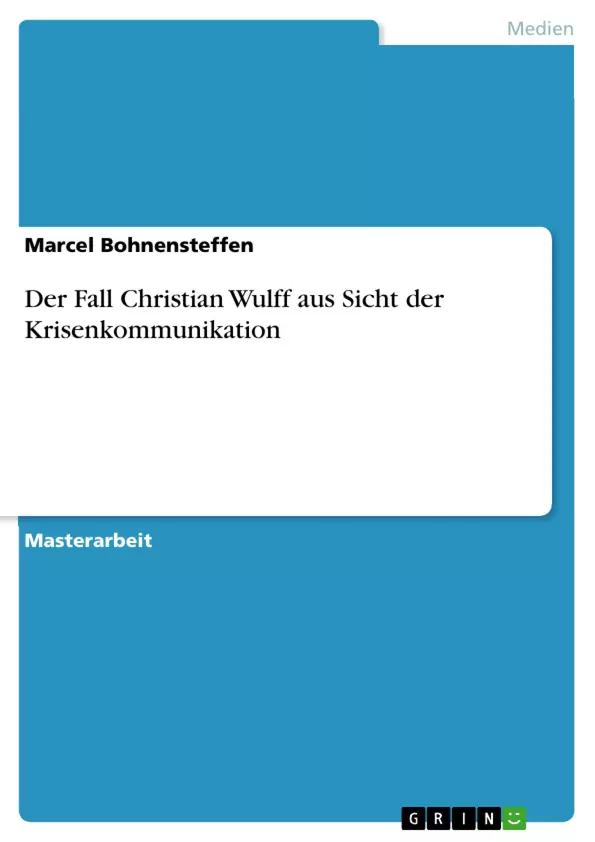Die Arbeit geht der Forschungsfrage nach, ob das Krisenmanagement des Staatsoberhaupts die Krise um seine Person verschärft hat. Ausgehend von dieser übergeordneten Frage wird untersucht, ob der Bundespräsident die Möglichkeit gehabt hat, seiner Krise frühzeitig entgegenzuwirken und bei entsprechenden präventiven Maßnahmen Fehler begangen hat. Ferner wird Wulffs Krisenmanagement auf seine Inhalte und seine Strategie analysiert und die organisatorische Ausrichtung seiner kommunikativen Aktivitäten geprüft. Abschließend soll die Bedeutung und die Auswirkungen der Mailboxnachricht und des TV-Interviews eruiert werden.
Für die Durchführung dieser explorativen Studie wird das teilstandardisierte Experteninterview als empirische Untersuchungsmethode herangezogen. Als Interviewpartner wurden fünf Personen ausgewählt, die von Berufs wegen mit dem politischen Alltag und dem Thema Krisenkommunikation vertraut sind und so über fundiertes Hintergrundwissen in dem forschungsrelevanten Fall verfügen. Ihre Aussagen und Ansichten zur Causa Wulff werden einer vergleichenden Analyse unterzogen. Am Ende seiner praktischen Untersuchung stellt der Autor die Ergebnisse zur Diskussion und gibt Empfehlungen für zukünftige Forschungsansätze zur Krisenkommunikation von Politikern.
Grundsätzlich muss Christian Wulff an vielen Stellen eine Fehlsteuerung seines Krisenmanagements und ein Versagen hinsichtlich der getroffenen Vorkehrungen zur Krisenabwehr attestiert werden. Der Bundespräsident hat die Eskalation seiner Krise und damit seinen Rücktritt durch diverse Versäumnisse und Verfehlungen selbst verschuldet. Als verheerendste Fehler haben sich Wulffs absente moralische Einsicht und seine defensive Verteidigungstaktik ausgewirkt. Das Bestreben des Mauerns hat die Bedürfnisse der Medien nicht befriedigt und stattdessen neue Nachforschungen heraufbeschworen. Durch diese Haltung war den kommunikativen Aktionen des Bundespräsidenten ihre Wirkung entzogen. Seine Botschaften sind nicht mehr zur Öffentlichkeit durchgedrungen, wodurch Wulff seinen Kredit bei den ihm lange wohlgesonnen Bürgern verspielt hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Krise und ihre Merkmale
- 2.1 Was ist eine Krise?
- 2.2 Krisenarten und -typen
- 2.3 Krisenphasen und ihr Verlauf
- 3. Kommunikation in der Krise
- 3.1 Krisen-PR: was ist das?
- 3.1.1 Einordnung
- 3.1.2 Anforderung und Ziele
- 3.2 Handlungsempfehlungen für einen professionellen Ablauf
- 3.2.1 Imagepflege und Reputationsmanagement
- 3.2.2 Issue-Management und Profiling
- 3.3 Typische Verhaltensweisen und potentielle Fehlerquellen
- 3.4 Strategiealternativen
- 4. Medien und Politik - ein Beziehungsgeflecht der speziellen Art
- 4.1 Medien als Krisenkatalysatoren
- 4.2 Von wechselnden Abhängigkeiten und gegenseitigem Anbandeln
- 4.3 Die Rolle der Spin Doctors
- 5. Der Fall Wulff: Der Niedergang eines Bundespräsidenten
- 5.1 Vorwürfe, Verfehlungen und Verfahren
- 5.1.1 Die Sache mit dem Hauskredit
- 5.1.2 Die Verbindung zum Ehepaar Geerkens
- 5.1.3 Das Echo der Medien
- 5.1.4 Wulffs Reaktion
- 5.1.5 Eine angemessene Krisen-PR?
- 5.2 Das Verhältnis zu den Medien
- 5.2.1 Die Mailboxnachricht an den Chefredakteur
- 5.2.2 Wulffs Reaktion
- 5.2.2.1 Das TV-Interview
- 5.2.3 Eine angemessene Krisen-PR?
- 5.2.4 Das Echo der Medien
- 5.3 Der ominöse Nord-Süd-Dialog
- 5.3.1 Klüngelei zwischen Politik und Wirtschaft?
- 5.4 Urlaub auf Fremdkosten
- 5.4.1 Die Verbindung zu Filmemacher David Groenewold
- 5.4.2 Das Echo der Medien I
- 5.4.3 Die Rolle von Peter Hintze
- 5.4.4 Zum Rücktritt gezwungen!?
- 5.4.5 Das Echo der Medien II
- 6. Zwischenfazit
- 6.1 Bisherige Erkenntnisse
- 6.2 Ableiten der Forschungsfrage
- 6.3 Aufstellen der Forschungshypothesen
- 7. Empirische Untersuchung
- 7.1 Aufbau, Methode und Relevanz von Experteninterviews
- 7.2 Auswahl der Experten
- 7.3 Auswertung und Vergleich
- 7.4 Überprüfung der Hypothesen
- 7.5 Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Krise um den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff aus der Perspektive der Krisenkommunikation. Sie untersucht, ob das Krisenmanagement des Staatsoberhaupts die Krise um seine Person verschärft hat.
- Analyse des Krisenmanagements von Christian Wulff
- Bewertung der Wirksamkeit von Wulffs kommunikativen Maßnahmen
- Untersuchung des Einflusses der Medien auf die Eskalation der Krise
- Bewertung der Rolle von Wulffs persönlicher Kommunikation in der Krise
- Entwicklung von Empfehlungen für die Krisenkommunikation von Politikern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Krisenkommunikation und beleuchtet die Krise um Christian Wulff als Fallbeispiel. Kapitel 2 definiert den Begriff der Krise und beschreibt verschiedene Krisenarten und -phasen. In Kapitel 3 werden die Grundlagen der Krisen-PR erläutert, Handlungsempfehlungen für einen professionellen Ablauf gegeben und typische Verhaltensweisen sowie potentielle Fehlerquellen aufgezeigt. Kapitel 4 analysiert das Verhältnis zwischen Medien und Politik und beleuchtet die Rolle der Medien als Krisenkatalysatoren. Kapitel 5 widmet sich dem Fall Wulff im Detail, analysiert die Vorwürfe, Verfehlungen und Verfahren sowie das Verhältnis des Bundespräsidenten zu den Medien und untersucht die Wirkung seiner kommunikativen Maßnahmen.
Schlüsselwörter
Krisenkommunikation, Krisenmanagement, Politik, Medien, Bundespräsident, Christian Wulff, Imagepflege, Reputationsmanagement, Medienberichterstattung, Krisenphasen, Experteninterview, Fallstudie.
Häufig gestellte Fragen
Warum scheiterte das Krisenmanagement von Christian Wulff?
Die Arbeit attestiert Wulff eine defensive Verteidigungstaktik („Mauern“), mangelnde moralische Einsicht und eine Fehlsteuerung in der Kommunikation mit den Medien.
Welche Rolle spielte die Mailboxnachricht in der Krise?
Die Mailboxnachricht an den Bild-Chefredakteur wird als verheerender Fehler gewertet, der das Verhältnis zu den Medien eskalieren ließ und Wulffs Glaubwürdigkeit massiv schadete.
Was waren die zentralen Vorwürfe gegen den Bundespräsidenten?
Im Zentrum standen die Affäre um einen privaten Hauskredit, Urlaube auf Kosten befreundeter Unternehmer (z.B. David Groenewold) und der Vorwurf der Klüngelei zwischen Politik und Wirtschaft.
War das TV-Interview zur Krisenbewältigung erfolgreich?
Nein, die Untersuchung zeigt, dass das Interview die Bedürfnisse der Medien nicht befriedigte und Wulffs Botschaften nicht mehr zur Öffentlichkeit durchdrangen.
Welche Methode wurde für diese Studie verwendet?
Es wurde eine explorative Studie mittels teilstandardisierter Experteninterviews mit fünf Fachleuten aus Politik und Krisenkommunikation durchgeführt.
Hätte Christian Wulff seinen Rücktritt verhindern können?
Die Arbeit legt nahe, dass durch frühzeitige Transparenz und präventive Maßnahmen die Eskalation hätte vermieden werden können, Wulff jedoch durch diverse Versäumnisse seinen Kredit verspielt hat.
- Quote paper
- Marcel Bohnensteffen (Author), 2012, Der Fall Christian Wulff aus Sicht der Krisenkommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340834