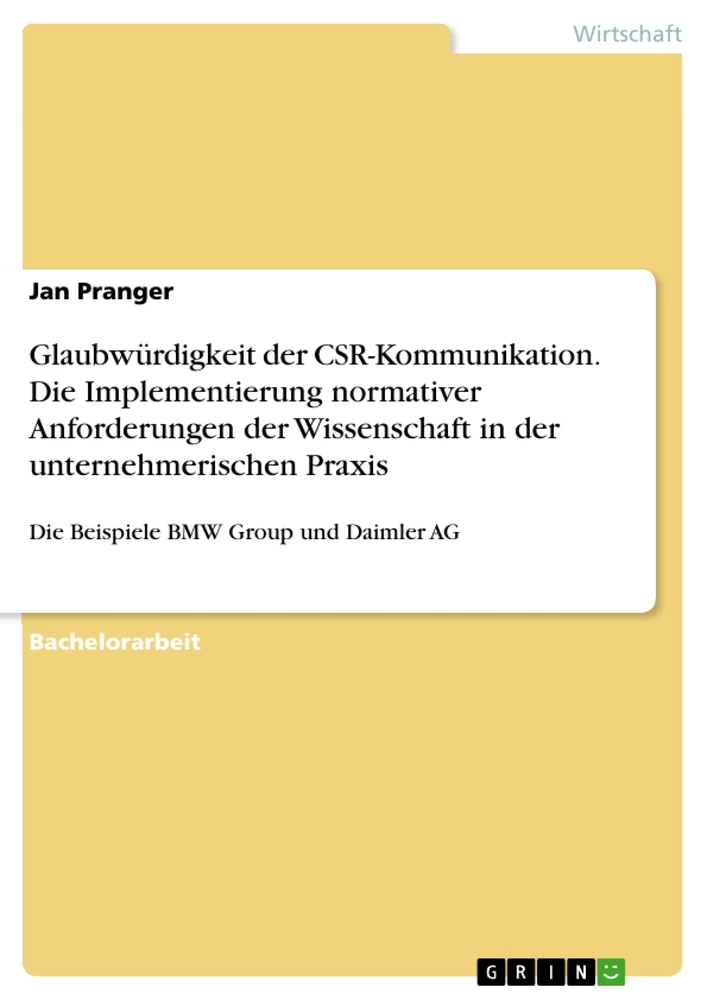Der Klimawandel, das Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich, eine zunehmende globalisierte Wirtschafts- und Arbeitswelt mit einem enormen Verbrauch an natürlichen Ressourcen. Dies sind nur wenige der vielen großen globalen Herausforderungen vor denen wir jetzt und in der Zukunft stehen werden. Die Forderung der Gesellschaft, dass Unternehmen im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit freiwillig mehr Verantwortung übernehmen, um diesen Problemen entgegen zu wirken, wächst seit Jahren. Gerade die großen multinationalen Unternehmen stellen einflussreiche Akteure bei der Bewältigung globaler Herausforderungen dar. Die Wirtschaft muss sich aus diesem Grund mit einer neuen Wertediskussion auseinandersetzen. In diesem Zuge hat ein Konzept immer mehr an Bedeutung gewonnen, mit dem Unternehmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden wollen: Corporate Social Responsibility (CSR). „Maßgebliche Bestandteile von CSR sind in der Unternehmenspraxis zum einen die einzelnen Maßnahmen, in denen die gesellschaftliche Verantwortung zum Ausdruck kommt, und zum anderen die Kommunikation dieser Bemühungen als CSR-Kommunikation“ (Raupp et al. 2011, S. 9). Heute befasst sich die überwiegende Mehrheit der Unternehmen mit CSR und versucht sein freiwilliges gesellschaftliches Engagement positiv nach außen zu kommunizieren. Auf der anderen Seite werden immer wieder Methoden und Verfahrensweisen publik, die offenbaren, dass viele Unternehmen verantwortungslos und nur hinsichtlich ihrer ökonomischen Interessen wirtschaften.
Ausgehend von einem daraus resultierenden Glaubwürdigkeitsproblem soll der Faktor Glaubwürdigkeit in der CSR-Kommunikation mit dem Forschungstand der Wissenschaft verknüpft werden. Es soll herausgefunden werden, welche Anforderungen von Seiten der Wissenschaft an die Unternehmen gestellt werden, um ihre CSR-Aktivitäten glaubwürdig und somit auch erfolgreich zu kommunizieren. Die Erkenntnisse sollen dann mit der tatsächlichen unternehmerischen Praxis der CSR-Kommunikation verglichen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Corporate Social Responsibility
- 2.1 Der CSR Begriff in der wissenschaftlichen Debatte
- 2.2 Offizielle Definitionen von CSR
- 2.2.1 Die CSR-Definition der Europäischen Kommission
- 2.2.2 Die CSR-Definition in der ISO 26000
- 2.3 Abgrenzung der verwandten Begrifflichkeiten von CSR
- 2.3.1 Corporate Governance (CG)
- 2.3.2 Corporate Citizenship (CC)
- 2.3.3 Corporate Sustainability (CS)
- 3. Glaubwürdige CSR-Kommunikation aus der wissenschaftlichen Perspektive
- 3.1 CSR-Kommunikation in der wissenschaftlichen Debatte
- 3.2 Die Stakeholder im Fokus der CSR-Kommunikation
- 3.3 Glaubwürdigkeit als zentrale Herausforderung für CSR-Kommunikation
- 3.4 Normative Anforderungen der Wissenschaft an eine glaubwürdige CSR-Kommunikation
- 4. Glaubwürdigkeit der CSR-Kommunikation im Premiumsegment der deutschen Automobilindustrie
- 4.1 BMW Group
- 4.1.1 Der CSR-Ansatz der BMW Group
- 4.1.2 Die BMW Group und die Implementierung von normativen wissenschaftlichen Anforderungen zu einer glaubwürdigen CSR-Kommunikation
- 4.2 Daimler AG
- 4.2.1 Der CSR-Ansatz der Daimler AG
- 4.2.2 Die Daimler AG und die Implementierung von normativen wissenschaftlichen Anforderungen zu einer glaubwürdigen CSR-Kommunikation
- 4.1 BMW Group
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Glaubwürdigkeit der CSR-Kommunikation in der Praxis. Sie analysiert, wie normative Anforderungen der Wissenschaft in der unternehmerischen Praxis implementiert werden, am Beispiel der BMW Group und der Daimler AG.
- Der Begriff der Corporate Social Responsibility (CSR) und seine wissenschaftliche Einordnung
- Die Bedeutung von Glaubwürdigkeit in der CSR-Kommunikation
- Die Rolle von Stakeholdern in der CSR-Kommunikation
- Die Implementierung von normativen Anforderungen der Wissenschaft in der Praxis
- Die Analyse der CSR-Kommunikation der BMW Group und der Daimler AG
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der CSR-Kommunikation ein und beleuchtet die Bedeutung von Glaubwürdigkeit in diesem Kontext. Kapitel 2 definiert den CSR-Begriff und setzt ihn in Beziehung zu verwandten Begriffen wie Corporate Governance und Corporate Sustainability. Kapitel 3 analysiert die wissenschaftliche Perspektive auf glaubwürdige CSR-Kommunikation und die Rolle von Stakeholdern. Kapitel 4 untersucht die Implementierung von normativen Anforderungen der Wissenschaft in der Praxis anhand der Beispiele BMW Group und Daimler AG. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt Ausblicke auf weitere Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Corporate Social Responsibility (CSR), Glaubwürdigkeit, CSR-Kommunikation, Stakeholder, normative Anforderungen, BMW Group, Daimler AG, Premiumsegment, deutsche Automobilindustrie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Corporate Social Responsibility (CSR)?
CSR bezeichnet das freiwillige gesellschaftliche Engagement von Unternehmen, das über gesetzliche Anforderungen hinausgeht.
Warum ist Glaubwürdigkeit in der CSR-Kommunikation ein Problem?
Ein Glaubwürdigkeitsproblem entsteht, wenn Unternehmen ihr Engagement positiv darstellen, während gleichzeitig verantwortungslose Praktiken publik werden.
Wie setzen BMW und Daimler CSR um?
Die Arbeit analysiert die CSR-Ansätze beider Konzerne und vergleicht sie mit den normativen Anforderungen der Wissenschaft an eine glaubwürdige Kommunikation.
Was sind die Stakeholder in der CSR-Debatte?
Stakeholder sind alle Gruppen, die ein Interesse am Unternehmen haben (z.B. Kunden, Mitarbeiter, Umweltverbände) und im Fokus der CSR-Kommunikation stehen.
Was unterscheidet CSR von Corporate Citizenship?
Während CSR das Kerngeschäft umfasst, bezieht sich Corporate Citizenship eher auf das Engagement des Unternehmens als "guter Bürger" im lokalen Umfeld.
- Quote paper
- Jan Pranger (Author), 2016, Glaubwürdigkeit der CSR-Kommunikation. Die Implementierung normativer Anforderungen der Wissenschaft in der unternehmerischen Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340850