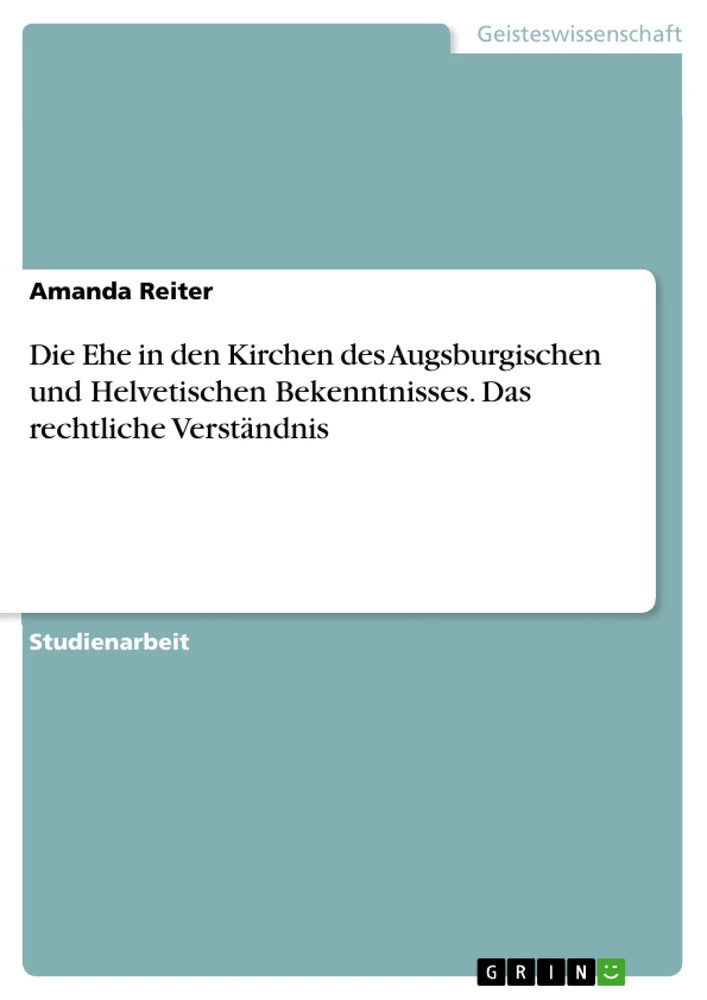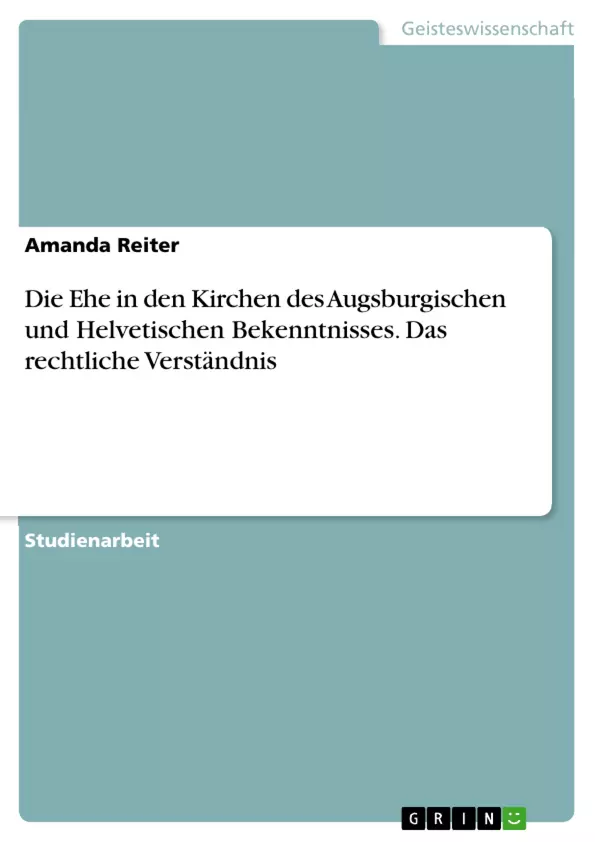Die Ehe kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden, beispielweise aus soziologischer, psychologischer, philosophischer, kirchenrechtlicher oder staatsrechtlicher Sicht. In dieser Arbeit wird das Hauptaugenmerk auf die eherechtlichen Bestimmungen und Vorgaben der evangelischen Kirche Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses in Österreich unter Einbezug der historischen Entwicklung gelegt.
Vorweggenommen sei angemerkt, dass eigentlich jede konfessionell geschlossene Ehe auf rechtsverbindlichen Grundlagen aufbaut. Wenn zwei Menschen heiraten, ergeben sich aus der ehelichen Verbindung Rechte und Pflichten, die sowohl im Kirchenrecht als auch im Zivilrecht verankert sind. Das kirchliche Eherecht beruht auf der Lehre und Sichtweise der jeweiligen Kirche über die Ehe.
Im Folgenden wird die Evangelische Kirche Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses begrifflich erläutert sowie ihre historische Entwicklung im Reformationszeitalter kurz dargestellt. Der daran anschließende geschichtliche Rückblick auf die Wurzeln für das Eheverständnis der Reformatoren, ausgehend von der damals vorherrschenden römisch-katholischen Lehre, soll in Abgrenzung dazu Luthers Ansichten zur Ehe als „weltlich Ding“ darlegen.
Im kanonischen Recht ist die Ehe ein Sakrament, die Reformatoren bestreiten unter Bezugnahme auf Stellen im Neuen Testament die „Sakramentalität“ der Ehe. Das Eherecht unterliegt nicht der eigenen Kirche, sondern wird weltlichen Gerichten überantwortet. Die Befürwortung oder Ablehnung der Ehe als Sakrament hat Auswirkungen auf die Form der Eheschließung und die Zulassung zu einer möglichen Trennung der Ehe. Die Evangelische Kirche thematisiert auch die Frage der Ehelosigkeit und Jungfräulichkeit. Im Gegensatz zur römisch-katholischen Kirche lehnten die Reformatoren allerdings den Zölibat ab. In der Arbeit wird die Position Luthers dazu diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Begriffserklärung Evangelische Kirche A. u. H. B.
- 2. Geschichtlicher Rückblick auf die Entstehung der evangelischen Kirche
- 2.1. Augsburger Bekenntnis
- 2.2. Helvetisches Bekenntnis
- 3. Das Eheverständnis der Reformatoren
- 3.1. Ehe als „weltlich Ding“
- 3.2. Sakramentalität der Ehe
- 3.3. Trennung und Scheidung
- 3.4. Die Doppelehe des Landgrafen Philipp I. von Hessen
- 3.5. Augsburger und Helvetisches Bekenntnis im Vergleich
- 4. Ehelosigkeit und Jungfräulichkeit
- 5. Eheverständnis der evangelischen Kirchen in Österreich heute
- 5.1. Einehe
- 5.2. Eheschließung
- 5.3. Konfessionsverschiedene Ehen
- 5.4. Scheitern und Auflösung der Ehe
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das kirchliche Eherecht der evangelischen Kirche Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses (A. u. H. B.) in Österreich unter Berücksichtigung der historischen Entwicklung. Sie analysiert das Verständnis der Ehe in der evangelischen Kirche im Kontext der Reformation und der heutigen Zeit, indem sie den Vergleich zur römisch-katholischen Lehre und den Rechtspositionen des Staates heranzieht.
- Entwicklung des Eheverständnisses in der evangelischen Kirche A. u. H. B.
- Vergleich des Eheverständnisses der evangelischen Kirche A. u. H. B. mit der römisch-katholischen Lehre.
- Die Bedeutung der Ehe als "weltlich Ding" im Kontext der Reformation.
- Rechtliche Aspekte der Eheschließung und Auflösung der Ehe.
- Seelsorgerische Aufgaben der Kirche im Kontext von Ehe und Scheidung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den Fokus der Arbeit, der auf die eherechtlichen Bestimmungen und Vorgaben der evangelischen Kirche A. u. H. B. in Österreich gelegt wird. Sie hebt die Bedeutung des Kirchenrechts im Vergleich zum Zivilrecht hervor und stellt die Besonderheiten des evangelischen Eheverständnisses im Vergleich zur römisch-katholischen Kirche dar.
Kapitel 1 definiert den Begriff "Evangelische Kirche A. u. H. B." und beschreibt die historische Entwicklung der beiden großen protestantischen Kirchen in Österreich.
Kapitel 2 gibt einen historischen Rückblick auf die Entstehung der evangelischen Kirche. Es werden die Anfänge der reformatorischen Bewegung durch Martin Luther und die Entwicklung des Augsburger Bekenntnisses sowie des Helvetischen Bekenntnisses beleuchtet.
Kapitel 3 untersucht das Eheverständnis der Reformatoren, insbesondere Luthers Ansichten zur Ehe als "weltlich Ding". Es werden die Sakramentalität der Ehe, die Themen Trennung und Scheidung sowie die kontroverse Doppelehe des Landgrafen Philipp I. von Hessen im Vergleich zwischen Augsburger und Helvetischem Bekenntnis behandelt.
Kapitel 4 befasst sich mit dem Thema Ehelosigkeit und Jungfräulichkeit, wobei die Position Luthers im Gegensatz zur Lehre der römisch-katholischen Kirche diskutiert wird.
Kapitel 5 analysiert das Eheverständnis der evangelischen Kirchen in Österreich heute, indem es die Themen Einehe, Eheschließung, konfessionsverschiedene Ehen und Scheidung unter Bezugnahme auf die aktuellen rechtlichen Regelungen und seelsorgerischen Aufgaben der Kirche beleuchtet.
Schlüsselwörter
Evangelische Kirche A. u. H. B., Eherecht, Reformation, Martin Luther, Augsburger Bekenntnis, Helvetisches Bekenntnis, Ehe als "weltlich Ding", Sakramentalität, Trennung, Scheidung, Ehelosigkeit, Jungfräulichkeit, Eheschließung, Konfessionsverschiedene Ehen, Seelsorge.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich das evangelische Eheverständnis vom katholischen?
Im Gegensatz zur katholischen Kirche betrachten die evangelischen Kirchen des A. u. H. B. die Ehe nicht als Sakrament, sondern als „weltlich Ding“ (nach Luther).
Was bedeutet Luthers Begriff der Ehe als weltlich Ding?
Dies bedeutet, dass das Eherecht nicht der Kirche, sondern weltlichen Gerichten und Gesetzen unterstellt ist, obwohl die Ehe dennoch unter Gottes Segen steht.
Sind Scheidung und Wiederheirat in der evangelischen Kirche möglich?
Da die Ehe kein Sakrament (und somit nicht unauflöslich im kanonischen Sinne) ist, akzeptiert die evangelische Kirche das Scheitern einer Ehe und ermöglicht unter seelsorgerischer Begleitung eine Wiederheirat.
Warum lehnten die Reformatoren den Zölibat ab?
Die Reformatoren, insbesondere Luther, lehnten die verpflichtende Ehelosigkeit für Geistliche ab und betonten den Wert der Ehe gegenüber der Jungfräulichkeit.
Was sind konfessionsverschiedene Ehen?
Die Arbeit beleuchtet die heutige Praxis in Österreich im Umgang mit Ehen, bei denen die Partner unterschiedlichen Konfessionen angehören.
- Citar trabajo
- Mag. iur. Amanda Reiter (Autor), 2016, Die Ehe in den Kirchen des Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses. Das rechtliche Verständnis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340935