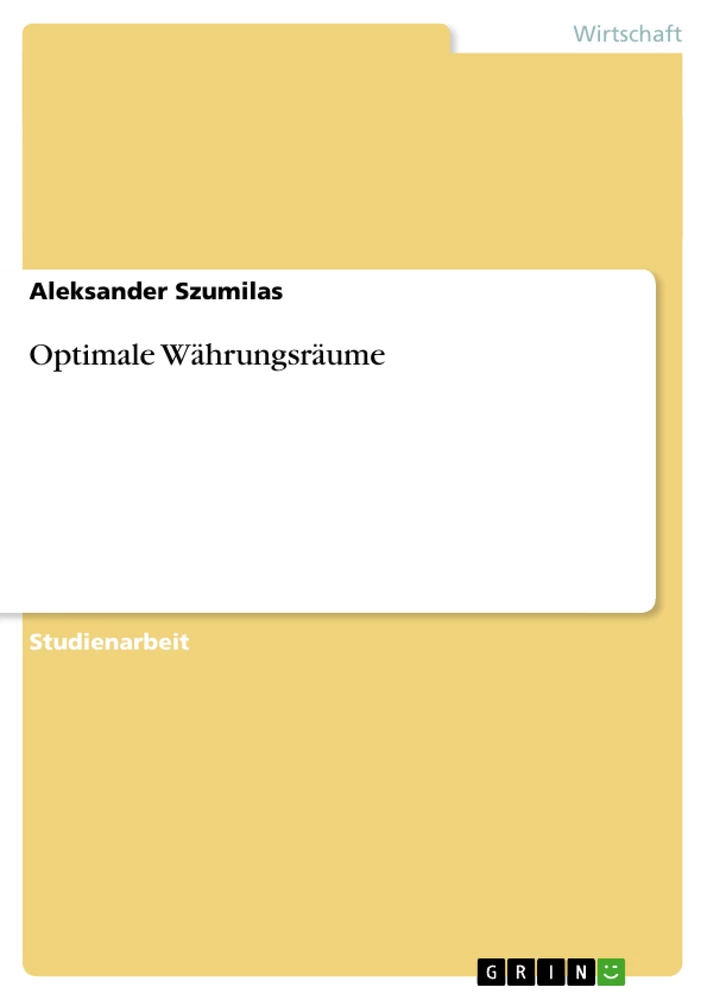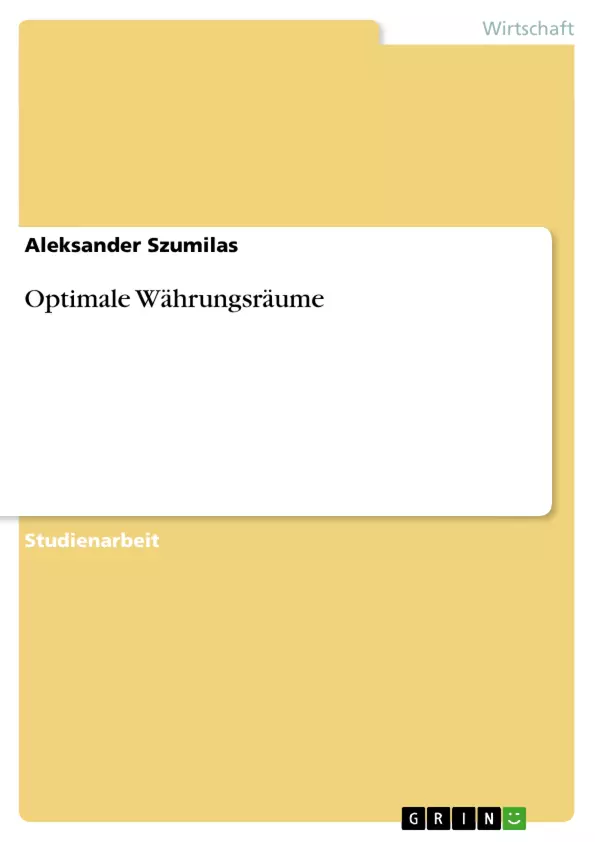Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die Analyse des optimalen Währungsraumes. Hierbei handelt es sich hierbei um diverse Betrachtungsmöglichkeiten, die - jeweils mit Vor- und Nachteilen behaftetdifferenzierte Ansätze darstellen.
Einleitend sollte jedoch erst der Begriff des „Währungsraumes“ näher beleuchtet werden: ein „Währungsraum“ setzt sich aus mehreren souveränen Staaten zusammen, die ihre Wechselkurse unwiderruflich und ohne mögliche Schwankungsbreiten fixieren; weiter ist eine uneingeschränkte Konvertibilität der Währungen von Nöten. Dies ist bei der Ausrichtung eines Landes an eine ausländische Ankerwährung gegeben, wie beispielsweise im Fall vieler lateinamerikanischer Staaten, die den Wechselkurs an den Dollar fixierten, oder dem „CFA Franc“ 1 , der zunächst an den französischen Franc gebunden war und nun an den Euro fixiert ist. Eine einheitliche Währung ist dabei keine unabdingbare Voraussetzung für einen Währungsraum, verstärkt jedoch, wie auch der Beschluss zu einer gemeinsamen Zentralbank, die Glaubwürdigkeit der gemeinsamen Geld- und Währungspolitik eines Währungsraumes: „To the extend that a curreny union is more costly to break than a promise to maintain a fixed exchange rate, the curreny adoption is more credible.“ 2 Weiterhin ist ein Währungsraum nach außen gegenüber anderen Währungsräumen durch flexible Wechselkurse abgegrenzt und stellt hierdurch eine „Festkursinsel in einem Meer flexibler Wechselkurse“ 3 dar. Voraussetzung des optimalen Währungsraumes ist die Fähigkeit ohne Einsatz des Wechselkurinstruments gegen exogene Schocks vorzugehen. Dabei stehen verschiede Ansätze zu dessen Bestimmung in der Tradition keynsianischer Modelle. Zu Beginn des Vorhabens werden die traditionellen Theorien näher erläutert. Zusätzlich folgt die Analyse makroökonomischer Bezugsgrößen bei empirischen Untersuchungen. Anschließend erfolgt eine genauere Betrachtung der Kosten bzw. Nutzen -Kriterien im Hinblick auf einen Währungsraum. Danach werden empirische Befunde der Europäischen Währungsunion aufgezeigt und weitere mögliche Währungsräume genannt.
Inhaltsverzeichnis
- Definition des Begriffs „Währungsraum“ und Zielsetzung
- Theorien optimaler Währungsräume
- Traditionelle Ansätze
- Mundells Theorie des optimalen Währungsraumes: Faktormobilität
- McKinnons Theorie des optimalen Währungsraumes: Offenheitsgrad
- Kenens Beitrag: die Theorie der Produktdiversifikation
- Makroökonomische Kriterien
- Internationaler Konjunkturzusammenhang
- Übereinstimmende Inflationsraten
- Institutionelle Symmetrie
- Nutzen- und Kostenanalyse eines Währungsraumes
- Nutzenkriterien
- Reduktion der Transaktions- und Informationskosten
- Reduktion der Opportunitätskosten
- Erhöhung der Investitions- und Handelstätigkeit
- Kosten
- Verslust der wirtschaftpolitischen Autonomie
- Umstellungskosten
- Empirische Befunde zum Europäischen Währungsraum
- Die EWU hinsichtlich der traditionellen Theorien
- Die EWU bezüglich makroökonomischer Variablen
- Fazit
- Weitere „mögliche“ Währungsräume
- Datenübersicht
- Mögliche Währungsräume: Tabellarische Übersicht
- Währungsräume: visuelles Resultat
- Resümee und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Thematik des optimalen Währungsraumes und analysiert verschiedene theoretische Ansätze und empirische Ergebnisse. Ziel ist es, die Determinanten für einen optimalen Währungsraum zu identifizieren und zu verstehen, welche Kriterien für die erfolgreiche Etablierung einer Währungsunion entscheidend sind.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Währungsraum“
- Theoretische Ansätze zur Bestimmung optimaler Währungsräume
- Nutzen und Kosten einer Währungsunion
- Empirische Befunde am Beispiel des Europäischen Währungsraumes
- Analyse weiterer möglicher Währungsräume
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert den Begriff „Währungsraum“ und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Es werden die grundlegenden Merkmale eines Währungsraumes, wie z.B. die Fixierung der Wechselkurse und die Konvertibilität der Währungen, dargestellt. Das zweite Kapitel widmet sich den Theorien optimaler Währungsräume und präsentiert verschiedene Ansätze, die sich mit der optimalen Größe und Struktur von Währungsräumen auseinandersetzen. Hierzu gehören die traditionellen Theorien von Mundell, McKinnon und Kenen, die verschiedene Faktoren wie Faktormobilität, Offenheitsgrad und Produktdiversifikation in den Fokus nehmen. Außerdem werden makroökonomische Kriterien wie der internationale Konjunkturzusammenhang, die Inflationsraten und die institutionelle Symmetrie diskutiert. Im dritten Kapitel werden die Nutzen und Kosten eines Währungsraumes analysiert. Es wird beleuchtet, wie eine Währungsunion die Transaktions- und Informationskosten reduzieren, die Opportunitätskosten senken und die Investitions- und Handelstätigkeit fördern kann. Gleichzeitig werden die Kosten, die mit der Bildung eines Währungsraumes verbunden sind, wie z.B. der Verlust der wirtschaftlichen Autonomie und die Umstellungskosten, erörtert. Das vierte Kapitel beleuchtet die empirischen Befunde zum Europäischen Währungsraum. Die Arbeit analysiert die EWU im Hinblick auf die traditionellen Theorien und untersucht, inwieweit die makroökonomischen Variablen die Kriterien für einen optimalen Währungsraum erfüllen. Das fünfte Kapitel untersucht weitere „mögliche“ Währungsräume und präsentiert Datenübersicht, eine tabellarische Übersicht möglicher Währungsräume und ein visuelles Resultat der Analyse.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die zentralen Themen des optimalen Währungsraumes, wobei die Analyse sich auf die Determinanten für eine erfolgreiche Währungsunion konzentriert. Die Arbeit befasst sich mit Theorien von Mundell, McKinnon und Kenen, untersucht makroökonomische Kriterien wie den internationalen Konjunkturzusammenhang, die Inflationsraten und die institutionelle Symmetrie, analysiert die Nutzen und Kosten eines Währungsraumes und untersucht empirische Befunde am Beispiel des Europäischen Währungsraumes.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einem „Währungsraum“?
Ein Währungsraum besteht aus mehreren souveränen Staaten, die ihre Wechselkurse unwiderruflich fixieren und eine uneingeschränkte Konvertibilität ihrer Währungen gewährleisten. Eine gemeinsame Währung ist dabei nicht zwingend erforderlich, erhöht jedoch die Glaubwürdigkeit der Geldpolitik.
Welche traditionellen Theorien gibt es zum optimalen Währungsraum?
Zu den traditionellen Ansätzen gehören Mundells Theorie der Faktormobilität, McKinnons Fokus auf den Offenheitsgrad einer Volkswirtschaft und Kenens Theorie der Produktdiversifikation.
Was sind die Vorteile eines Währungsraumes?
Zu den Hauptvorteilen zählen die Reduktion von Transaktions- und Informationskosten, die Senkung von Opportunitätskosten sowie eine potenzielle Erhöhung der Investitions- und Handelstätigkeit zwischen den Mitgliedstaaten.
Welche Kosten entstehen durch den Beitritt zu einer Währungsunion?
Die wesentlichen Kosten sind der Verlust der wirtschaftspolitischen Autonomie (insbesondere der Wechselkurspolitik) sowie einmalige Umstellungskosten bei der Einführung einer gemeinsamen Währung.
Welche makroökonomischen Kriterien sind für einen optimalen Währungsraum wichtig?
Wichtige Kriterien sind ein enger internationaler Konjunkturzusammenhang, übereinstimmende Inflationsraten sowie eine institutionelle Symmetrie zwischen den beteiligten Ländern.
Wie wird die Europäische Währungsunion (EWU) in diesem Kontext bewertet?
Die Arbeit analysiert die EWU sowohl anhand der traditionellen Theorien als auch bezüglich makroökonomischer Variablen, um festzustellen, inwieweit sie die Kriterien eines optimalen Währungsraumes erfüllt.
- Citation du texte
- Aleksander Szumilas (Auteur), 2004, Optimale Währungsräume, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34167