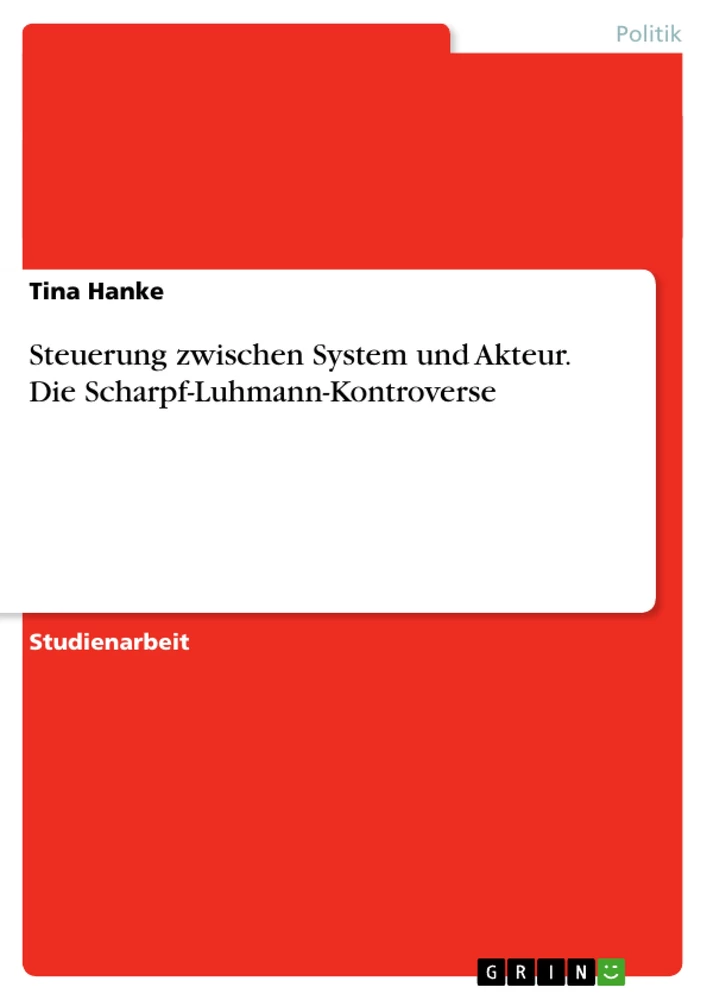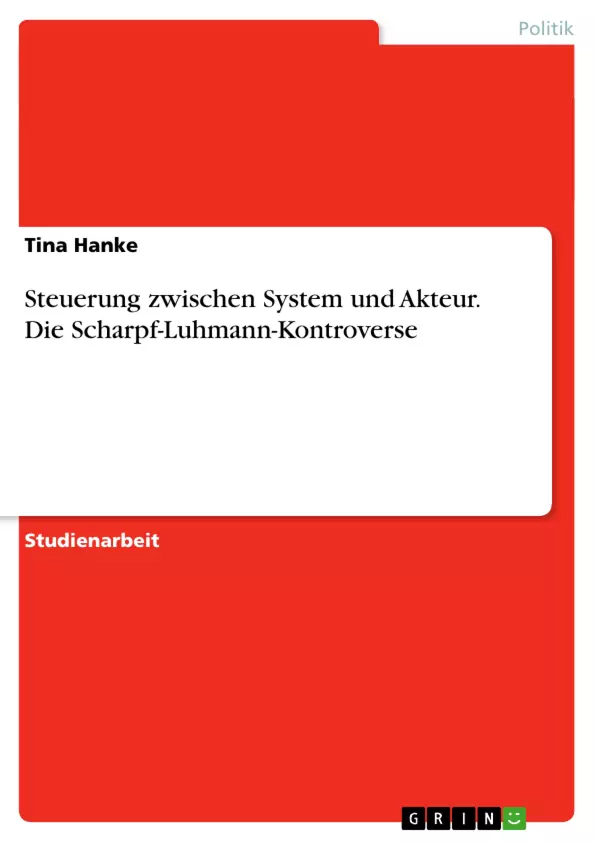„Die Welt ist im Aufbruch, sie wartet nicht auf Deutschland. Aber es ist auch noch nicht zu spät. Durch Deutschland muß ein Ruck gehen“. Das forderte der ehe malige Bundespräsident Roman Herzog in seiner berühmt gewordenen Adlon Rede 1997, in dem Jahr, in dem sich die Ära Kohl dem Ende zuneigte, die große Steuerreform scheiterte und das Wort „Reformstau“ von der Gesellschaft für deutsche Sprache zum Wort des Jahres gewählt wurde. Herzog kritisierte weiter: In Zeiten existentieller Herausforderung wird nur der gewinnen, der wirklich zu führen bereit ist, dem es um Überzeugung geht und nicht um politische, wirtschaftliche oder mediale Macht – ihren Erhalt oder auch ihren Gewinn. Wir sollten die Vernunft- und Einsichtsfähigkeit der Bürger nicht unterschätzen. Wenn es um die großen Fragen geht, honorieren sie einen klaren Kurs. Unsere Eliten dürfen den notwendigen Reformen nicht hinterherlaufen, sie müssen an ihrer Spitze stehen!
Doch leider ist der symbolischen Ruckrede kein wirklicher Reformruck gefolgt. 2004, sieben Jahre später, ist die Reformstaudebatte aktueller denn je. Zwar war die „Agenda 2010“ von Kanzler Schröder eigentlich als umfassendes Reformpaket geplant, doch heute, ein Jahr nach ihrer Verkündigung, wird deutlich, dass von einem wirklichen „Ruck“ nicht die Rede sein kann. Noch immer sind die meisten Reformen nicht durchgesetzt oder zu harmlosen „Reförmchen“ zusammengeschrumpft, die im besten Falle ein paar Symptome lindern können. Als einzige Reform wurde bis jetzt die des Gesundheitswesens umfassend durchgesetzt, die in ihrem Gehalt jedoch sehr umstritten ist. Viele Kritiker sind der Meinung, dass erhöhte Zuzahlungen zu Arzneien, Praxisgebühren und nach wie vor hohe Krankenkassenbeiträge dem Bürger wieder das Geld aus der Tasche ziehen, das er durch die vorgezogene Steuerreform gewonnen hat, und somit auch die Steuerreform in ihrem Kern unwirksam machen. Wo kein Geld im Portemonnaie, da auch keine Ankurbelung der Konjunktur. Doch nicht nur, dass viele geplante Reformen in ihrem Gehalt höchst umstritten sind – die meisten lassen sich scheinbar gar nicht durchsetzen und sind erst einmal auf unbekannt verschoben. So die Pflegeversicherung, die ursprünglich am 5. März dieses Jahres als Gesetz in den Bundestag eingebracht werden sollte, die nun aber erst einmal von Schröder gestoppt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- System versus Akteur
- Das Problem mit der Kommunikation
- Die Stellung des politischen Systems
- Steuerbarkeit versus Steuerungsfähigkeit
- Konsequenzen für die Politikwissenschaft
- Tabellarische Zusammenfassung
- Schlussbetrachtung: Perspektiven einer politischen Steuerung zwischen System und Akteur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die Scharpf-Luhmann-Kontroverse über die Möglichkeiten der politischen Steuerung in modernen Gesellschaften zu beleuchten. Dabei werden die gegensätzlichen Ansätze der beiden Soziologen miteinander verglichen und auf ihre Relevanz für die aktuelle Reformstaudebatte eingegangen.
- Die Rolle des politischen Systems in der Steuerung von Gesellschaften
- Die Bedeutung von Akteuren und deren Handlungsspielraum
- Die Herausforderungen der Kommunikation in komplexen Gesellschaften
- Der Einfluss von Systemstrukturen auf die Steuerbarkeit von Prozessen
- Die Grenzen der politischen Steuerung in einer funktional differenzierten Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Ausgangssituation der aktuellen Reformstaudebatte in Deutschland dar und führt den Begriff der politischen Steuerung ein. Dabei wird Bezug auf die Rede von Roman Herzog genommen und die Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Reformen beleuchtet.
- System versus Akteur: Dieses Kapitel beschreibt den grundlegenden Unterschied zwischen den Ansätzen von Scharpf und Luhmann. Scharpf sieht die Akteure als den wichtigsten Faktor für politische Steuerung, während Luhmann die Systemstrukturen als entscheidend betrachtet.
- Das Problem mit der Kommunikation: Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen der Kommunikation in komplexen Gesellschaften und dem Einfluss auf die politische Steuerung.
- Die Stellung des politischen Systems: Dieses Kapitel beleuchtet die Stellung des politischen Systems in der Gesellschaft und seine Rolle im Hinblick auf die Steuerung.
- Steuerbarkeit versus Steuerungsfähigkeit: Hier werden die Begriffe Steuerbarkeit und Steuerungsfähigkeit im Kontext der politischen Steuerung diskutiert.
- Konsequenzen für die Politikwissenschaft: Dieses Kapitel zeigt die Konsequenzen der Scharpf-Luhmann-Kontroverse für die Politikwissenschaft auf.
- Tabellarische Zusammenfassung: Dieses Kapitel bietet eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Argumente der beiden Ansätze.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen politische Steuerung, System, Akteur, Kommunikation, Steuerbarkeit, Steuerungsfähigkeit, Reformstau, Scharpf-Luhmann-Kontroverse.
- Citation du texte
- Tina Hanke (Auteur), 2004, Steuerung zwischen System und Akteur. Die Scharpf-Luhmann-Kontroverse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34200