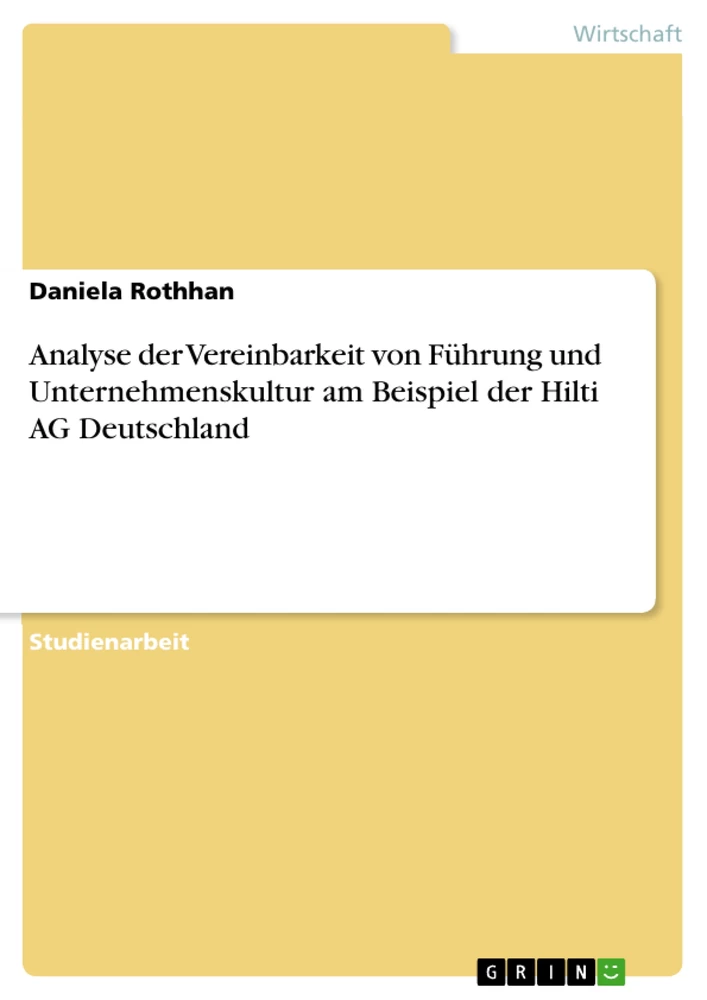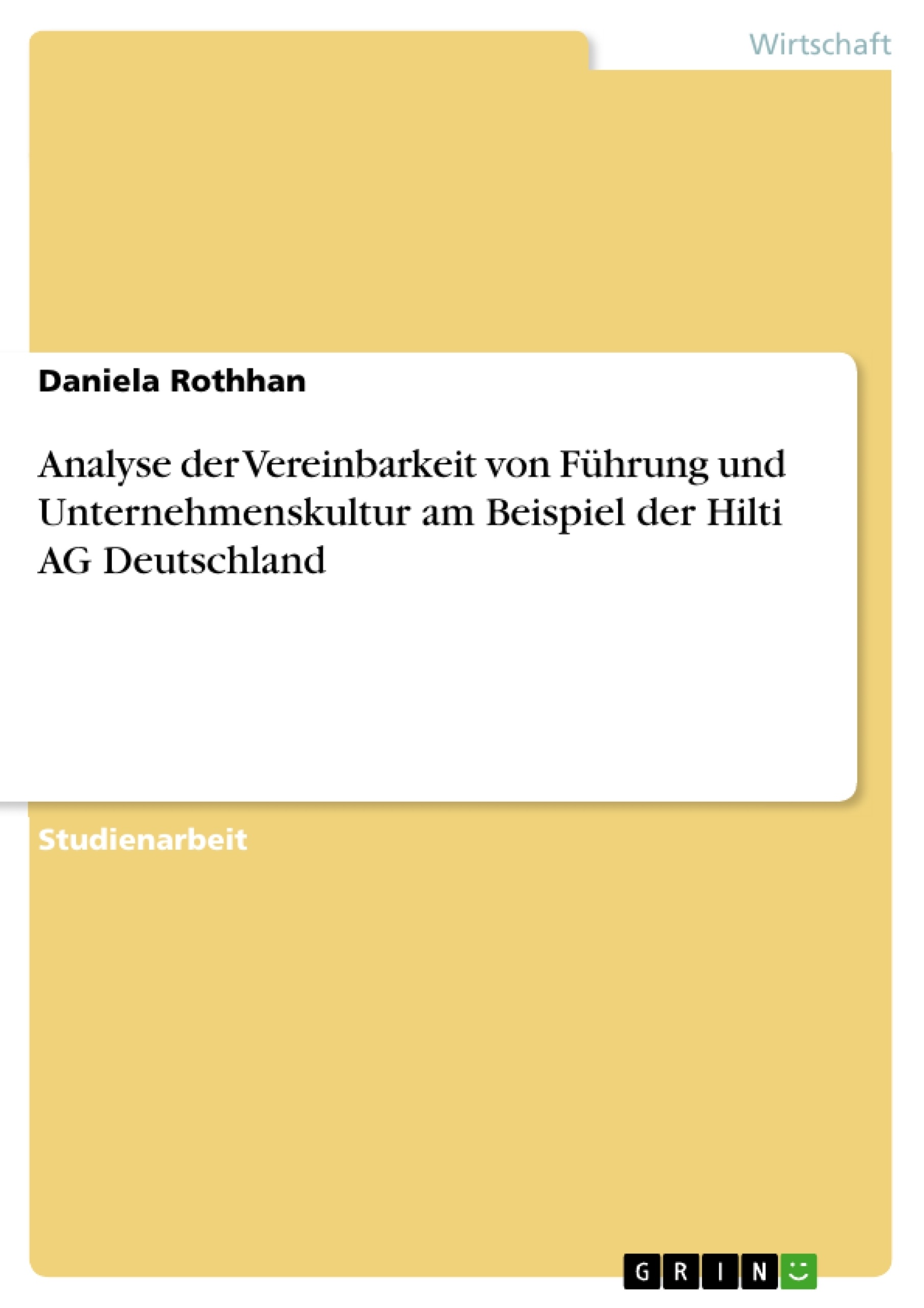Die vorliegende Hausarbeit erklärt die Bedeutung und die Gründe für die Relevanz einer auf die Unternehmenskultur abgestimmten Führung, um im Anschluss exemplarisch am Beispiel der Hilti AG eine vorbildliche Vereinbarkeit von Unternehmenskultur und Führungsverhalten näher zu analysieren.
Alternde Belegschaften, Fachkräftemangel und War for Talents – das sind derzeit wesentliche Tendenzen in der Arbeitswelt. Um neue, qualifizierte Fachkräfte für das eigene Unternehmen zu gewinnen und bewährte Fachkräfte an das Unternehmen zu binden, muss sich das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber positionieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ziel der Hausarbeit
- 1.2 Vorgehensweise
- 2 Führungstheoretische Definitionen und Grundlagen
- 2.1 Führung
- 3 Unternehmenskultur als Führungsaufgabe
- 3.1 Steuerung der Unternehmenskultur durch die Führung
- 3.1.1 Steuerung der Unternehmenskultur durch indirekte Führung
- 3.1.2 Steuerung der Unternehmenskultur durch indirekte Führung
- 4 Analyse einer vorbildlichen Vereinbarkeit von Führung und Unternehmenskultur am Beispiel der Hilti AG Deutschland
- 4.1 Kurzvorstellung der Carl Bertelsmann Stiftung
- 4.2 Kurzvorstellung der Hilti AG
- 4.3 Vorgehensweise und Auswahlkriterien des Carl Bertelsmann Preises 2003
- 4.4 Analyse der Unternehmenskultur der Hilti AG
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Bedeutung und Relevanz einer auf die Unternehmenskultur abgestimmten Führung. Sie analysiert am Beispiel der Hilti AG, wie eine vorbildliche Vereinbarkeit von Unternehmenskultur und Führungsverhalten erreicht werden kann.
- Der Einfluss von Führung auf die Unternehmenskultur
- Die Rolle der Führungskräfte bei der Gestaltung einer starken Unternehmenskultur
- Die Bedeutung der Unternehmenskultur für die Gewinnung und Bindung von Fachkräften
- Die Analyse eines konkreten Beispiels für eine erfolgreiche Vereinbarkeit von Führung und Unternehmenskultur
- Die Relevanz von Führungstheorien und -stilen im Kontext der Unternehmenskultur
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Hausarbeit ein und erläutert das Ziel und die Vorgehensweise. Es werden die relevanten Begrifflichkeiten und Grundlagen definiert, insbesondere der Begriff der Führung. Das zweite Kapitel erläutert das Zusammenspiel von Unternehmenskultur und Führungsverhalten. Der Hauptteil der Arbeit analysiert die vorbildliche Umsetzung von Führungsverhalten in Bezug auf die Unternehmenskultur der Hilti AG Liechtenstein. Die Hausarbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse und einem Fazit.
Schlüsselwörter
Unternehmenskultur, Führung, Führungsverhalten, Hilti AG, Fachkräftemangel, Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeitermotivation, Führungstheorien, Mitarbeiterbindung, Steuerung der Unternehmenskultur, Indirekte Führung, Carl Bertelsmann Stiftung, Carl Bertelsmann Preis.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Unternehmenskultur heute so relevant für die Führung?
Angesichts von Fachkräftemangel und dem "War for Talents" müssen sich Unternehmen durch eine starke Kultur als attraktive Arbeitgeber positionieren.
Welches Unternehmen dient als Praxisbeispiel für gute Führung?
Die Arbeit analysiert die vorbildliche Vereinbarkeit von Führung und Kultur am Beispiel der Hilti AG Deutschland.
Was ist die Aufgabe von Führungskräften bei der Unternehmenskultur?
Führungskräfte steuern die Unternehmenskultur sowohl durch direktes Handeln als auch durch indirekte Führungsmethoden.
Welche Rolle spielt die Carl Bertelsmann Stiftung in der Arbeit?
Die Arbeit bezieht sich auf die Auswahlkriterien und die Analyse der Hilti AG im Rahmen des Carl Bertelsmann Preises 2003.
Wie trägt die Unternehmenskultur zur Mitarbeiterbindung bei?
Eine abgestimmte Kultur fördert die Motivation und Identifikation der Mitarbeiter, was die langfristige Bindung ans Unternehmen stärkt.
- Quote paper
- Daniela Rothhan (Author), 2016, Analyse der Vereinbarkeit von Führung und Unternehmenskultur am Beispiel der Hilti AG Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342500