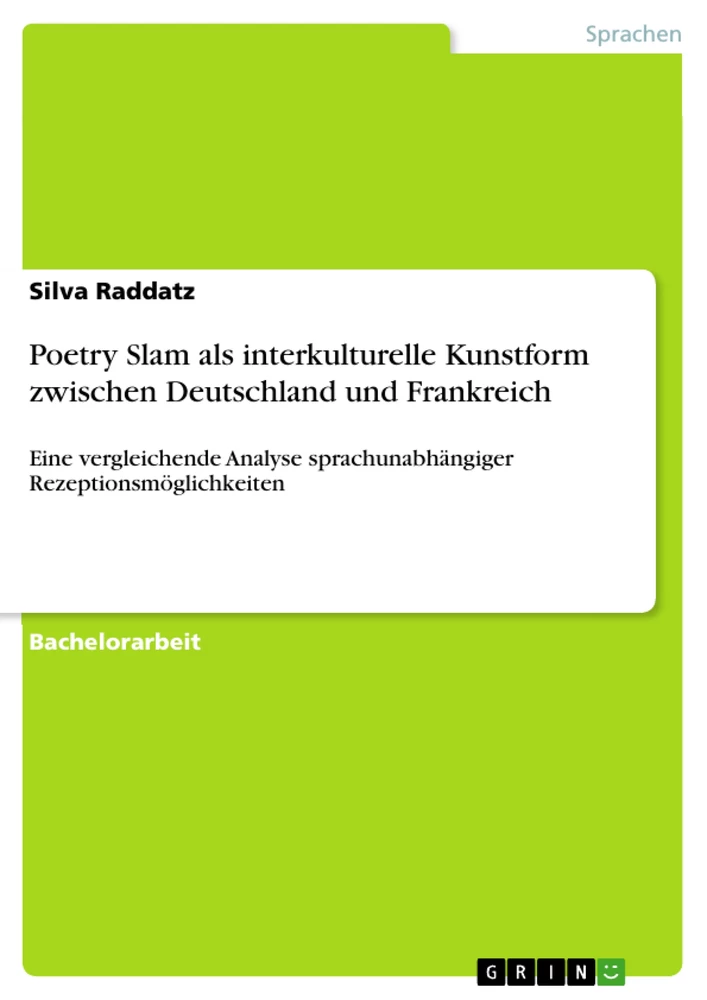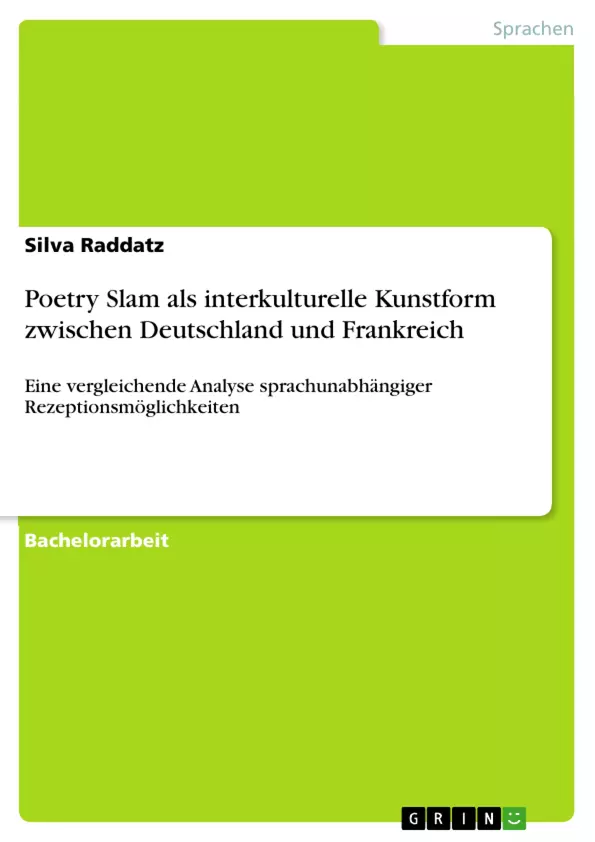Das junge Phänomen Poetry Slam eröffnet neue Möglichkeiten interkultureller Begegnungen und interkulturellen Lernens in Zeiten der Globalisierung. Die vorliegende Arbeit erörtert diese Möglichkeiten am Beispiel der Länder Deutschland und Frankreich, in denen die Slam-Bewegung äußerst populär ist. Zunächst soll ein Vergleich der beiden Slam-Szenen mögliche Unterschiede aufdecken und die wichtigsten Komponenten des Slams herausstellen, der sich in die Bewegung, das Veranstaltungsformat und dazugehörige literarische Genre gliedern lässt. In einem weiteren Schritt werden die erarbeiteten Merkmale im interkulturellen Kontext betrachtet.
Hierbei werden die Vorteile des demokratischen Grundgedankens, des Entgegenwirkens gegen soziologische Individualisierungsprozesse und des interaktiven Veranstaltungsformats aufgezeigt, aber auch etwaige Schwierigkeiten bei thematischen oder stilistischen Divergenzen zwischen dem deutschen und dem französischen Literaturgenre sowie das grundsätzliche Problem der
Sprachbarriere thematisiert. Abschließend wird auf erweiternde Perspektiven wie die Durchführung Slam-begleitender Schreibwerkstätten oder die gemeinschaftliche Produktion mehrsprachiger Slam Poetry hingewiesen. Deutsch-französische Poetry Slams erweisen sich auf vielerlei Ebenen als vielversprechend.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Poetry Slam - interkulturell?
- 1.2 Forschungsstand
- 2 Die Poetry-Slam-Szenen in Deutschland und Frankreich im Vergleich
- 2.1 Zu den Begriffen Kultur, Land und Sprache
- 2.2 Vergleich der literarischen Bewegung Slam und des Veranstaltungsformats Poetry Slam
- 2.2.1 Slam als demokratisches Handeln
- 2.2.1.1 Offenheit und Toleranz als Maximen der Slamily
- 2.2.1.2 Freie Meinungsäußerung und Sprachrohrfunktion
- 2.2.1.3 Slam als Bindeglied zwischen Elite- und Populärkultur
- 2.2.1.4 Abschließender Vergleich
- 2.2.2 Slam als Parallelentwicklung zu Individualisierungsprozessen in modernen Gesellschaften
- 2.2.2.1 Authentizität
- 2.2.2.2 Oralität
- 2.2.2.3 Emotionalität
- 2.2.3 Die Performance
- 2.2.3.1 Nonverbale und paraverbale Kommunikation
- 2.2.3.2 Interaktivität
- 2.2.3.3 Wettbewerb
- 2.3 Vergleich des literarischen Genres Slam Poetry
- 2.3.1 Gegenüberstellung der Genre-Definitionen
- 2.3.2 Inhaltliche Merkmale deutscher und französischer Slam Poetry
- 2.3.2.1 Thematische Schwerpunkte
- 2.3.2.2 Humoristische Texte
- 2.3.3 Stilistische Merkmale deutscher und französischer Slam Poetry
- 2.3.3.1 Kürze
- 2.3.3.2 Wortschatz
- 2.3.3.3 Rhetorische Stilmittel
- 2.3.3.4 Lautpoesie
- 3 Eignung des Slams für deutsch-französische Literaturveranstaltungen
- 3.1 Definition des Begriffs „interkulturell“
- 3.2 Textexterne Faktoren der literarischen Bewegung Slam und des Veranstaltungsformats Poetry Slam
- 3.2.1 Slam als demokratisches Handeln
- 3.2.1.1 Offenheit und Toleranz als Maximen der Slamily
- 3.2.1.2 Freie Meinungsäußerung und Sprachrohrfunktion
- 3.2.1.3 Slam als Bindeglied zwischen Elite- und Populärkultur
- 3.2.2 Slam als Parallelentwicklung zu Individualisierungsprozessen in modernen Gesellschaften
- 3.2.2.1 Authentizität
- 3.2.2.2 Oralität
- 3.2.2.3 Emotionalität
- 3.2.3 Die Performance
- 3.2.3.1 Nonverbale und paraverbale Kommunikation
- 3.2.3.2 Interaktivität
- 3.2.3.3 Wettbewerb
- 3.3 Textimmanente Faktoren des literarischen Genres Slam Poetry
- 3.3.1 Inhaltliche Faktoren
- 3.3.1.1 Thematische Schwerpunkte
- 3.3.1.2 Humoristische Texte
- 3.3.2 Stilistische Faktoren
- 3.3.2.1 Kürze
- 3.3.2.2 Wortschatz
- 3.3.2.3 Rhetorische Stilmittel
- 3.3.2.4 Lautpoesie
- 4 Schluss
- 4.1 Zusammenfassung
- 4.2 Ausblick
- 5 Anhang: Grundlegendes zum Slam
- 5.1 Geschichte
- 5.1.1 Die Entstehung des Slams in den USA
- 5.1.2 Die historische Entwicklung des Slams in Deutschland und Frankreich
- 5.2 Regeln und Formate
- 5.2.1 Regeln und Formate in Deutschland
- 5.2.2 Regeln und Formate in Frankreich
- 5.2.3 Abschließender Vergleich: Frankreichs Tendenz zur produktiven Rezeption von Kulturimporten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Potenzial von Poetry Slams für interkulturellen Austausch, speziell zwischen Deutschland und Frankreich. Ziel ist es, die Eignung des Formats für deutsch-französische Veranstaltungen zu analysieren, dabei sowohl die Vorteile als auch die Herausforderungen zu beleuchten.
- Vergleich der Poetry-Slam-Szenen in Deutschland und Frankreich
- Analyse des Slams als demokratisches und interaktives Veranstaltungsformat
- Untersuchung der sprachlichen und stilistischen Merkmale deutscher und französischer Slam Poetry
- Bewertung der interkulturellen Relevanz von Poetry Slams
- Ausblick auf Möglichkeiten der Förderung interkulturellen Austauschs durch Poetry Slams
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die These auf, dass Poetry Slams trotz der Sprachbarriere ein vielversprechendes Format für interkulturellen Austausch bieten. Sie begründet die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung des Phänomens Poetry Slam, die über die rein semantische Ebene hinausgeht, und skizziert den Forschungsansatz der Arbeit, der einen Vergleich der deutschen und französischen Slam-Szenen vornimmt, um deren Eignung für interkulturelle Veranstaltungen zu bewerten.
2 Die Poetry-Slam-Szenen in Deutschland und Frankreich im Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht die Poetry-Slam-Szenen in Deutschland und Frankreich. Es untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich des Veranstaltungsformats, der literarischen Ausrichtung und der soziokulturellen Einbettung. Es werden zentrale Merkmale wie die demokratische Grundstruktur, die Auseinandersetzung mit Individualisierungsprozessen und die interaktive Natur der Veranstaltung detailliert analysiert. Der Vergleich umfasst auch eine detaillierte Auseinandersetzung mit den stilistischen und inhaltlichen Merkmalen der Slam Poetry in beiden Ländern.
3 Eignung des Slams für deutsch-französische Literaturveranstaltungen: Dieses Kapitel analysiert die Eignung von Poetry Slams für deutsch-französische Literaturveranstaltungen. Dabei werden sowohl textexterne Faktoren (z.B. die demokratische Natur des Slams, seine Interaktivität) als auch textimmanente Faktoren (z.B. thematische Schwerpunkte, stilistische Merkmale der Slam Poetry) betrachtet. Es wird untersucht, inwieweit diese Faktoren trotz der Sprachbarriere zu einem erfolgreichen interkulturellen Austausch beitragen können. Die Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Chancen von mehrsprachigen Slam-Events.
Schlüsselwörter
Poetry Slam, Interkulturelle Kommunikation, Deutsch-französischer Austausch, Literaturvergleich, Veranstaltungsformat, Slam Poetry, Oralität, Interaktivität, Sprachbarriere, Individualisierung, Demokratie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Poetry Slam - Interkulturell?"
Was ist der Gegenstand der Arbeit "Poetry Slam - Interkulturell?"?
Die Arbeit untersucht das Potenzial von Poetry Slams für den interkulturellen Austausch, insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich. Sie analysiert die Eignung des Formats für deutsch-französische Veranstaltungen und beleuchtet dabei sowohl Vorteile als auch Herausforderungen.
Welche Aspekte des Poetry Slams werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Poetry-Slam-Szenen in Deutschland und Frankreich hinsichtlich des Veranstaltungsformats, der literarischen Ausrichtung, der soziokulturellen Einbettung, der sprachlichen und stilistischen Merkmale der Slam Poetry sowie der textexternen und textimmanenten Faktoren, die den interkulturellen Austausch beeinflussen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Eignung von Poetry Slams für deutsch-französische Literaturveranstaltungen zu analysieren. Sie möchte herausfinden, ob und wie das Format trotz der Sprachbarriere einen erfolgreichen interkulturellen Austausch ermöglichen kann.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Vergleich der Poetry-Slam-Szenen in Deutschland und Frankreich; Analyse des Slams als demokratisches und interaktives Veranstaltungsformat; Untersuchung der sprachlichen und stilistischen Merkmale deutscher und französischer Slam Poetry; Bewertung der interkulturellen Relevanz von Poetry Slams; Ausblick auf Möglichkeiten der Förderung interkulturellen Austauschs durch Poetry Slams.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, Vergleich der Poetry-Slam-Szenen in Deutschland und Frankreich, Eignung des Slams für deutsch-französische Literaturveranstaltungen, Schlussfolgerungen und Ausblick, sowie ein Anhang mit grundlegenden Informationen zum Slam (Geschichte, Regeln und Formate).
Welche Faktoren beeinflussen die Eignung von Poetry Slams für interkulturellen Austausch?
Die Arbeit betrachtet sowohl textexterne Faktoren (z.B. die demokratische Natur des Slams, seine Interaktivität) als auch textimmanente Faktoren (z.B. thematische Schwerpunkte, stilistische Merkmale der Slam Poetry). Es wird untersucht, inwieweit diese Faktoren trotz der Sprachbarriere zu einem erfolgreichen interkulturellen Austausch beitragen können.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Poetry Slams, trotz der Herausforderungen durch die Sprachbarriere, ein vielversprechendes Format für den interkulturellen Austausch darstellen. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Kapitel "Schlussfolgerungen und Ausblick" detailliert dargelegt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Poetry Slam, Interkulturelle Kommunikation, Deutsch-französischer Austausch, Literaturvergleich, Veranstaltungsformat, Slam Poetry, Oralität, Interaktivität, Sprachbarriere, Individualisierung, Demokratie.
- Quote paper
- Silva Raddatz (Author), 2016, Poetry Slam als interkulturelle Kunstform zwischen Deutschland und Frankreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342942