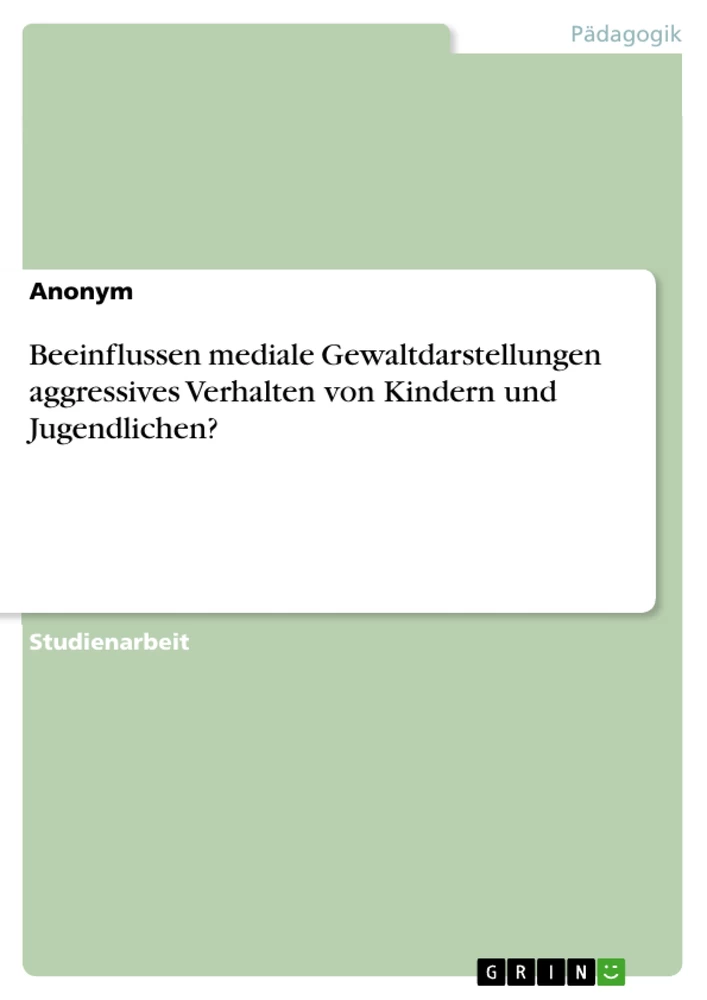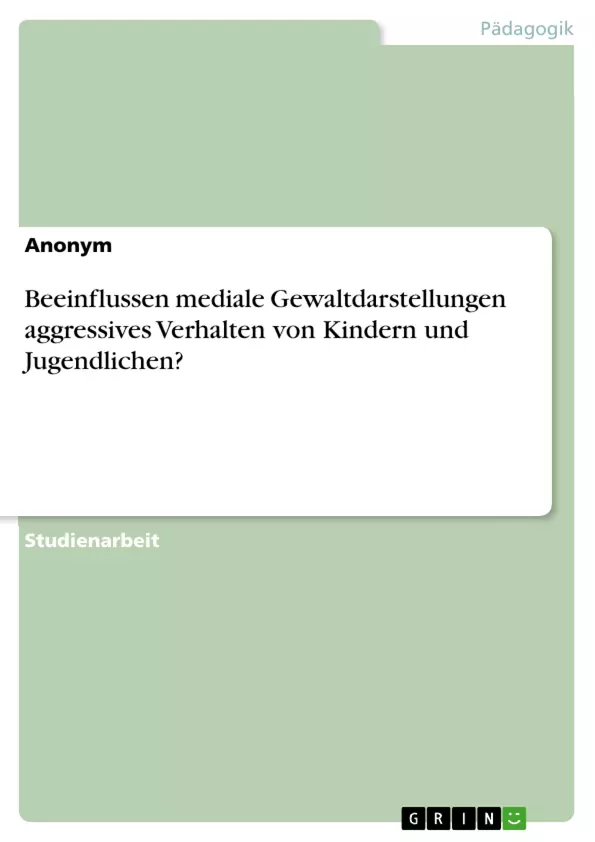Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung inwieweit mediale Gewaltdarstellungen das Verhalten von Kindern und Jugendlichen beeinflussen.
Die heutige Gesellschaft zeichnet sich immer mehr durch Medien aus. So besitzt fast jeder Haushalt mindestens einen Fernseher, Videos können sekundenschnell ohne weiteres aus dem Internet geladen werden und Computerspiele werden immer realitätsnäher. Dabei erfreuen sich insbesondere gewalthaltige Medieninhalte unter Jugendlichen großer Beliebtheit. Es stellt sich unweigerlich die Frage, welche Auswirkungen dieser Medienkonsum hat und inwieweit Mediengewalt das Verhalten von Kindern und Jugendlichen beeinflusst. Denn besonders nach Amokläufen wird die Debatte um Gewaltdarstellungen und ihre möglichen schädigenden Wirkungen regelmäßig wieder aufgegriffen.
Die Autorin beginnt zunächst mit einer Definition von Gewalt und Mediengewalt. In dem nachfolgenden Punkt zwei wird die Mediennutzung in Deutschland erläutert. Wobei auch dort der Aspekt Mediengewalt aufgegriffen wird.
Punkt drei beschäftigt sich mit den Wirkungen von Mediengewalt. Dabei wird in zwei Unterpunkten explizit auf die Wirkung von Gewalt in Computerspielen und auf die Wirkung von Gewalt im Internet eingegangen. Dieser dritte Punkt stellt den Schwerpunkt der Hausarbeit dar.
Im Anschluss daran werden sechs Thesen der Gewaltwirkungsforschung erläutert. In Punkt sechs werden mögliche Präventionsansätze zusammengefasst. Die Hausarbeit endet mit einem abschließenden Fazit und dem Literaturverzeichnis.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definitionen
- Definition Gewalt
- Mediengewalt
- Mediennutzung
- Wirkungen medialer Gewalt
- Gewalt in Computerspielen
- Gewalt im Internet
- Gewalt in Musik/ Musikvideos
- Thesen der Gewaltwirkungsforschung
- Katharsisthese
- Simulationsthese
- Erregungsthese
- Habitualisierungsthese
- Nachahmungsthese
- Kultivierungsthese
- Fazit
- Präventionsansätze
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Einfluss von medialer Gewaltdarstellung auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen. Sie untersucht die Relevanz und Bedeutung dieses Themas im Kontext der heutigen medialen Gesellschaft, in der gewalthaltige Inhalte in verschiedenen Medienformen wie Fernsehen, Computerspiele und Internet allgegenwärtig sind.
- Definition von Gewalt und Mediengewalt
- Analyse der Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen
- Untersuchung der Auswirkungen von Mediengewalt auf das Verhalten
- Darstellung verschiedener Thesen der Gewaltwirkungsforschung
- Diskussion von Präventionsansätzen zur Eindämmung negativer Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz der Untersuchung von medialer Gewaltdarstellung im Kontext der heutigen Gesellschaft dar.
Das Kapitel "Definitionen" erklärt die Begriffe "Gewalt" und "Mediengewalt" anhand verschiedener Definitionen und Perspektiven.
Das Kapitel "Mediennutzung" beleuchtet die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, wobei der Fokus auf den Aspekt der Mediengewalt liegt.
Das Kapitel "Wirkungen medialer Gewalt" analysiert die Auswirkungen von Mediengewalt, insbesondere im Bereich der Computerspiele und des Internets.
Das Kapitel "Thesen der Gewaltwirkungsforschung" stellt verschiedene Thesen zur Erklärung der Wirkung von Mediengewalt vor, wie die Katharsisthese, Simulationsthese und Nachahmungsthese.
Das Kapitel "Präventionsansätze" fasst verschiedene Ansätze zur Vermeidung negativer Auswirkungen von Mediengewalt zusammen.
Schlüsselwörter
Mediengewalt, Gewaltdarstellung, Kinder, Jugendliche, Verhalten, Computerspiele, Internet, Thesen, Gewaltwirkungsforschung, Präventionsansätze.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Beeinflussen mediale Gewaltdarstellungen aggressives Verhalten von Kindern und Jugendlichen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343060