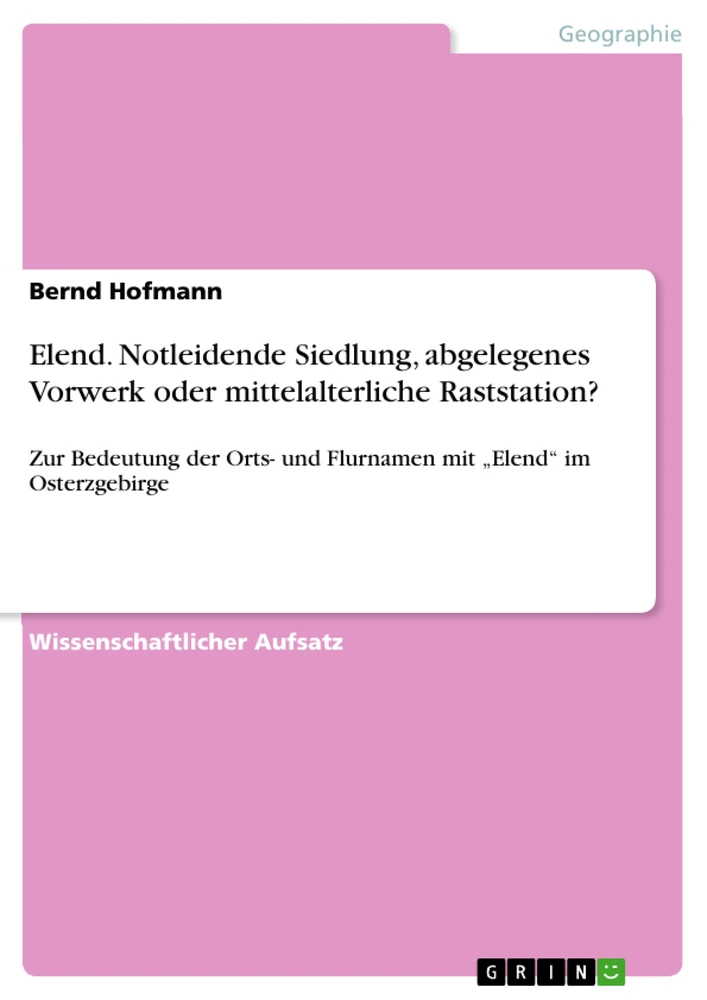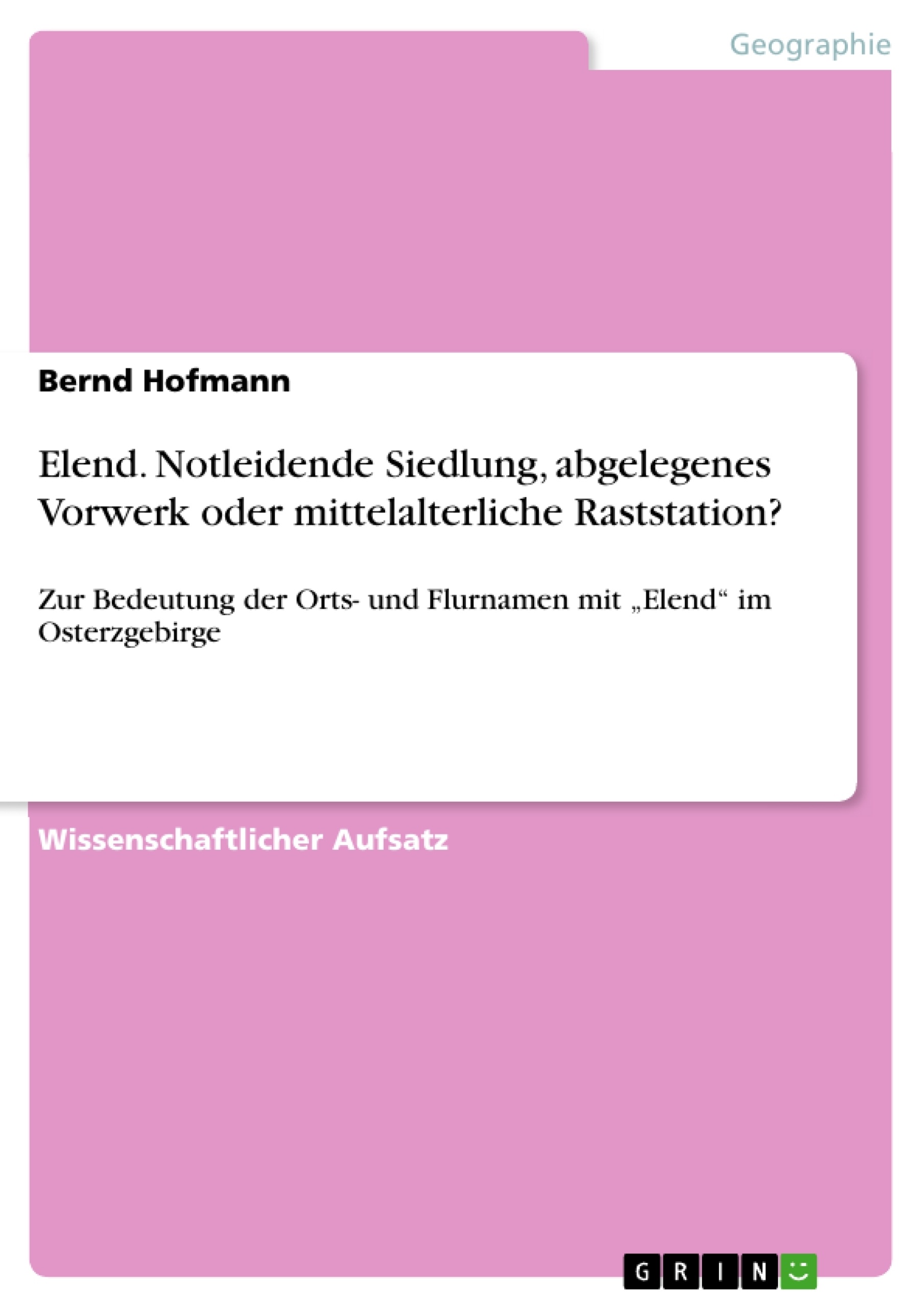Im Beitrag wird die Bedeutung der beiden Dorf- bzw. Flurnamen mit „Elend“ im Osterzgebirge analysiert. Örtlichkeiten mit dem Namen „Elend“ oder „das Elend“ sind danach nicht auf eine notleidende Siedlung oder ein Vorwerk zurückzuführen, sondern auf die althochdeutsche Wurzel eli-lenti mit der Bedeutung „abgelegenes, fremdes Land“.
Diese Bedeutung trifft am ehesten auf mittelalterliche Rastplätze im sog. Wildland, also abseits von Siedlungen oder Klöstern zu. Es wird gezeigt, dass Rastplätze im Wildland jedoch gewisse verkehrs-logistische und geomorphologische Bedingungen erfüllen müssen, die sie als solche geeignet erscheinen lassen. Dies sind insbesondere ein hinreichend ebenes, trockenes, hochwasserfreies, ausreichend großes und einigermaßen windgeschütztes Gelände als Rastplatz etwa in Form einer Quellmulde, das Vorhandensein von Frischwasser, die Lage an einer überregionalen Verkehrstrasse, eine Entfernung von 25-30km von Siedlungen oder Klöstern sowie das Vorhandensein von Weidemöglichkeiten für Reit-, Saum- und/oder Zugtiere.
Geländeuntersuchungen ergaben, dass diese Bedingungen im hohen Mittelalter sowohl vom heutigen Dippoldiswalder Ortsteil Elend als auch von einer Örtlichkeit am sog. Elendsteig zwischen Börnchen und Bärenstein erfüllt wurden. Im Korridor dieses Elendsteiges wurden zwei unterschiedliche, durch Hohlwegabschnitte gekennzeichnete mittelalterliche Verkehrstrassen nachgewiesen.
Durch Auswertung der Hohlwegprofile und an Hand der näherungsweise bestimmten Spurweiten der einstmals in den Hohlwegen verkehrenden Fahrzeuge wurde versucht, die beiden Trassen des Verkehrskorridors „Elendsteig“ funktionell und zeitlich einzuordnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Zur Bezeichnung mittelalterlicher Rastplätze in Sachsen und Böhmen
- Zur Deutung von Orts- und Flurnamen mit „Elend“
- Der heutige Ortsteil Elend von Dippoldiswalde
- Der „Elendsteig“ bei Bärenstein
- Der Elendsteig - eine Altstraße mit Rastplatz „ellende“ im Wildland?
- Das Hohlwegsystem am Müglitzhang im Bereich des Elendsteiges
- Altstraße Elendsteig - Trasse A
- Altstraße Elendsteig – Trasse B
- Der mögliche Rastplatz
- Der Flurname,,das Elend“
- Versuch einer funktionellen und zeitlichen Einordnung des Verkehrskorridors „Elendsteig“ zwischen Börnchen und Bärenstein
- Zusammenfassung
- Literatur
- Anhang: Karten 1 bis 3
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Untersuchung der Bedeutung von Orts- und Flurnamen mit „Elend“ im Osterzgebirge. Ziel ist es, herauszufinden, ob diese Bezeichnungen auf notleidende Siedlungen, abgelegene Vorwerke oder mittelalterliche Rastplätze im Wildland hindeuten.
- Bedeutung von Orts- und Flurnamen mit „Elend“ im historischen Kontext
- Untersuchung des Wortes „Elend“ in Bezug auf mittelalterliche Rastplätze
- Analyse der geomorphologischen und verkehrslogistischen Voraussetzungen für Rastplätze
- Analyse spezifischer Orte mit „Elend“ im Osterzgebirge
- Vergleich mit anderen Ortsbezeichnungen im Zusammenhang mit Rastplätzen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Arbeit beginnt mit einer Erläuterung der historischen Bedeutung von Verkehrswegen in Europa und im Besonderen im Erzgebirge, das im Mittelalter als „Wildland“ bezeichnet wurde. Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des fehlenden dichten Siedlungsnetzes im Erzgebirge Rastplätze für Reisende eine wichtige Rolle spielten.
- Zur Bezeichnung mittelalterlicher Rastplätze in Sachsen und Böhmen: Dieses Kapitel untersucht die Benennung von Rastplätzen im Mittelalter und führt Beispiele für Orts- und Flurnamen wie „Osseg“, „Újezd“ und „Zuckmantel“ an. Diese Namen deuten auf Orte hin, die für Reisende als Übernachtungsplätze dienten. Die Arbeit stellt auch fest, dass es im hochmittelalterlichen Erzgebirge vermutlich weitere Rastplätze gegeben haben muss, da die Strecken im Wildland oft nicht an einem Tag zurückgelegt werden konnten.
- Zur Deutung von Orts- und Flurnamen mit „Elend“: In diesem Kapitel wird die Hypothese aufgestellt, dass der Name „Elend“ im mittelalterlichen deutschen Sprachraum auf Rastplätze außerhalb von Ansiedlungen im Wildland hindeuten könnte. Als Beispiel wird die Route durch den Harz angeführt, die an zwei Klöstern und zwei dazwischenliegenden Herbergsplätzen vorbeiführt. Der Ortsname „Elend“ in der Mitte zwischen den Klöstern soll sich aus „eli-lenti“ entwickelt haben, was „anderes, fremdes Land“ bedeutet. Die Arbeit argumentiert, dass der Begriff „Elend“ in diesem Kontext nicht auf Notleidende Siedlungen, sondern auf abgelegene Rastplätze für Fuhrleute im Wildland hindeutet.
- Der heutige Ortsteil Elend von Dippoldiswalde: Dieses Kapitel untersucht den Ursprung des Ortsnamens „Elend“ bei Dippoldiswalde. Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass der Name nicht unbedingt auf eine notleidende Siedlung, sondern auf die Lage des Vorwerks „ellende“ abseits der Gemarkung von Dippoldiswalde zurückzuführen ist. Die Bodenverhältnisse in Elend lassen zudem auf eine wohlhabende, nicht notleidende Siedlung schließen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Begriffen „Elend“, „Rastplatz“, „Wildland“, „Verkehrsweg“, „Mittelalter“, „Osterzgebirge“, „Flurnamen“, „Ortsnamen“ und „Toponym“ im Kontext des hochmittelalterlichen Erzgebirges. Sie untersucht die Bedeutung dieser Begriffe im Zusammenhang mit der historischen Entwicklung von Verkehrswegen und der Nutzung von Rastplätzen für Reisende. Darüber hinaus wird die Rolle der geomorphologischen und verkehrslogistischen Faktoren bei der Auswahl von Rastplätzen im Fokus stehen.
Häufig gestellte Fragen
Bedeutet der Ortsname „Elend“ immer eine notleidende Siedlung?
Nein, die Untersuchung zeigt, dass viele dieser Namen auf die althochdeutsche Wurzel „eli-lenti“ zurückgehen, was lediglich „abgelegenes, fremdes Land“ bedeutet.
Was waren mittelalterliche Rastplätze im „Wildland“?
Es handelte sich um strategische Haltepunkte abseits von Siedlungen, die Reisenden Schutz und Versorgung boten, wenn Strecken nicht an einem Tag bewältigt werden konnten.
Welche Bedingungen musste ein Standort für einen Rastplatz erfüllen?
Ein geeigneter Platz musste eben, trocken und hochwasserfrei sein, Zugang zu Frischwasser bieten, an einer Verkehrstrasse liegen und Weidemöglichkeiten für Tiere haben.
Was ist der „Elendsteig“?
Der Elendsteig ist ein historischer Verkehrskorridor im Osterzgebirge zwischen Börnchen und Bärenstein, an dem mittelalterliche Hohlwege und potenzielle Rastplätze nachgewiesen wurden.
Wie lässt sich das Alter der Verkehrstrassen bestimmen?
Durch die Analyse von Hohlwegprofilen und die Messung der historischen Spurweiten von Fahrzeugen kann eine zeitliche und funktionelle Einordnung der Wege erfolgen.
- Citar trabajo
- Dr. Bernd Hofmann (Autor), 2016, Elend. Notleidende Siedlung, abgelegenes Vorwerk oder mittelalterliche Raststation?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343377