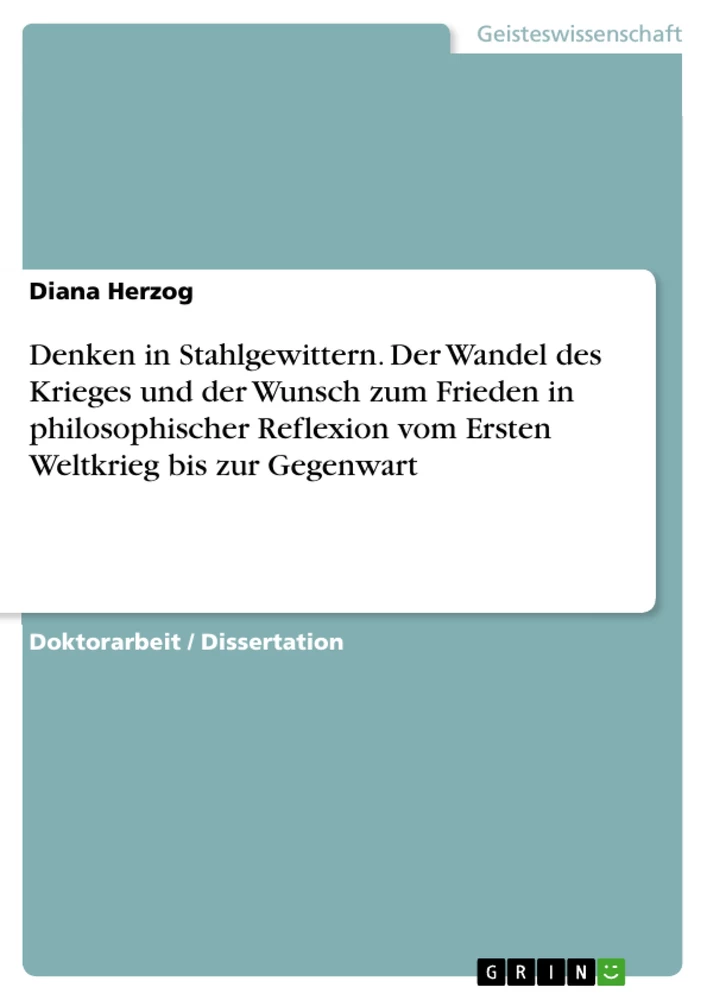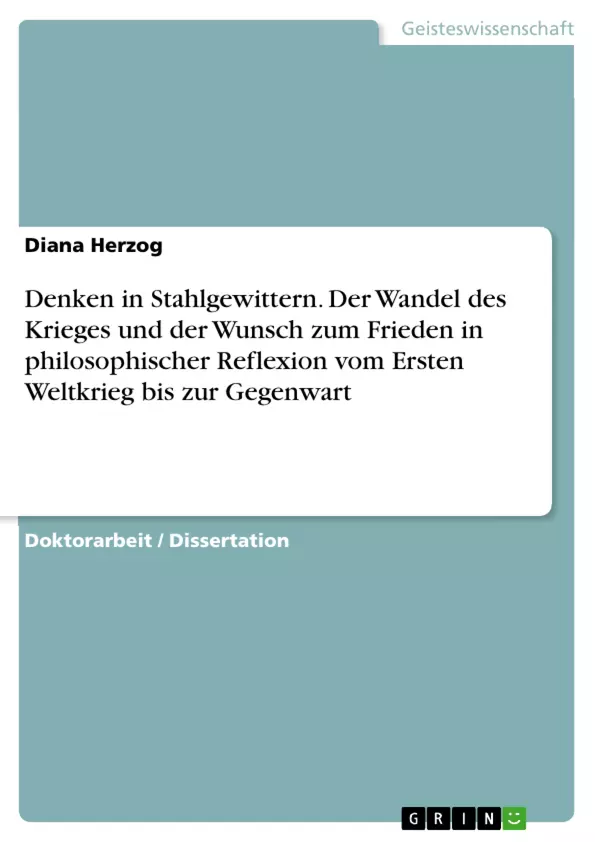Der zyklische Wandel des Kriegsbegriffs lässt sich durch die Betrachtung seiner Ausgestaltungsformen seit der Antike bis zur Gegenwart erkennen. Seine Begrifflichkeit entwickelt sich vom antiken bellum iustum zur Reinkarnation des „heiligen“ Krieges im modernen Terrorismus und den Formen seiner Bekämpfung. Hierbei durchläuft der Kriegsbegriff verschiedene Stadien der Hegung beziehungsweise Entgrenzung, wozu der Wechsel zwischen der nichtdiskriminierenden und der diskriminierenden Feindesbetrachtung zählt. Grundlegend für die Diagnose seines zyklischen Wandels sind dabei die jeweils gültigen Gesetzte und Rechte, also die Ausprägung des ius ad bellum als auch des ius in bello. Darüber hinaus wird seine Veränderung durch das sich ebenfalls verändernde Bild des Kämpfers illustriert. Hierbei gibt es eine Gegensatzaufweichung zwischen dem als vollständig regulär und damit auch legal bewerteten Soldaten und seinem Antonym des Terroristen. Diese Erweichung erfolgt durch die Existenz chamäleonhafter Kämpfertypen wie des Partisan, aber auch durch die sich verändernde Umstände (Niedergang der Staatlichkeit, Demokratisierung der Technik, Wandel der Ausgestaltung und Intensität des Krieges). Das Bild des Kämpfers zusammen mit der Intensität des Krieges und der Ausgestaltung des Völkerrechtes bilden dann auch den Bewertungsstand des Individualismus ab, der wie die Stabilität der souveränen Staatlichkeit, als immer noch als gültig gesetztes Ordnungskonstrukt der internationalen Sphäre, den Kriegsbegriff und damit das Vorgehen in der zwischenstaatlichen Ebene ausgestalten soll.
Carl Schmitt - Ernst Jünger - Herfried Münkler - Thomas Hobbes - Grotius - Embser - Kant - Clausewitz - Landsturm Edikt - Bürgerkrieg - Neue Kriege - Zweiter Weltkrieg - Erster Weltkrieg - Terrorismus - diskriminierender Kriegsbegriff - bellum iustum - gerechter Krieg - Heiliger Krieg
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- Kriegsphilosophische Ausgangslage
- Bellum iustum
- Grotius,,De jure belli ac pacis“
- Westfälischer Frieden
- Hobbes Staatskonzeption und sein Menschenbild
- Embsers,,Abgötterei des ewigen Friedens“
- Kant,,Zum ewigen Frieden“
- Clausewitz Kriegskonzeption
- Landsturm-Edikt von 1813 (Deutsche Befreiungskriege)
- Genfer Konvention
- Haager Landkriegsordnung
- II Weltkrieg
- Der Ersten Weltkrieg als Beginn der großen Katastrophe
- Deutsche Reden zum Krieg
- Bewertung der kriegsaffirmativen Reden
- Kulturgeschichtliche Basis für die intellektuelle „Beredsamkeit“
- Gemeinsame historische Denkfiguren der kriegsaffirmativen Werke als Verständnissschlüssel
- Die „neue Lyrik“ als Gegenentwurf zu deutschen kriegsaffirmativen Reden
- Das Erlebnis des Krieges und die Abkehr vom Individualismus
- Das Erlebnis des Krieges als heroische Daseinserweiterung bei Ernst Jünger
- Das Heroische im Wandel
- Das Ende des Krieges und seine Konsequenzen
- Kulturelle Folgen
- Völkerrechtliche Konsequenzen
- Der Wandel des Kriegsbegriffs
- Fazit
- III Bürgerkrieg
- Der Zeitraum zwischen den Weltkriegen als Zeit des Bürgerkrieges
- Die Feinde der Weimarer Republik
- Bedrohung der Republik durch die Konservative Revolution
- Das Primat des Etatismus gegen die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff bei Carl Schmitt
- Die organische Konstruktion eines neuen Menschentypus bei Ernst Jünger
- Die linken Gegner der Republik und die fortwährende Revolution gegen den ,,Imperialismus“
- Die Rolle des Staates und der Niedergang der Kriegshegung
- Fazit
- IV Weltbürgerkrieg
- Der Totalitarismus als Weg zum Zweiten Weltkrieg und die Entstehung des Weltbürgerkrieges
- Der Totalitarismus als Bedrohung der Menschheit
- Hitlers Krieg als Naturgesetz
- Carl Schmitts konkretes Ordnungsdenken
- Die innere Emigration Ernst Jüngers
- Der aufkommende Weltbürgerkrieg des Kommunismus
- Die Ideologie als Katalysator der Veränderung
- Fazit
- V Neue Kriege als Fortsetzung der Religion mit anderen Mitteln
- Die Abkehr vom klassischen Kriegsbegriff durch die neuen Kriege
- Der veränderte Kriegsbegriff
- Carl Schmitts Partisan als Grundlage des sich verändernden Kriegsbegriffs
- Ernst Jüngers Theorie des Widerstands
- Das philosophische Problem des Terrorismus
- Exkurs zu den neusten Konzepten des internationalen Terrorismus
- Fazit
- VI Resümee der Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation befasst sich mit dem Wandel des Kriegsbegriffs und dem Wunsch nach Frieden in philosophischer Reflexion vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart. Sie analysiert die Auswirkungen des Krieges auf die Ideenkonstruktionen von Intellektuellen und untersucht, wie der Krieg als kulturzerstörende Gräueltat und zugleich als schöpferische Kraft verstanden wurde.
- Der Wandel des Kriegsbegriffs vom klassischen Krieg zum Bürgerkrieg und Weltbürgerkrieg
- Die Rolle der Naturmetaphern in der Beschreibung des Krieges, insbesondere die Metapher des Gewitters
- Die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges auf die Kultur und Zivilisation
- Die Kritik an den Rechtfertigungsversuchen des Krieges durch Intellektuelle
- Die Rolle von Staat, Ideologie und Terrorismus im Kontext des Krieges
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt den Krieg als ein zentrales Thema der Menschheitsgeschichte vor und beleuchtet die ambivalenten Auswirkungen des Krieges auf die Kultur und das Denken. Die Metapher des Gewitters als Ausdruck der zerstörerischen und zugleich reinigenden Kraft des Krieges wird vorgestellt.
Weltkrieg: Dieses Kapitel analysiert den Ersten Weltkrieg als Beginn der großen Katastrophe und untersucht die kriegsaffirmativen Reden der Zeit. Es beleuchtet die kulturgeschichtliche Basis für die „Beredsamkeit“ und die gemeinsamen Denkfiguren der kriegsaffirmativen Werke. Die „neue Lyrik“ als Gegenentwurf zu den kriegsaffirmativen Reden wird ebenfalls untersucht.
Bürgerkrieg: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Zeit zwischen den Weltkriegen, die als Zeit des Bürgerkrieges betrachtet wird. Die Feinde der Weimarer Republik, insbesondere die Konservative Revolution, werden analysiert. Die Rolle von Carl Schmitt und Ernst Jünger im Kontext des Bürgerkrieges wird untersucht.
Weltbürgerkrieg: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Totalitarismus als Weg zum Zweiten Weltkrieg und der Entstehung des Weltbürgerkrieges. Die Bedrohung der Menschheit durch den Totalitarismus und die Rolle von Hitler, Carl Schmitt und Ernst Jünger im Kontext des Weltbürgerkrieges werden beleuchtet.
Neue Kriege als Fortsetzung der Religion mit anderen Mitteln: Dieses Kapitel analysiert die Abkehr vom klassischen Kriegsbegriff durch die neuen Kriege und untersucht den veränderten Kriegsbegriff. Die Rolle von Carl Schmitt und Ernst Jünger im Kontext des Terrorismus wird beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Dissertation befasst sich mit zentralen Begriffen wie Krieg, Frieden, Kultur, Zivilisation, Naturmetapher, Gewitter, Totalitarismus, Bürgerkrieg, Weltbürgerkrieg, Terrorismus, Ideologie, Staat, Intellektuelle, „Beredsamkeit“, „neue Lyrik“, Carl Schmitt, Ernst Jünger, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Weimarer Republik.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich der Kriegsbegriff vom Ersten Weltkrieg bis heute gewandelt?
Der Begriff entwickelte sich vom klassischen zwischenstaatlichen Krieg über den Bürgerkrieg und Weltbürgerkrieg bis hin zu den "Neuen Kriegen" und dem modernen Terrorismus.
Welche Bedeutung hat die Metapher der "Stahlgewitter"?
In Anlehnung an Ernst Jünger beschreibt sie den Krieg als ein elementares Naturereignis, das sowohl zerstörerisch als auch als heroische Daseinserweiterung wahrgenommen wurde.
Welche Rolle spielen Carl Schmitt und Ernst Jünger in dieser Analyse?
Beide Denker werden als Schlüsselfiguren analysiert, um die intellektuelle Auseinandersetzung mit Krieg, Staatlichkeit, dem Partisanen-Konzept und dem Niedergang klassischer Ordnungsmuster zu verstehen.
Was unterscheidet den "gerechten Krieg" vom modernen Terrorismus?
Die Arbeit untersucht den Wechsel zwischen nichtdiskriminierender und diskriminierender Feindbetrachtung sowie die Aufweichung der Grenzen zwischen regulären Soldaten und illegalen Kämpfern.
Wie wird der Wunsch nach Frieden philosophisch reflektiert?
Die Dissertation kontrastiert kriegsaffirmative Reden mit Entwürfen zum "ewigen Frieden" (z. B. Kant) und analysiert die kulturellen und völkerrechtlichen Konsequenzen der großen Weltkatastrophen.
- Citation du texte
- Dr. Diana Herzog (Auteur), 2016, Denken in Stahlgewittern. Der Wandel des Krieges und der Wunsch zum Frieden in philosophischer Reflexion vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/343472