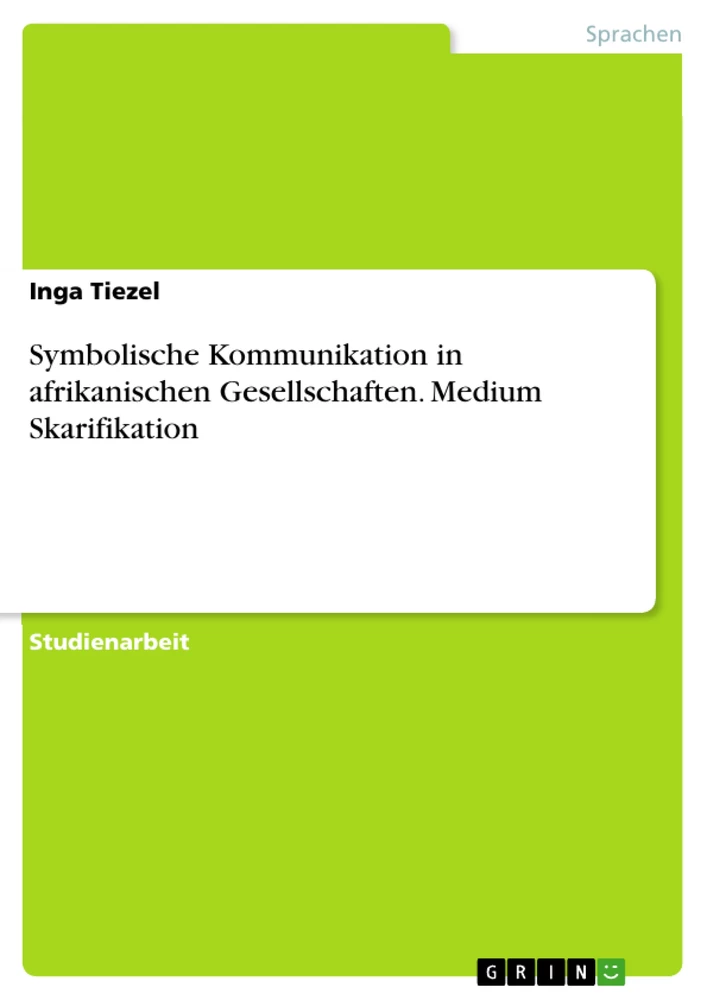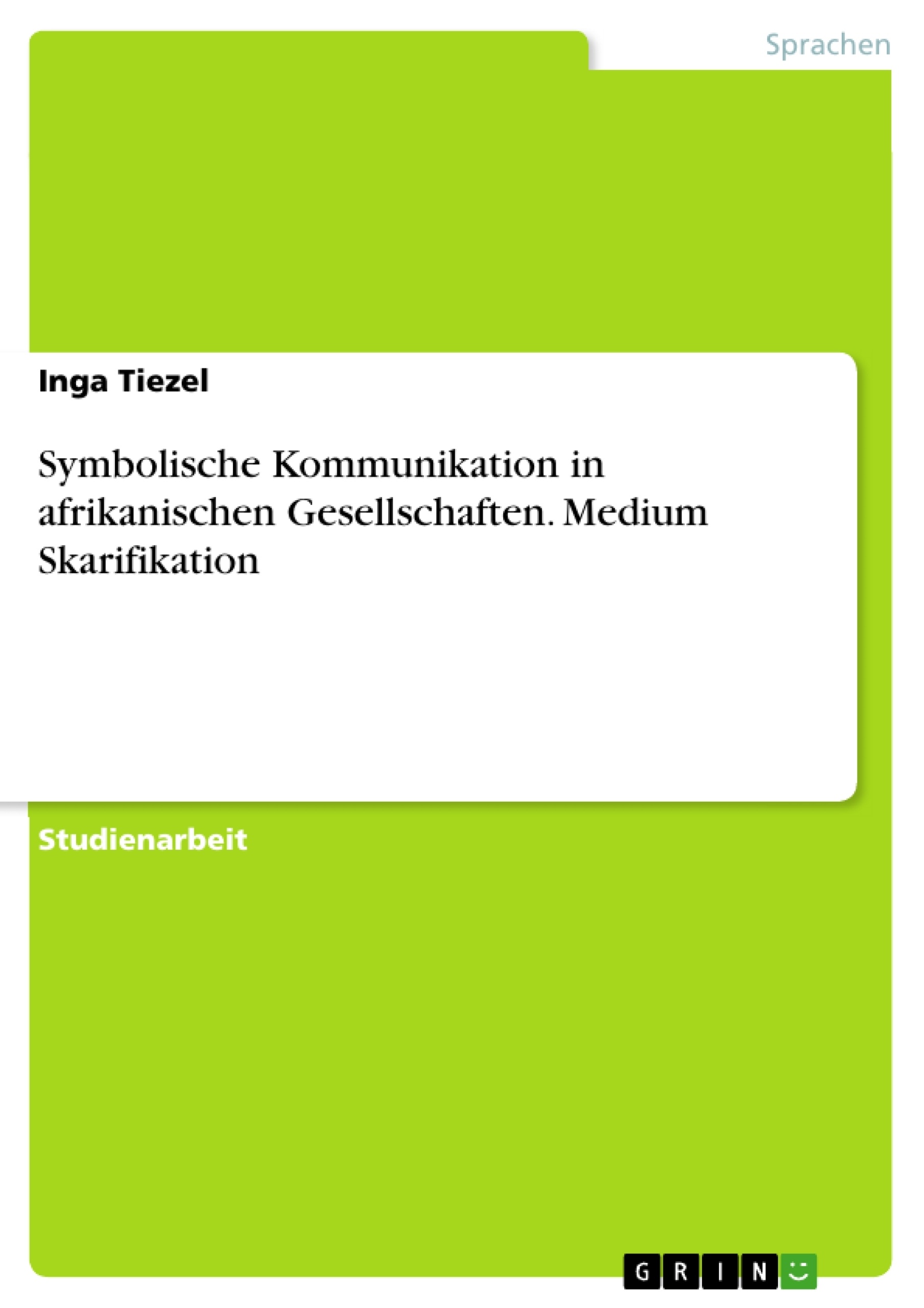Afrika ist ein Land mit vielen Sprachen. Wobei das Wort Sprache sowohl die „Fähigkeit des Menschen zu sprechen; das Sprechen als Anlage, als Möglichkeit des Menschen sich auszudrücken“ beschreibt, als auch die symbolische Kommunikation mittels eines „(historisch entstandenen und sich entwickelnden) System[s, I.T.] von Zeichen und Regeln, das einer Sprachgemeinschaft als Verständigungsmittel dient“. Nahezu allen Sprachen gemein ist ein, sich nach Kultur und Sprachraum richtendes, spezifisches System von Zeichen, seien es Symbole oder Buchstaben, „mit denen Laute, Wörter, Sätze einer Sprache sichtbar festgehalten werden“ können. Die also zur Verschriftlichung dienen und somit die nonverbale Weitergabe von Wissen ermöglichen.
So zum Beispiel durch die Skarifikation der Haut, also das Aufbringen von Schmucknarben auf die obere Hautschicht, welche einen Menschen sein ganzes Leben lang begleiten und Auskunft geben, sowohl über ihn, seine Umgebung als auch über seine Vergangenheit. Um diese Verschriftlichung mittels geometrischer oder tierischer Symbole lesen, oder besser, entschlüsseln zu können, bedarf es besonderer Kenntnisse, da „many have been developed by and for […] specialized groups or individuals.“ Innerhalb einiger afrikanischer Kulturen wird dieses Wissen von Generation zu Generation weiter gegeben und trägt somit zur Erhaltung der jeweilig spezifischen Schriftkultur und Identität bei. Doch auch eine fest in den Gesellschaften verankerte symbolische Sprache unterliegt dem Wandel der Zeit und der Veränderung.
Nicht nur Die Schrift an sich verändert sich, wird neu erfunden oder gar ersetzt sondern auch die Bedeutungen verschieben sich. Auch der Wandel von Schönheitsidealen und Wertvorstellungen tragen dazu bei, dass alte Formen der Kommunikation und Identitätsbildung immer weiter in den Hintergrund gedrängt oder gar verboten werden. Doch ihre Methodik wird durch die länderübergreifende Migration und zunehmende Technisierung weitergetragen und teilweise von einer anderen Kultur übernommen oder eingegliedert. So erhielt auch die Technik Skarifizierungen anzufertigen Einzug in die westliche Welt und findet heute ihren Ausdruck in der jüngeren Generation. Sie gilt als eine der extremeren Formen der Körperbemalung oder Körperveränderung.
Eine Verschmelzung von Tradition und Moderne ist dort unabdingbar, wo neue Wertvorstellungen und Schönheitsideale beginnen eine Gesellschaft zu verändern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Körper als Medium
- Skarifikation – Schmucknarben als Schriftsystem und Träger von Information
- Resümee
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Körper als Medium der Kommunikation, insbesondere im Kontext der Skarifikation. Sie untersucht die Technik der Skarifikation als eine Form der nonverbalen Kommunikation in afrikanischen Gesellschaften und betrachtet deren kulturelle Weiterentwicklung und Veränderung im Laufe der Zeit. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Skarifikation als Träger von Informationen und Identität und zeigt auf, wie diese Methode der Körperveränderung in den Wandel von Schönheitsidealen und Wertvorstellungen eingebunden ist.
- Der Körper als Medium der Kommunikation
- Skarifikation als Form der nonverbalen Kommunikation
- Kulturelle Bedeutung und symbolische Sprache der Skarifikation
- Veränderung der Skarifikation im Kontext von Modernisierung und globalen Einflüssen
- Die Rolle der Skarifikation in der heutigen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der nonverbalen Kommunikation in Afrika ein und stellt die Skarifikation als ein wichtiges Medium der Kommunikation und Identitätsbildung vor. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Skarifikation als Schriftsystem, das durch geometrische oder tierische Symbole Informationen über den Einzelnen, seine Umgebung und seine Vergangenheit vermittelt.
Der Körper als Medium
Dieses Kapitel betrachtet den Körper als Medium der Kommunikation und beleuchtet die verschiedenen Formen der Körperveränderung in indigenen Kulturen. Die Skarifikation wird als eine Form der Körpermodifikation vorgestellt, die seit dem Paläolithikum in vielen Teilen der Welt praktiziert wird. Die Arbeit analysiert die Bedeutung des Körpers als Träger von kulturellen Bedeutungen und als Ort der Inschrift von Identität.
Skarifikation – Schmucknarben als Schriftsystem und Träger von Information
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Skarifikation als Schriftsystem und Träger von Informationen. Er untersucht die verschiedenen Formen der Skarifikation in verschiedenen afrikanischen Kulturen und analysiert die Bedeutung der verwendeten Symbole. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Skarifikation in der Weitergabe von Wissen und Traditionen und zeigt auf, wie diese Methode der Körperveränderung zur Erhaltung der kulturellen Identität beiträgt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Körper, Kommunikation, Skarifikation, Symbolismus, Kultur, Identität, Tradition, Modernisierung, Globalisierung und Schönheitsideale. Die Arbeit analysiert die Bedeutung der Skarifikation als Form der nonverbalen Kommunikation und untersucht ihre Rolle in der kulturellen Weiterentwicklung und Veränderung in verschiedenen afrikanischen Gesellschaften.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Skarifikation?
Skarifikation bezeichnet das absichtliche Einbringen von Schmucknarben in die obere Hautschicht, meist durch Schnitte, um dauerhafte Muster oder Symbole zu erzeugen.
Welche Bedeutung hat Skarifikation in afrikanischen Gesellschaften?
Sie dient als nonverbales Kommunikationssystem und "Schrift", die Auskunft über die soziale Identität, Herkunft, den Status oder die Stammeszugehörigkeit einer Person gibt.
Inwiefern fungiert der Körper als Medium?
Der Körper wird zum Träger von Informationen und kulturellen Bedeutungen. Die Narben sind eine Form der Verschriftlichung von Wissen, die den Menschen lebenslang begleitet.
Warum nimmt die Praxis der Skarifikation in Afrika ab?
Wandelnde Schönheitsideale, Modernisierung, globale Einflüsse und teilweise staatliche Verbote führen dazu, dass diese traditionellen Identitätsmerkmale seltener werden.
Wie wird Skarifikation in der westlichen Welt wahrgenommen?
In der westlichen Welt hat Skarifikation Einzug als extreme Form der Körpermodifikation und individuellen Ästhetik in Jugendkulturen gefunden, oft losgelöst von der ursprünglichen traditionellen Bedeutung.
Welche Symbole werden bei der Skarifikation verwendet?
Es werden häufig geometrische Muster oder tierische Symbole verwendet, deren Entschlüsselung oft spezielles Wissen innerhalb einer Gemeinschaft erfordert.
- Citar trabajo
- Inga Tiezel (Autor), 2012, Symbolische Kommunikation in afrikanischen Gesellschaften. Medium Skarifikation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344410