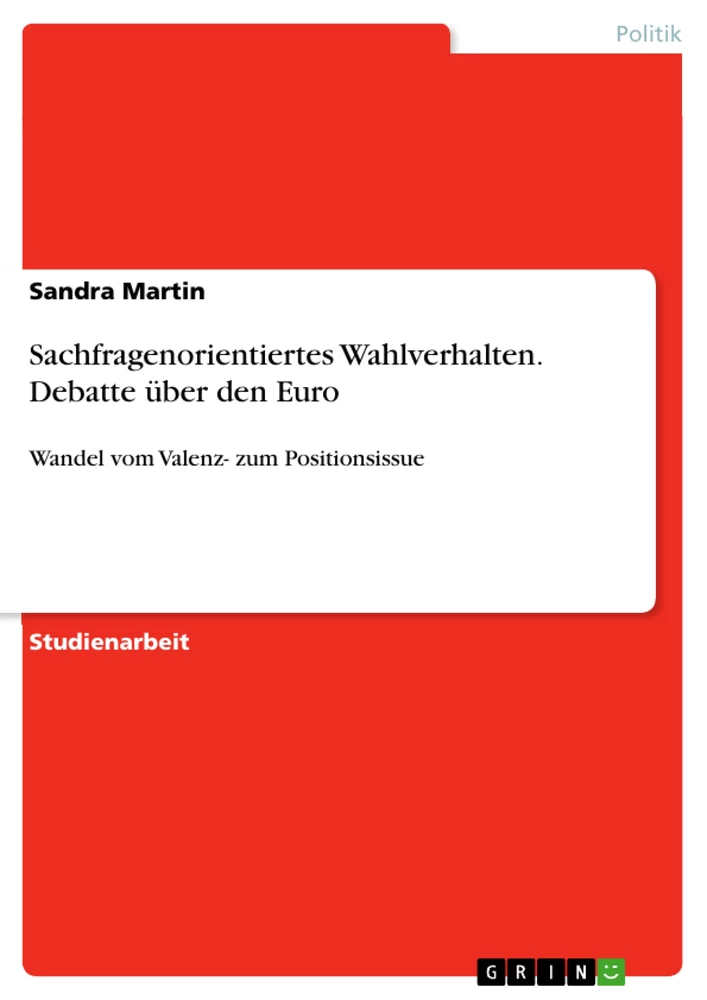Mit der Einführung der gemeinsamen Währung war die Europäische Integration einen richtungsweisenden und greifbaren Schritt vorangegangen. Die Geburtsstunde der Gemeinschaftswährung wurde als historischer Moment gefeiert; der Euro galt als Symbol für ein friedliches und vereintes Europa. Inzwischen ist die Euphorie verschwunden. 11 Jahre nach seiner Implementierung steckt der Euro in einer tiefen Misere. Mit zunehmender Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung in den südlichen und östlichen Ländern auf der einen Seite und einem wirtschaftlich prosperierenden Norden auf der anderen, wird die Einigkeit Europas auf eine Zerreißprobe gestellt. Die Krise der Gemeinschaftswährung die droht die Union zu spalten. Der Zweifel und die ablehnende Haltung gegenüber dem Euro kanalisieren sich in Deutschland in der neuen Partei „Alternative für Deutschland“. Diese wirbt mit der Abschaffung des Euros um die Gunst der Wähler bei der nächsten Bundestagswahl.
Einstellungen zu politischen Sachfragen können die Stimmabgabe der Wähler zugunsten einer Partei beeinflussen. Die Autoren des sozialpsychologischen Ansatzes zur Erklärung von Wahlverhalten sehen in Sachfragenorientierungen einen der drei Bestimmungsfaktoren für Wahlverhalten. Im Folgenden wird zunächst der sozialpsychologische Ansatz der Michigan Schule vorgestellt, wobei besonders auf die Konzeption von politischen Sachfragen eingegangen wird. Anschließend wird gezeigt, wie sich der Euro von einer allgemein akzeptierten Währung (Valenzissue) zu einer umstrittenen policy (Positionsissue) gewandelt hat.
Welche Personen stehen dem Euro positiv gegenüber, welche lehnen ihn ab? Die seit der Eurokrise entstandene negative Einstellung gegenüber der Gemeinschaftswährung lässt sich mithilfe der Theorie der relativen Deprivation erklären. Anhand von Deprivation, unter der man einen Zustand der Entbehrung versteht, kann die Wahl von populistischen Parteien erklärt werden. Dieses Konzept werde ich im Folgenden vorstellen. Anschließend soll untersucht werden, bei welchen Personen durch die Europäisierung ein Gefühl der relativen Deprivation hervorgerufen wird, welches sich in einer negativen Einstellung gegenüber dem Euro äußert und damit eine Wahlentscheidung zugunsten der Alternative für Deutschland wahrscheinlich macht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sachfragen als Determinanten von Wahlverhalten
- Valenzissues
- Positionsissues
- Die Debatte über den Euro - der Wandel vom Valenz- zum Positionsissue
- Theorie der relativen Deprivation zur Erklärung der Wahl populistischer Parteien
- Hypothesengenerierung
- Zusammenfassung und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Sachfragen auf das Wahlverhalten, insbesondere im Kontext der Eurokrise und der Entstehung der Partei Alternative für Deutschland. Die Arbeit beleuchtet den Wandel des Euros von einem Valenzissue zu einem Positionsissue und analysiert, wie die Theorie der relativen Deprivation die Wahl populistischer Parteien erklären kann.
- Der Einfluss von Sachfragen auf Wahlentscheidungen
- Der Wandel des Euros von einem Valenzissue zu einem Positionsissue
- Die Rolle der relativen Deprivation bei der Wahl populistischer Parteien
- Die Entstehung der Partei Alternative für Deutschland im Kontext der Eurokrise
- Die Bedeutung von issue-familiarity, intensity of issue opinion und Wahrnehmung der issue position of parties
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit dar und führt in die Thematik des sachfragenorientierten Wahlverhaltens im Zusammenhang mit der Eurokrise ein. Kapitel 2 erläutert den sozialpsychologischen Ansatz der Michigan Schule und definiert Sachfragen als Determinanten von Wahlverhalten. Es wird zwischen Valenz- und Positionsissues unterschieden und gezeigt, wie diese unterschiedlichen Arten von Sachfragen die Wahlentscheidung beeinflussen können.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Wandel des Euros von einem Valenzissue zu einem Positionsissue. Es analysiert die Entwicklung der öffentlichen Meinung zum Euro und die Entstehung von kontroversen Standpunkten innerhalb der Gesellschaft. Kapitel 4 stellt die Theorie der relativen Deprivation vor und zeigt, wie diese Theorie die Wahl populistischer Parteien erklären kann.
Schlüsselwörter
Sachfragenorientierung, Wahlverhalten, Valenzissues, Positionsissues, Eurokrise, relative Deprivation, populistische Parteien, Alternative für Deutschland, issue-familiarity, intensity of issue opinion, Wahrnehmung der issue position of parties.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Sachfragen das Wahlverhalten?
Nach dem sozialpsychologischen Ansatz der Michigan Schule sind Sachfragenorientierungen neben Parteiidentifikation und Kandidatenorientierung zentrale Bestimmungsfaktoren für die Stimmabgabe.
Was ist der Unterschied zwischen Valenz- und Positionsissues?
Valenzissues sind allgemein akzeptierte Ziele (z.B. stabiler Euro), während Positionsissues Themen sind, bei denen Wähler und Parteien unterschiedliche Standpunkte einnehmen.
Wie wandelte sich die Debatte über den Euro?
Der Euro entwickelte sich von einem allgemein akzeptierten Symbol (Valenzissue) zu einer hochumstrittenen politischen Sachfrage (Positionsissue), insbesondere seit der Eurokrise.
Was erklärt die Theorie der relativen Deprivation?
Sie erklärt die Wahl populistischer Parteien wie der AfD durch das Gefühl der Entbehrung oder Benachteiligung, das durch Prozesse wie die Europäisierung hervorgerufen wird.
Welche Rolle spielt die AfD in diesem Kontext?
Die AfD kanalisiert die ablehnende Haltung gegenüber dem Euro und wirbt um Wähler, die eine negative Einstellung zur Gemeinschaftswährung entwickelt haben.
- Citation du texte
- Sandra Martin (Auteur), 2013, Sachfragenorientiertes Wahlverhalten. Debatte über den Euro, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344508