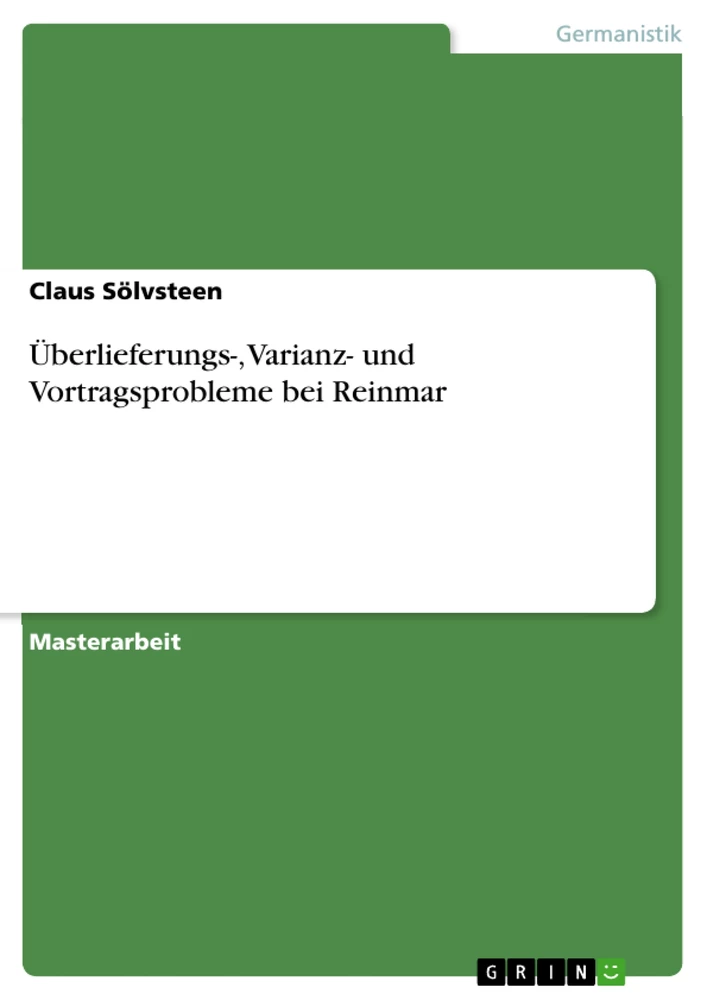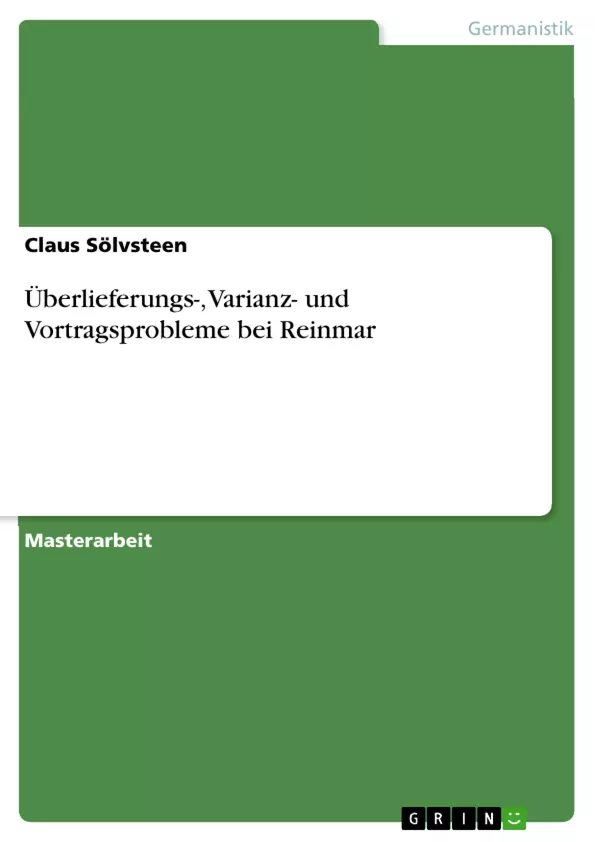Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Lyrik aus dem deutschen Mittelalter, genauer gesagt mit dem Minnesang um 1200. Minnesang ist als ein Experimentieren mit der deutschen literarischen Sprache und mit ‚höfischen‘ Liebesauffassungen und höfischem Benehmen aufzufassen.
Die Minnesangtexte, die uns heute zugänglich sind, sind alle handschriftlich überliefert. Leider sind keine Handschriften aus der Liederproduktionszeit um 1200 bewahrt, und alle überlieferten Handschriften sind mindestens 100-150 Jahre jünger als die ursprünglichen Lieder. Das bedeutet, dass die Schreiber, die die Lieder niedergeschrieben haben, den Dichtern nicht begegnet sind, und dass die uns überlieferten Texte keine Originaltexte sind. Texte, die in mehreren Handschriften überliefert sind, weisen deswegen kleinere oder größere Abweichungen auf. Manchmal sind die Abweichungen sogar so groß, dass man sich überlegen muss, ob die Handschriften dieselbe Fassung eines Liedes wiedergeben oder ob es ursprünglich mehrere Fassungen von einem Lied gab (d.h. ob der Dichter mehrere Variationen über ein Lied geschrieben hat).
Die Minnesangtexte sind von einer Reihe von Äußerungen/Aussagen bestimmter Personen aufgebaut. In den meisten Fällen ist die sprechende Person ein Mann,aber es gibt auch Strophen oder Aussagen (ja sogar ganze Lieder), wo man sich Frauenaussagen vorstellen muss. Es wird aber im Text normalerweise nicht markiert, wer spricht, und als Leser muss man manchmal raten, um die Sprecherstimme zu identifizieren. In den meisten Strophen gibt es Wörter oder Wendungen, die auf eine Sprecherstimme hinweisen können, aber es gibt auch eine Reihe von unmarkierten Strophen, in denen sich der Liedsinn radikal ändern würde, wenn man eine Frauenstrophe statt einer Männerstrophe annimmt.
Anhand von Reinmars Oeuvre werde ich die oben erwähnten Problemstellungen diskutieren. Der Minnesang um 1200 wird normalerweise als Lieder der ‚hohen Minne‘ bezeichnet, und Reinmar gehört zu einem der bekanntesten Vertreter dieser Stilrichtung. Desweiteren ist sein Werk so breit überliefert, dass die oben besprochenen Überlieferungsprobleme bei ihm deutlich werden. Deswegen wurden Reinmar und zwei seiner Lieder für diese Arbeit ausgewählt. Man muss sich vorstellen, dass Reinmars Lieder, wenn sie vorgetragen wurden, durch die Performanzsituation gelebt haben, und dass der ‚performative Selbstwiderspruch‘, wo sich das Gesagte und das Gezeigte widersprachen, für das Publikum offensichtlich und unterhaltsam war.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- EINLEITUNG
- DER FORSCHUNGSSTAND ZU ÜBERLIEFERUNGS- UND VARIANZPROBLEMEN
- GENERELL ZUR ÜBERLIEFERUNG DES MINNESANGS
- ZUR REKONSTRUKTION EINES ÜBERLIEFERUNGSSTAMMBAUMS
- VARIANZ IN DER ÜBERLIEFERUNG
- EDITIONSPRINZIPIEN
- Albrecht Hausmanns Editionsprinzip: ,historischer Relevanz' und ,Rezeptionsästhetik'
- ZUSAMMENFASSEND ZU DEN TEXTÜBERLIEFERUNGS- UND VARIANZDISKUSSIONEN
- PERFORMANZ, KOMMUNIKATION UND FIKTIONALITÄT
- PERFORMANZ
- EINE INTENDIERTE WIRKUNG DES MINNESANGS?
- MINNESANG ALS KOMMUNIKATIONSort: Performativität, Rhetorik, ROLLENLYRIK UND Fiktionalität
- ZUSAMMENFASSEND ZU DEN PERFORMANZ-, KOMMUNIKATIONS- UND FiktionalitätsDISKUSSIONEN
- TEXTANALYSEN
- ANALYSE VON REINMAR VI (SÔ EZ IENER NÂHET DEME TAGE, MF 154,32)
- Texte und Übersetzungen
- Überlieferung
- Form
- Erläuterungen zu den verschiedenen Fassungen mit Ausgangspunkt in der C-Fassung
- Gedankenverlauf in den vier Fassungen
- Beurteilung der Strophenkombinationen in den vier Fassungen und dem hypothetischen Wechsel
- Zusammenfassende Konklusion für alle Fassungen
- ANALYSE VON REINmar XII (Ein wîseR MAN SOL NIHT ZE VIL, MF 162,7)
- Texte und Übersetzungen
- Überlieferung
- Form
- Erläuterungen zu den verschiedenen Fassungen mit Ausgangspunkt in der E-Fassung
- Gedankenverlauf in den fünf Fassungen
- Zusammenfassende Konklusion für alle Fassungen
- GESAMTKONKLUSION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Lyrik des deutschen Mittelalters, insbesondere den Minnesang um 1200, mit Fokus auf die Überlieferungsprobleme und Varianz in den Texten. Das Ziel der Arbeit ist, die Überlieferungsgeschichte der Lieder zu analysieren und zu rekonstruieren, um ein besseres Verständnis der ursprünglichen Bedeutung und Intention des Minnesangs zu gewinnen. Die Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen der Überlieferung durch unterschiedliche Schreiberschichten und die damit einhergehende Variabilität, untersucht die Performativität und Kommunikation des Minnesangs sowie die Rolle der Fiktionalität und des Spiels mit Rollen im lyrischen Kontext.
- Überlieferungsprobleme und Varianz im Minnesang
- Rekonstruktion von Überlieferungsstammbäumen und -verhältnissen
- Analyse der Performativität und der Kommunikation im Minnesang
- Untersuchung der Rolle der Fiktionalität und des Spiels mit Rollen in der Lyrik
- Bedeutung der Rezeptionsästhetik und der historischen Relevanz bei der Interpretation von Minnesangtexten
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort bietet eine Einführung in das Thema der Arbeit und beleuchtet die Herausforderungen der Rekonstruktion von Liedern aus dem Minnesang. Die Einleitung stellt die zentrale Frage der Arbeit, die Überlieferungsprobleme im Minnesang, sowie den Fokus auf den Minnesänger Reinmar vor.
Das Kapitel "Der Forschungsstand zu Überlieferungs- und Varianzproblemen" beleuchtet verschiedene Ansätze zur Interpretation der Varianz in der Überlieferung, insbesondere die Autor- und die Schreibertheorie. Zudem werden Editionsprinzipien und deren Einfluss auf die Rezeption der Texte diskutiert.
Das Kapitel "Performanz, Kommunikation und Fiktionalität" untersucht die performative Natur des Minnesangs und die Rolle der Kommunikation in der Entstehung und Rezeption der Lieder. Die Fiktionalität der Texte und die Konstruktion von Rollen im lyrischen Kontext werden ebenfalls beleuchtet.
Die Kapitel "Analyse von Reinmar VI (SÔ EZ IENER NÂHET DEME TAGE, MF 154,32)" und "Analyse von Reinmar XII (Ein wîseR MAN SOL NIHT ZE VIL, MF 162,7)" stellen detaillierte Analysen von zwei Liedern Reinmars vor. Die Analysen betrachten die unterschiedlichen Fassungen der Lieder in verschiedenen Handschriften, untersuchen den Gedankenverlauf und beurteilen die Strophenkombinationen und deren Bedeutung für die Interpretation der Lieder.
Schlüsselwörter
Minnesang, Reinmar, Überlieferung, Varianz, Performativität, Kommunikation, Fiktionalität, Rezeptionsästhetik, historische Relevanz, Handschriften, Strophenkombinationen, Rollenlyrik, mediävistische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Reinmar und welche Bedeutung hat er für den Minnesang?
Reinmar der Alte war einer der bedeutendsten Vertreter der "hohen Minne" um 1200. Sein Werk ist ein zentrales Beispiel für das Experimentieren mit höfischen Liebesauffassungen und literarischer Sprache.
Warum weichen die Handschriften seiner Lieder voneinander ab?
Da die Handschriften erst 100 bis 150 Jahre nach der Entstehung der Lieder angefertigt wurden, kam es durch verschiedene Schreiber zu Varianten, Fehlern oder bewussten Änderungen, sodass kein "Originaltext" existiert.
Was ist ein "performativer Selbstwiderspruch" im Minnesang?
Dies beschreibt Situationen beim Vortrag, in denen das Gezeigte (die Mimik/Gesten des Sängers) dem Gesagten (dem Text) widerspricht, was für das mittelalterliche Publikum unterhaltsam und spielerisch war.
Wie erkennt man im Text, ob ein Mann oder eine Frau spricht?
Das ist oft schwierig, da Sprecherstimmen nicht explizit markiert sind. Die Arbeit analysiert Wendungen und den Sinngehalt der Strophen, um zwischen Männer- und Frauenrollen (Rollenlyrik) zu unterscheiden.
Welche Rolle spielt die Rezeptionsästhetik bei der Edition der Texte?
Moderne Editionsprinzipien, wie die von Albrecht Hausmann, betonen die historische Relevanz und wie die Texte von ihrem damaligen Publikum wahrgenommen wurden, anstatt nur nach einem hypothetischen Urtext zu suchen.
- Citar trabajo
- Claus Sölvsteen (Autor), 2014, Überlieferungs-, Varianz- und Vortragsprobleme bei Reinmar, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/346500