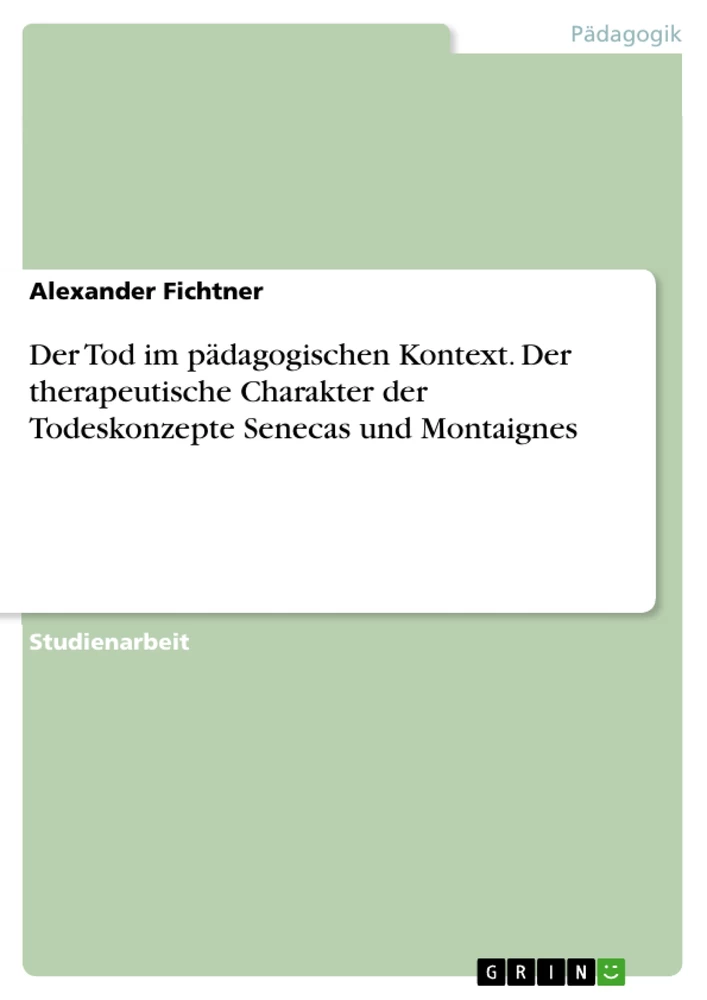Die Arbeit behandelt den Tod in einem pädagogischen Kontext. Anhand von Senecas und Montaignes "Todeskonzepte" wird der Umgang mit dem Sterben und dem Tod verdeutlicht. Der Autor vertritt die These, dass beide Konzepte einen therapeutischen Charakter besitzen.
Der Tod löst bei vielen Menschen in der westlichen Welt ein Unbehagen aus. Alleine die Vorstellung zu sterben - und nie mehr aufzuwachen - ist für ein Teil der Menschen im 21. Jahrhundert ein quälender Gedanke, der gerne verdrängt wird. Der Tod ist in unserer heutigen (Medien-)Gesellschaft einerseits noch stark tabuisiert1, andererseits – und das ist das Paradoxe - ist er in den Medien allgegenwärtig, d.h. wir werden ständig mit dem (fiktiven oder realen) Tod anderer, Fremder, konfrontiert (z.B. in Filmen, in Nachrichten). Dieser Tod als Sekundärerfahrung ersetzt zunehmend den Tod als Primärerfahrung, d.h. die unmittelbare Erfahrung mit dem Tod.
Die Einstellung zum Tod und zum Sterben wird in jeder Epoche vom Zeitgeist, den kulturellen Einflüssen, beeinflusst und bestimmt. Während der Tod in der Antike und im Mittelalter bis in die Neuzeit hinein – aufgrund der geringeren Lebenserwartung der Menschen früher und dem höheren Todesrisiko2 – für die Menschen sehr viel gegenwärtiger und bedrohlicher war, ist der Tod heute ein Tabu-Thema und das Sterben findet normalerweise im Krankenhaus statt. Noch im 19. Jahrhundert, als es große und mehr-generationale Familien gab, war das Sterben sehr oft eine Familienangelegenheit, das v.a. zuhause stattfand und die Familienmitglieder samt Kinder einschloss.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflichkeiten, Definitionen und Forschungsstand
- Der Tod und das „Sterben lernen“ bei Seneca und Montaigne
- Das Todeskonzept bei Seneca
- Tod und Sterben lernen bei Montaigne
- Kritische Reflexion: Der therapeutische Charakter bei Seneca
- und Montaigne und die Philosophie der Natalität
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Todeskonzepte von Seneca und Montaigne in ihren wesentlichen Punkten darzustellen und den therapeutischen Charakter dieser Konzepte zu beleuchten. Zudem soll anhand der „Philosophie der Natalität“ (Hannah Arendt) erörtert werden, ob der Tod als Ausgangspunkt für die Gestaltung des Lebens geeignet ist.
- Die Todeskonzepte von Seneca und Montaigne
- Der therapeutische Charakter der Todeskonzepte
- Die Philosophie der Natalität und ihre Relevanz für die Lebensgestaltung
- Der Tod als integrativer Bestandteil des Lebens
- Die Bedeutung des Todes in der abendländischen Kultur und seine Auswirkungen auf die Erziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die ambivalenten Beziehungen zur Todesvorstellung in der heutigen Zeit. Sie verdeutlicht, dass der Tod trotz seiner Tabuisierung in der Gesellschaft allgegenwärtig ist. Die Einleitung zeichnet die historische Entwicklung des Todes als Thema in der Philosophie und der Erziehung nach und führt die Todeskonzepte von Seneca und Montaigne als Ausgangspunkt der Arbeit ein.
Begrifflichkeiten, Definitionen und Forschungsstand
Dieses Kapitel klärt einige grundlegende Begriffe und Definitionen zum Tod und gibt einen Überblick über die Forschungsperspektiven auf den Tod aus philosophischer Sicht. Es werden unterschiedliche Todesdefinitionen in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen erläutert, insbesondere die medizinische Definition des Hirntodes.
Der Tod und das „Sterben lernen“ bei Seneca und Montaigne
Die Kapitel 3.1 und 3.2 widmen sich den Todeskonzepten von Seneca und Montaigne. Sie analysieren, wie diese Philosophen den Tod als integrativen Bestandteil des Lebens begriffen und ihn in ihre Lebensführung integriert haben.
Kritische Reflexion: Der therapeutische Charakter bei Seneca und Montaigne und die Philosophie der Natalität
In diesem Kapitel erfolgt eine kritische Reflexion der Todeskonzepte von Seneca und Montaigne. Es wird der therapeutische Charakter dieser Konzepte im Vergleich zur Verhaltenstherapie beleuchtet. Zudem wird der Zusammenhang mit der Philosophie der Natalität (Hannah Arendt) untersucht, um zu prüfen, ob der Tod als Ausgangspunkt für die Gestaltung des Lebens geeignet ist.
Schlüsselwörter
Der Text befasst sich mit dem Tod im pädagogischen Kontext, den Todeskonzepten von Seneca und Montaigne, dem therapeutischen Charakter dieser Konzepte, der Philosophie der Natalität, der Bedeutung des Todes in der abendländischen Kultur und seiner Auswirkungen auf die Erziehung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Sterben lernen“ bei Seneca?
Für Seneca bedeutet es, sich täglich mit der Endlichkeit auseinanderzusetzen, um die Angst vor dem Tod zu verlieren und dadurch freier und bewusster zu leben.
Wie unterscheidet sich Montaignes Todeskonzept?
Montaigne sieht den Tod als natürlichen Teil des Lebensflusses. Er plädiert dafür, den Tod nicht zu fürchten, sondern ihn durch Gewöhnung und Akzeptanz zu entmystifizieren.
Was ist der „therapeutische Charakter“ dieser Konzepte?
Beide Konzepte dienen der psychischen Entlastung: Durch die philosophische Vorbereitung auf den Tod soll die Lebensqualität im Hier und Jetzt gesteigert werden.
Was versteht Hannah Arendt unter „Natalität“?
Natalität ist die menschliche Fähigkeit, durch Geburt etwas Neues anzufangen. Sie steht als lebensbejahender Gegenpol zur ständigen Fixierung auf den Tod.
Warum ist der Tod heute ein Tabuthema?
Durch die moderne Medizin und die Auslagerung des Sterbens in Krankenhäuser ist die unmittelbare Primärerfahrung mit dem Tod im Alltag seltener geworden.
- Arbeit zitieren
- Alexander Fichtner (Autor:in), 2016, Der Tod im pädagogischen Kontext. Der therapeutische Charakter der Todeskonzepte Senecas und Montaignes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/346548