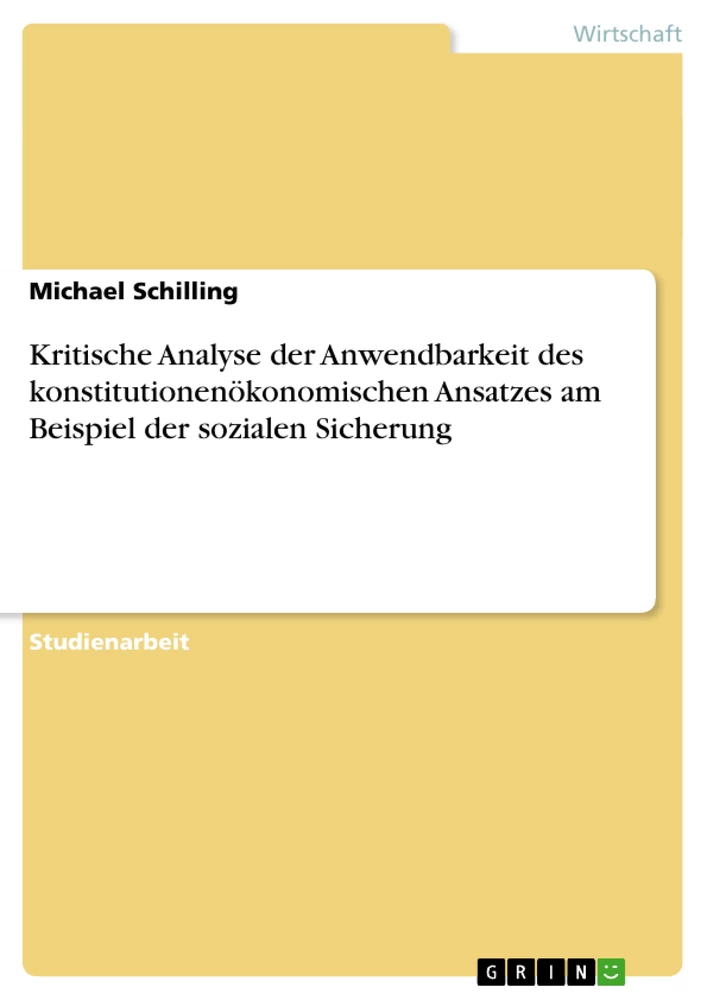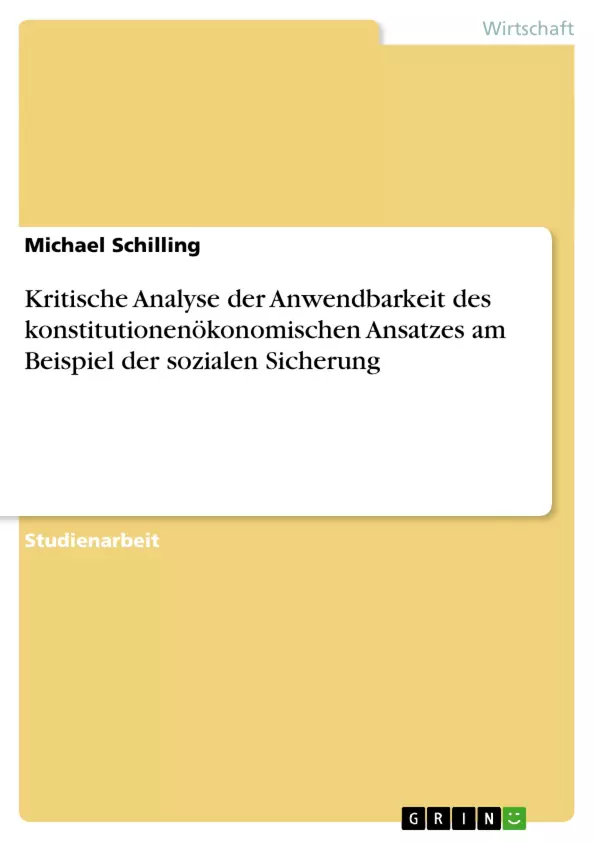In der aktuellen politischen Diskussion wird eine Reform der sozialen Sicherungssysteme für unabdingbar gehalten. Durch die demographische Entwicklung in Deutschland ist eine grundlegende Reform der Sozialsysteme notwendig geworden. Ziel der Bundesregierung ist es, mit zehn Gesetzen, die bis Weihnachten beschlossen werden sollen, die sozialen Sicherungssysteme kurzfristig zu retten und langfristig zu stabilisieren. Wie dringend Reformen sind, um den Kollaps der Sozialversicherungssysteme zu vermeiden, lässt sich am Beispiel der Schwankungsreserve der Rentenversicherung aufzeigen. Diese betrug ehemals 3,6 Monatsausgaben und ist mittlerweile auf 0,5 Monatsausgaben reduziert worden. Um den Beitragssatz im kommenden Jahr bei 19,5 % stabil zu halten, soll die Finanzreserve auf 0,2 Monatsausgaben reduziert werden. Sollte sich die Konjunktur im nächsten Jahr entgegen den Prognosen nicht erholen, wäre die Rentenversicherung auf Überbrückungsgelder seitens des Finanzministers angewiesen.
Viele Vorschläge zur Reform der sozialen Sicherungssysteme werden von der Politik vielfach aus Gerechtigkeitsgründen nicht oder nur moderat umgesetzt. Mit Hilfe der Konstitutionenökonomik sollen Reformvorschläge dargestellt werden, die neue Regeln in den sozialen Sicherungssysteme installieren.
Im folgenden Kapital wird kurz das System der sozialen Sicherung in Deutschland skizziert. Der folgende Abschnitt stellt die Grundüberlegungen zur Konstitutionenökonomik dar. Das Hauptkapitel dieser Arbeit beschäftigt sich mit möglichen Reformen der sozialen Sicherung aus konstitutionenökonomischer Sicht. Zuerst werden Grundüberlegungen als Voraussetzung für notwendige Reformen getroffen. Anschließend werden einzelne Reformvorschläge zu den jeweiligen Versicherungen vorgestellt, wobei der Schwerpunkt auf Reformen zur Renten- und Arbeitslosenversicherung gelegt wurde. Das abschließende Fazit bewertet kurz die vorgestellten Reformmöglichkeiten hinsichtlich der praktischen Umsetzbarkeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziale Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland
- Der konstitutionenökonomische Ansatz.
- Reformen zur sozialen Sicherung aus konstitutionenökonomischer Sicht.
- Grundüberlegungen
- Reformmodelle zur gesetzlichen Rentenversicherung
- Reformmodell I zur gesetzlichen Rentenversicherung
- Reformmodell II zur gesetzlichen Rentenversicherung
- Reformmodell zur Arbeitslosenversicherung
- Leitlinien für Reformen zur Krankenversicherung bzw. Pflegeversicherung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Anwendbarkeit des konstitutionenökonomischen Ansatzes auf die Reform der sozialen Sicherungssysteme in Deutschland.
- Die Arbeit stellt die Herausforderungen der sozialen Sicherungssysteme im Kontext des demographischen Wandels dar.
- Sie untersucht die grundlegenden Überlegungen des konstitutionenökonomischen Ansatzes.
- Die Arbeit präsentiert Reformmodelle zur gesetzlichen Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und weiteren Sozialversicherungen aus konstitutionenökonomischer Sicht.
- Schließlich bewertet sie die praktische Umsetzbarkeit der vorgestellten Reformmöglichkeiten.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert den aktuellen Reformbedarf der sozialen Sicherungssysteme in Deutschland und führt in das Thema ein. Im zweiten Kapitel wird das System der sozialen Sicherung in Deutschland skizziert. Das dritte Kapitel stellt den konstitutionenökonomischen Ansatz dar. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit Reformen der sozialen Sicherung aus konstitutionenökonomischer Sicht. Es beleuchtet Grundüberlegungen sowie konkrete Reformmodelle für die verschiedenen Sozialversicherungen, mit einem Schwerpunkt auf der Renten- und Arbeitslosenversicherung.
Schlüsselwörter
Soziale Sicherung, Konstitutionenökonomik, Reform, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, demographischer Wandel, Subsidiaritätsprinzip, Umlageverfahren, Altenquotient.
Häufig gestellte Fragen zur Konstitutionenökonomik
Was ist der konstitutionenökonomische Ansatz?
Ein Ansatz, der sich auf die Gestaltung der grundlegenden Regeln (die „Verfassung“) eines Systems konzentriert, um langfristige Stabilität zu erreichen.
Warum ist die Rentenversicherung in der Krise?
Der demographische Wandel und sinkende Finanzreserven (Schwankungsreserve) gefährden die langfristige Finanzierbarkeit des Umlageverfahrens.
Welche Reformen werden für die Arbeitslosenversicherung vorgeschlagen?
Vorgeschlagen werden Modelle, die stärker auf Eigenverantwortung und das Subsidiaritätsprinzip setzen.
Was bedeutet das Subsidiaritätsprinzip?
Dass Aufgaben möglichst von der kleinsten Einheit (z.B. dem Einzelnen) gelöst werden sollten, bevor der Staat eingreift.
Wie bewertet die Arbeit die praktische Umsetzbarkeit dieser Reformen?
Die Arbeit analysiert kritisch, dass viele ökonomisch notwendige Reformen oft an politischen Gerechtigkeitsdebatten scheitern.
- Citar trabajo
- Michael Schilling (Autor), 2003, Kritische Analyse der Anwendbarkeit des konstitutionenökonomischen Ansatzes am Beispiel der sozialen Sicherung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34660