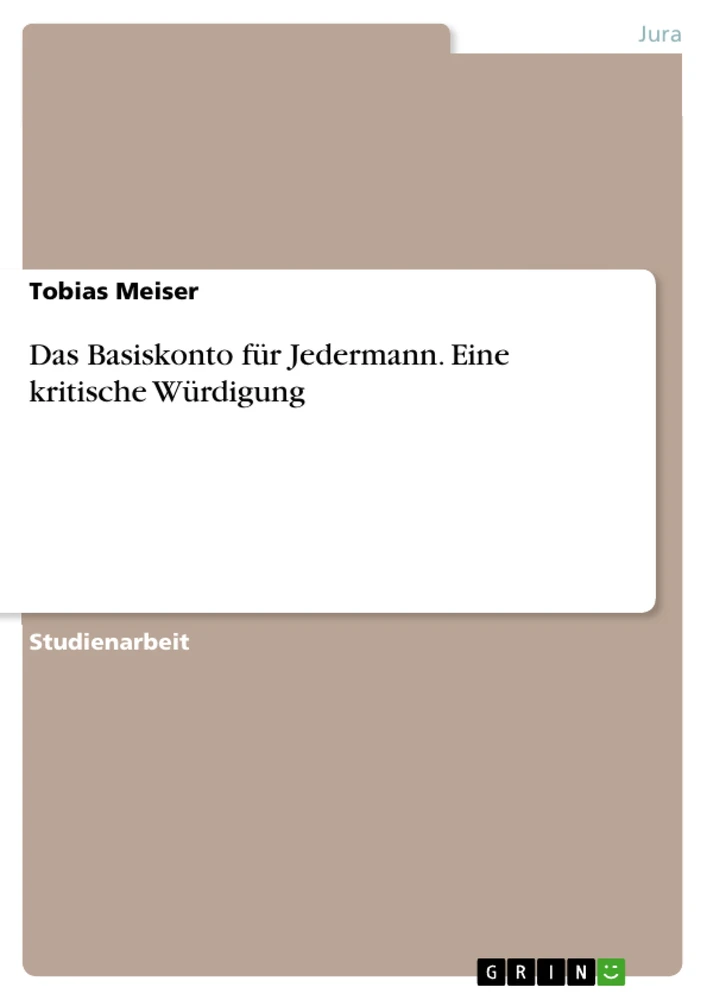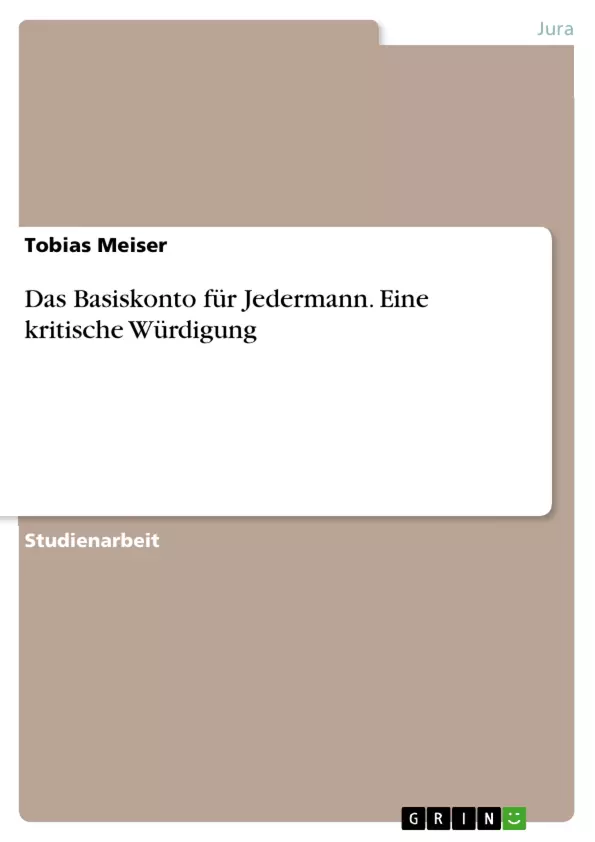Die vorliegende Arbeit erläutert zunächst kritisch die Regelungen des Zahlungskontengesetzes im Hinblick auf das Basiskonto für Jedermann, um sich anschließend — aufgrund des zivilrechtlichen Schwerpunkts zumindest kurz — mit den verfassungsrechtlichen Fragen zur Beschränkung der Vertragsfreiheit und der gesetzlichen Regelung der Höhe des Entgeltes für Basiskonten auseinanderzusetzen, schließlich wird die Arbeit ein Fazit zum Zahlungskontengesetz ziehen.
Aufgrund der Entwicklungen hin zu einem weitgehend bargeldlosen Zahlungsverkehr wird ein Bankkonto für die Teilhalbe an einem wirtschaftlichen und sozialen Leben immer wichtiger. Ein Bankkonto wird dabei nicht nur für die Geschäfte des täglichen Lebens stets wichtiger, da immer mehr dieser Geschäfte nur über ein Bankkonto abgewickelt werden können. Vielmehr ist ein Bankkonto vor allem für essentielle Verträge und Geschäfte, wie zum Beispiel die Lohnzahlungen in einem Arbeitsverhältnis, der Erhalt von Sozialleistungen, das Zahlen der Miete, Strom-, Wasser- und Telefonkosten unabdingbar.
Trotz dieser enormen Wichtigkeit der Führung eines Zahlungskontos gehen Studien davon aus, dass 600.000 Haushalte in Deutschland kein Zahlungskonto führen. Aus diesem Grund gibt es seit nunmehr über 21 Jahren eine Diskussion um einen Kontrahierungszwang für Banken für die Eröffnung eines Zahlungskontos für Verbraucher. Es war der „Zentrale Kreditausschuss“ (heute: „Die Deutsche Kreditwirtschaft“), welcher 1995 durch die Empfehlung zum „Girokonto für jedermann“ den Stein ins Rollen brachte. Grund für diese Empfehlung war die Privatisierung der Postbank zum Jahr 1995. Aufgrund der Privatisierung besteht auf den bereits 1909 eingeführten Postscheckdienst (später Postgirodienst) kein Rechtsanspruch mehr.
Wegen des nun fehlenden Kontrahierungszwangs sollte durch die Einführung eines "Girokonto für Jedermann“ der bargeldlosen Zahlungsverkehr wieder für jeden möglich sein. Doch diese Empfehlung des „Zentralen Kreditausschusses“ war lediglich eine unverbindliche Selbstverpflichtung, die keinen Rechtsanspruch begründete. Versuche aus der Empfehlung des „Zentralen Kreditausschusses“ einen Kontrahierungszwang für die Banken herzuleiten scheiterten regelmäßig vor Gericht. Ebenso scheiterten Gesetzesentwürfe der Fraktionen „Die Linke“, sowie „Bündnis 90/Die Grünen“ die ein Recht auf ein Girokonto auf Guthabenbasis zum Ziel hatten. So war es die Europäische Union, die sich für einen Rechtsanspruch auf ein Zahlungskonto einsetzte.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Das Zahlungskontengesetz im Hinblick auf das Basiskonto für Jedermann
- I. Anwendungsbereich
- 1. Anspruchsberechtigte
- 2. Anspruchsverpflichtete
- II. Umfang des Basiskonto für Jedermann
- III. Begründung eines Basiskontovertrages
- 1. Ablehnung wegen eines bereits vorhandenen Zahlungskontos
- 2. Ablehnung wegen strafbaren Verhaltens oder wegen Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot
- 3. Ablehnung wegen früherer Kündigung wegen Zahlungsverzuges
- IV. Beschränkung des Kündigungsrechts
- 1. Kündigungsrecht nach § 42 II ZKG
- 2. Kündigungsrecht nach § 42 III ZKG
- 3. Kündigungsrecht nach § 42 IV ZKG
- 4. Erklärungsfrist
- 5. Kündigungserklärung durch das kontoführende Institut
- V. Beschränkung der vereinbarten Entgelte
- VI. Diskriminierungsverbot
- VII. Beratungspflicht der verpflichteten Kreditinstitute
- VIII. Rechtsschutz
- C. Verfassungsrechtliche Fragen zum Zahlungskontengesetz im Hinblick auf das Basiskonto für Jedermann
- I. Einschränkung der Vertragsfreiheit
- II. Einschränkung des Entgeltes
- D. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den rechtlichen Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem Basiskonto für Jedermann (BfJ) stellen. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse des Zahlungskontengesetzes (ZKG) und seinen Auswirkungen auf die Vertragsfreiheit und das Entgelt für Basiskonten. Die Arbeit betrachtet sowohl die zivilrechtlichen als auch die verfassungsrechtlichen Aspekte dieses Themas.
- Die Einführung des Basiskonto für Jedermann als gesetzlicher Anspruch
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Zahlungskontengesetzes
- Die Einschränkung der Vertragsfreiheit durch den Kontrahierungszwang
- Die Regulierung des Entgelts für Basiskonten
- Die verfassungsrechtlichen Aspekte der gesetzlich geregelten Basiskonten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Bedeutung eines Bankkontos im modernen Alltag und beleuchtet die historische Entwicklung der Diskussion um einen Kontrahierungszwang für Banken im Hinblick auf die Eröffnung eines Zahlungskontos für Verbraucher. Kapitel B analysiert detailliert das Zahlungskontengesetz im Hinblick auf das Basiskonto für Jedermann und untersucht die Anspruchsberechtigten und -verpflichteten, den Umfang des Basiskontos, die Voraussetzungen für den Abschluss eines Basiskontovertrages, die Einschränkungen des Kündigungsrechts, die Regulierung der Entgelte, das Diskriminierungsverbot und die Beratungspflicht der Kreditinstitute. Kapitel C widmet sich den verfassungsrechtlichen Fragen zum Zahlungskontengesetz im Hinblick auf die Vertragsfreiheit und die gesetzliche Regelung der Höhe des Entgelts für Basiskonten. Abschließend zieht das Fazit einen Schlusspunkt unter die Analyse und beleuchtet die Relevanz des Zahlungskontengesetzes für Verbraucher und Kreditinstitute.
Schlüsselwörter
Basiskonto für Jedermann, Zahlungskontengesetz, Vertragsfreiheit, Kontrahierungszwang, Entgelt, Diskriminierung, Beratungspflicht, Rechtsschutz, Verfassungsrecht, Privatautonomie, soziale Marktwirtschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Basiskonto für Jedermann?
Es ist ein gesetzlich garantierter Anspruch auf ein Zahlungskonto auf Guthabenbasis, der durch das Zahlungskontengesetz (ZKG) geregelt wird.
Wer ist berechtigt, ein Basiskonto zu eröffnen?
Jeder Verbraucher mit rechtmäßigem Aufenthalt in der EU, einschließlich Obdachloser und Asylsuchender, hat einen Anspruch gegenüber den Kreditinstituten.
Darf eine Bank die Eröffnung eines Basiskontos ablehnen?
Eine Ablehnung ist nur in engen Grenzen möglich, etwa wenn der Kunde bereits ein funktionierendes Konto hat oder wegen Straftaten gegen die Bank verurteilt wurde.
Wie hoch dürfen die Gebühren für ein Basiskonto sein?
Das ZKG schreibt vor, dass die Entgelte für ein Basiskonto „angemessen“ sein müssen, was immer wieder Gegenstand rechtlicher Prüfungen ist.
Warum ist ein Bankkonto für die soziale Teilhabe so wichtig?
Ohne Konto ist der Erhalt von Lohn oder Sozialleistungen sowie das Zahlen von Miete und Strom im modernen bargeldlosen Zahlungsverkehr kaum möglich.
- Arbeit zitieren
- Tobias Meiser (Autor:in), 2016, Das Basiskonto für Jedermann. Eine kritische Würdigung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/347127