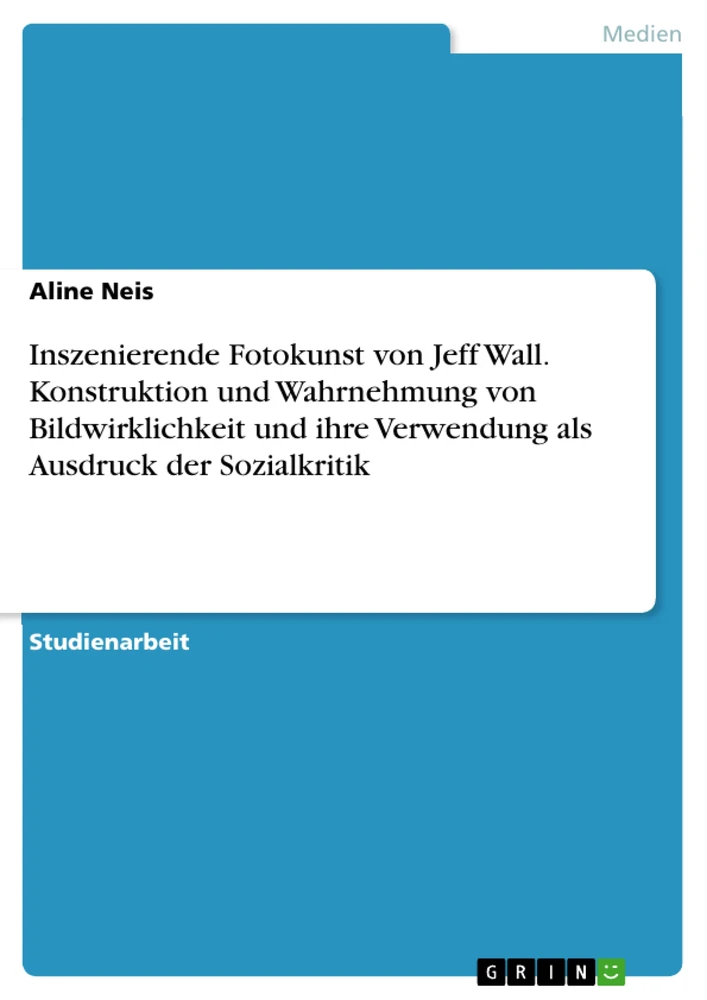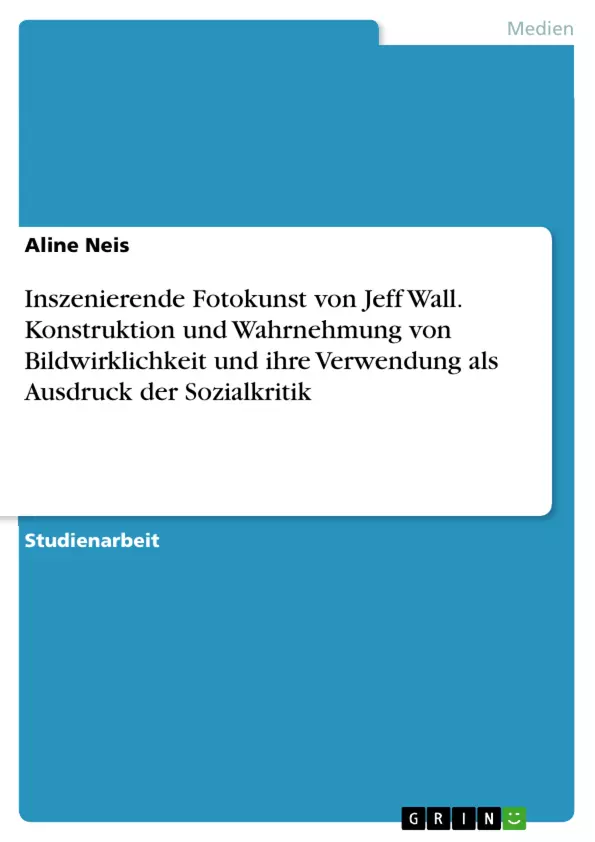Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Werken der inszenierenden Fotografie Jeff Walls. Dabei wird dem Verhältnis von Wirklichkeit und Illusion in Walls Arbeit besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Im Zuge der Arbeit soll zum einen auf die entstehungstechnischen Hintergründe von Walls Arbeit eingegangen werden, um deren Bezug und Relevanz für die Vermittlung und Aufdeckung eines tieferen Symbolismus in den Aufnahmen scheinbar trivialer Alltagsszenen aufzuzeigen. Zum anderen soll ebenfalls die Rolle des Rezipienten für Walls Spiel mit dessen Wahrnehmung dargestellt werden.
Im Fokus der Arbeit steht dabei, mit welchen Mitteln es Wall in seinen fotografischen Arbeiten gelingt, die Grundstrukturen menschlicher Gesellschaft und deren archetypische Verhaltensmuster darzustellen und nicht zuletzt Kritik an diesen zu üben. Daher muss im Zuge dieser Arbeit auf eine Darstellung Walls früherer konzeptueller und fotojournalistischer Werke verzichtet werden, da es sich bei diesen nicht um Inszenierungen handelt und sie somit für die Beantwortung der Fragestellung nicht relevant sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jeff Wall
- Das räumliche Arrangement seiner Werke
- Fotografie als Inszenierung
- Die Rolle des Rezipienten
- Momente der Aufdeckung
- Die Symbolik in Walls Kunst
- Die Allegorie der menschlichen Gesellschaft
- Walls Werk als Sozialkritik
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beschäftigt sich mit der inszenierenden Fotokunst von Jeff Wall und analysiert die Konstruktion und Wahrnehmung von Bildwirklichkeit in seinen Inszenierungen. Sie beleuchtet die Rolle des Rezipienten in der Interpretation der Bilder und untersucht, wie Wall mit seinen Werken gesellschaftliche Kritik übt.
- Das Verhältnis von Wirklichkeit und Illusion in der Fotografie
- Die Rolle des Rezipienten in der Interpretation der Bilder
- Die Bedeutung von Inszenierung und Arrangement in der Fotografie
- Die Verwendung von Symbolen und Allegorien zur Darstellung gesellschaftlicher Strukturen
- Die Kritik an gesellschaftlichen Normen und Verhaltensmustern in Walls Werken
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt "An Eviction" als Beispiel für Walls Inszenierungen vor und beleuchtet die Ambivalenz zwischen scheinbarer Alltäglichkeit und inszenierter Darstellung. Sie stellt die Thematik der Arbeit sowie den Fokus auf die Inszenierungen Walls dar.
- Jeff Wall: Dieses Kapitel beleuchtet Walls Biografie und seinen Werdegang als Künstler, wobei der Einfluss der Malerei auf seine Fotoarbeiten hervorgehoben wird. Es wird die komplexe Beziehung zwischen Realität und Illusion in seinen Werken erklärt.
- Das räumliche Arrangement seiner Werke: Der Abschnitt beleuchtet die Präsentation von Walls Fotografien in Leuchtkästen und deren Bedeutung für die Wahrnehmung der Bilder. Es wird die Verbindung zwischen dem Betrachter und der dargestellten Welt analysiert.
- Fotografie als Inszenierung: Dieses Kapitel erläutert Walls Arbeitsweise und die Rolle der Inszenierung im Entstehungsprozess seiner Fotografien. Es erklärt die komplexe Verzahnung von Realität und Fiktion in seinen Werken.
- Die Rolle des Rezipienten: Dieser Abschnitt untersucht die Interaktion des Betrachters mit den Bildern und die Ambivalenz, die durch die Kombination von scheinbarer Realität und künstlicher Inszenierung entsteht.
- Momente der Aufdeckung: Hier wird der Prozess der Interpretation von Walls Werken beleuchtet und der Fokus auf die Momente gelegt, in denen die Inszenierung durch den Betrachter erkannt wird.
- Die Symbolik in Walls Kunst: Dieses Kapitel analysiert die Symbolik und die Allegorien in Walls Werken, wobei die Darstellung von gesellschaftlichen Strukturen und deren Kritik im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Inszenierte Fotografie, Jeff Wall, Bildwirklichkeit, Konstruktion, Wahrnehmung, Illusion, Realität, Rezipient, Allegorie, Sozialkritik, Fotografie als Medium der Gesellschaftskritik.
Häufig gestellte Fragen
Was zeichnet die Fotokunst von Jeff Wall aus?
Jeff Wall ist bekannt für seine großformatigen, in Leuchtkästen präsentierten Fotografien, die wie Schnappschüsse wirken, aber akribisch wie Filmsets inszeniert sind.
Wie nutzt Jeff Wall Sozialkritik in seinen Bildern?
Durch die Darstellung trivialer Alltagsszenen legt Wall tiefere gesellschaftliche Machtstrukturen, soziale Ungerechtigkeiten und archetypische Verhaltensmuster offen.
Welche Rolle spielt der Rezipient?
Der Betrachter wird in ein Spiel mit der Wahrnehmung verwickelt, bei dem er erst nach und nach die Künstlichkeit der Szene und deren Symbolik erkennt.
Warum verwendet Wall Leuchtkästen?
Die Hinterleuchtung verleiht den Bildern eine cineastische Präsenz und betont die Grenze zwischen der realen Welt des Betrachters und der künstlichen Bildwirklichkeit.
Was ist das Verhältnis von Wirklichkeit und Illusion in seinem Werk?
Walls Werke sind keine Dokumente der Realität, sondern „konstruierte Wahrheiten“, die durch maximale Künstlichkeit eine tiefere soziale Realität aufzeigen.
- Quote paper
- Aline Neis (Author), 2016, Inszenierende Fotokunst von Jeff Wall. Konstruktion und Wahrnehmung von Bildwirklichkeit und ihre Verwendung als Ausdruck der Sozialkritik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/347191